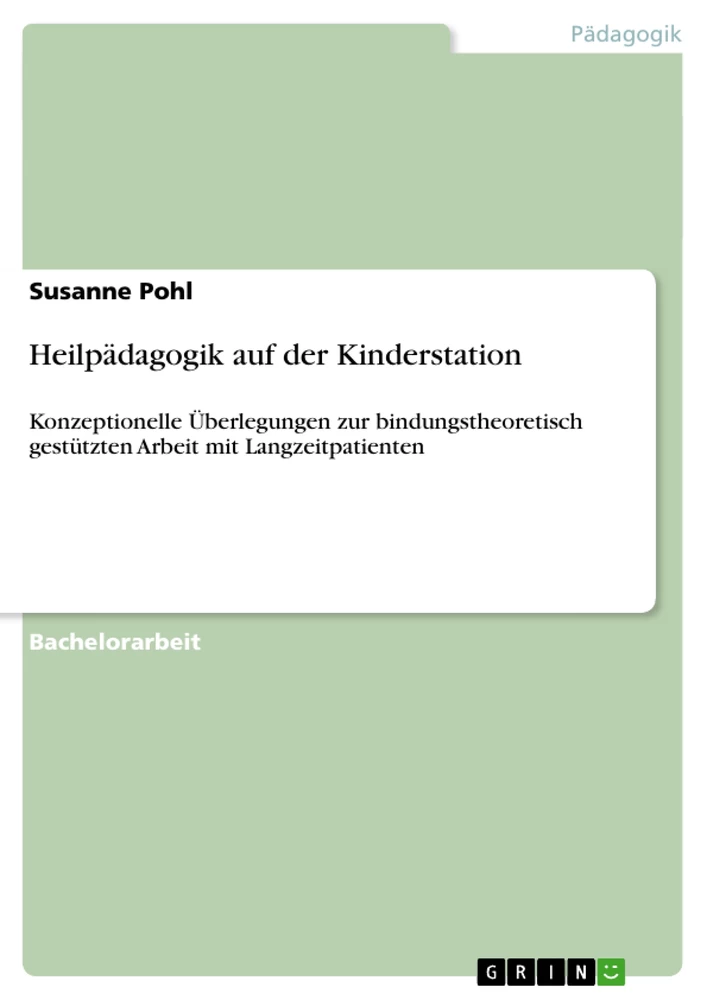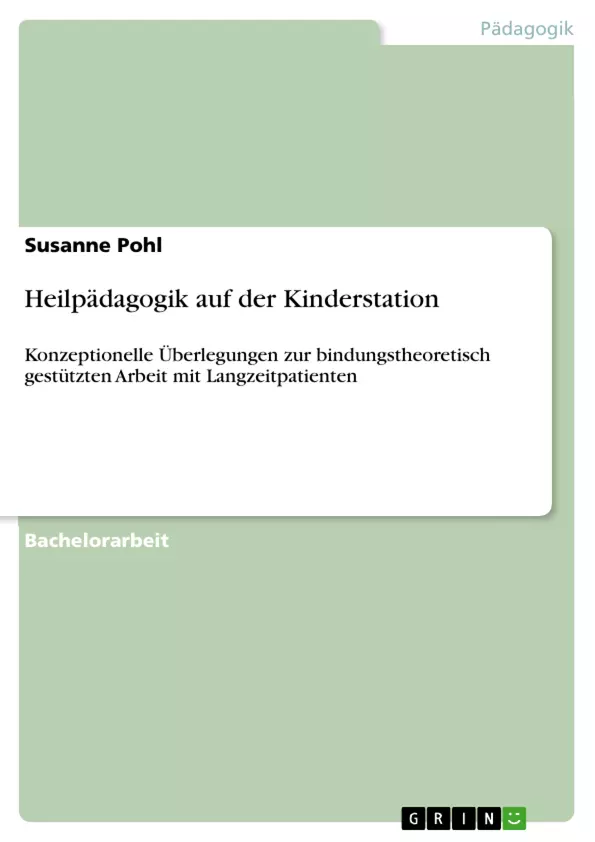Die vorliegende Arbeit beinhaltet konzeptionelle Überlungen zu heilpädagogischen Handlungsmöglichkeiten auf Kinderstationen unter bindungstheoretischen Aspekten. Eine Konzeption, die bindungstheoretisch gestützte heilpädagogische Arbeit anbietet, muss vorab klären was sie unter dieser Form der heilpädagogischen Arbeit
versteht. Da sie sich explizit an Kinderstationen wendet, muss deutlich werden, was die erkrankten Kinder und ihre Eltern brauchen und ob das Ziel der stationären Einrichtung- die Genesung des Kindes, durch die Konzeption unterstützt werden kann. Um diesen praxisnahen Fragen nachzugehen, dient hier eine fundierte theoretischen Auseinandersetzung mit bindungstheoretischen und entwicklungspsychologischen Aspekten und verdeutlicht den bindungs- und entwicklungsspezifischen Bedarf der jungen Patienten. Zusätzlich ist ein Einblick in die derzeitige Situation von Kinderstationen und Kinderkliniken, mit Hilfe aktueller Forschungsergebnisse, gegeben. Die konzeptionellen Überlegungen richten sich an erkrankte Kleinkinder,insbesondere Langzeitpatienten, die stationär untergebracht sind. Bei ihnen liegt aus Autorensicht der größte, noch nicht abgedeckte Handlungsbedarf in Krankenhäusern. Während der Recherchen wurde deutlich, dass es kaum aktuelle und nur sehr wenig Literatur zur psychosozialen Betreuung von Kleinkindern in Krankenhäusern gibt, was die Frage nach der Notwendigkeit psychosozialer Begleitung in Form heilpädagogischer Arbeit, aus wissenschaftlicher- und Patientenperspektive unterstreicht. Die theoretischen Ausführungen beziehen sich insbesondere auf Bowlby, Ainsworth und die Arbeiten von Piaget, da Bowlby und Ainsworth maßgeblich zum besseren Verstädnis der Bedeutung der Muter- Kind- Bindung beigetragen haben. Piagets Bedeutung liegt in dem Aufweisen des Zusammenhangs von Handeln und individueller Entwicklung, verbunden mit der Erkenntnis,dass sich im Laufe des menschlichen Lebens, mit zunehmenden Erfahrungen, die Wahrnehmung der Wirklichkeit ändert. Auch während eines Stationsaufenthalts ändert sich diese Wahrnehmung der Wirklichkeit und orientiert sich im Kleinkindalter vor allem an der Befriedigung der Grundbedürfnisse. Diese Arbeit soll dazu beitragen ein besseres Verständnis für die Situation kranker Kinder und ihrer Eltern in Krankenhäusern zu entwickeln und durch erste konzeptionelle Überlegungen, einen Weg aufzeigen, ihren Bedürfnissen durch heilpädagogisches Handeln, besser gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konzeptionsentwicklung
- Inhalte einer pädagogischen Konzeption
- Notwendigkeit einer Konzeption
- Heilpädagogik - Berufsverständnis und Handlungsfelder
- Heilpädagogik in Krankenhäusern
- Theoretische Grundlagen zur bindungstheoretisch gestützten Arbeit mit Kindern auf Kinderstationen und in Kinderkliniken
- Entwicklung
- Einteilung der Entwicklungsstufen
- Das Kleinkindalter
- Sozial-emotionale Entwicklung und Regulation im Kleinkindalter
- Auswirkungen früher Trennungserfahrungen auf die Eltern-Kind-Bindung
- Bindung als Inneres Arbeitsmodell
- Kranke Kinder im Kleinkindalter
- Krankheitskonzept und Krankheitserleben bei Kleinkindern
- Psychosoziale Situation kranker Kleinkinder und die Folgen von Krankheit
- Ängste und Bedürfnisse von Kindern mit Fokus auf die Situation im Krankenhaus
- Rolle der Eltern
- Die Rolle der Stationsärzte und Krankenschwestern
- Krankenhaussituation
- Alltag auf der Kinderstation und in Kinderkliniken
- Historischer Abriss zur Entwicklung der Kinderstationen und Kinderkliniken
- Exkurs in den GEK-Report 2008 Schwerpunktthema: Kinder im Krankenhaus
- Konzeptionelle Überlegungen: Heilpädagogik auf der Kinderstation
- Zielgruppe und Ziele
- Überlegungen zur Strukturqualität
- Finanzierung
- Räumliche Möglichkeiten
- Personaleingliederung
- Überlegungen zur Orientierungsqualität zum Umgang mit Kinderpatienten
- Bild vom Kind
- Rechte der Kinder im Krankenhaus- EACH- Charta
- Überlegungen zur Orientierungsqualität für die heilpädagogische Arbeit
- Rollenverständnis der Heilpädagogin auf der Kinderstation
- Methoden und Durchführung von Beobachtung und Dokumentation im stationären Alltag– Erfassung des heilpädagogischen Interventionsbedarfs
- Bindungstheoretisch gestützte Intervention in der heilpädagogischen Stationsarbeit
- Elternarbeit
- Heilpädagogische Spieltherapie für Kinder mit Bindungsstörungen
- Möglichkeiten der Heilpädagogin zur kurzfristigen Rollenübernahme als (Bindungs-) Bezugsperson für das erkrankte Kind
- Bedeutung des freien Spiels für die heilpädagogische Arbeit, als elementarste Zugangs- und Ausdrucksform des Kindes
- Einfluss der Interaktionsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen und Kontakt zu Freunden
- Arbeitsmaterial
- Kooperation mit dem Stationspersonal
- Überlegungen zur Prozessqualität
- Aufnahme des Kindes auf die Kinderstation
- Klinikaufenthalt
- Begleitung des Kindes
- Vorbereitung des Kindes auf notwendige Untersuchungen und Eingriffe
- Begleitung von Patienten mit psychischen Problemen
- Begleitungen von Patienten unter erschwerten Bedingungen, wie schweren oder chronischen Erkrankungen
- Tagesablauf
- Entlassung
- Entwicklung und Bedeutung der Bindung im Kleinkindalter
- Auswirkungen von Krankheit und Krankenhausaufenthalt auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern
- Rolle der Heilpädagogik in der Unterstützung von Kindern und Familien im Krankenhaus
- Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung der heilpädagogischen Arbeit auf Kinderstationen
- Relevanz und Bedeutung der Elternarbeit in der bindungsorientierten Intervention
- Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund der Autorin, der sie zu der Thematik geführt hat. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Rolle der Heilpädagogik in der Arbeit mit Langzeitpatienten auf Kinderstationen, vor dem Hintergrund der besonderen Bedürfnisse dieser Kinder.
- Das Kapitel "Konzeptionsentwicklung" beschäftigt sich mit den Inhalten und der Notwendigkeit einer pädagogischen Konzeption, die die Grundlage für die praktische Arbeit bildet.
- Das Kapitel "Heilpädagogik - Berufsverständnis und Handlungsfelder" definiert die Profession der Heilpädagogik und skizziert ihre verschiedenen Handlungsfelder, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle der Heilpädagogik im Krankenhaus liegt.
- Das Kapitel "Theoretische Grundlagen zur bindungstheoretisch gestützten Arbeit mit Kindern auf Kinderstationen und in Kinderkliniken" beleuchtet die Entwicklung und Bedeutung der Bindung im Kleinkindalter, sowie die Auswirkungen von Krankheit und Krankenhausaufenthalt auf die psychosoziale Entwicklung von Kindern.
- Das Kapitel "Konzeptionelle Überlegungen: Heilpädagogik auf der Kinderstation" stellt die wichtigsten Überlegungen zur Gestaltung der heilpädagogischen Arbeit auf Kinderstationen vor, unter Berücksichtigung der Struktur-, Orientierungs- und Prozessqualität. Dabei werden die Zielgruppe, die notwendigen Ressourcen und die spezifischen Methoden der bindungsorientierten Intervention beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten einer bindungstheoretisch gestützten heilpädagogischen Arbeit auf Kinderstationen. Ziel ist es, eine konzeptionelle Grundlage für die Arbeit mit Langzeitpatienten zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien gerecht wird. Dazu werden die spezifischen Anforderungen des stationären Settings und die psychosoziale Situation von kranken Kindern im Kleinkindalter unter besonderer Berücksichtigung der Bindungstheorie beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bedeutung der Bindungstheorie im Kontext der heilpädagogischen Arbeit mit Kindern auf Kinderstationen. Zentrale Schlüsselwörter sind: Heilpädagogik, Kinderstation, Langzeitpatienten, Bindungstheorie, Entwicklungspsychologie, psychosoziale Entwicklung, Krankheitserleben, Elternarbeit, Intervention, Spieltherapie, Struktur-, Orientierungs- und Prozessqualität.
- Arbeit zitieren
- Susanne Pohl (Autor:in), 2010, Heilpädagogik auf der Kinderstation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162361