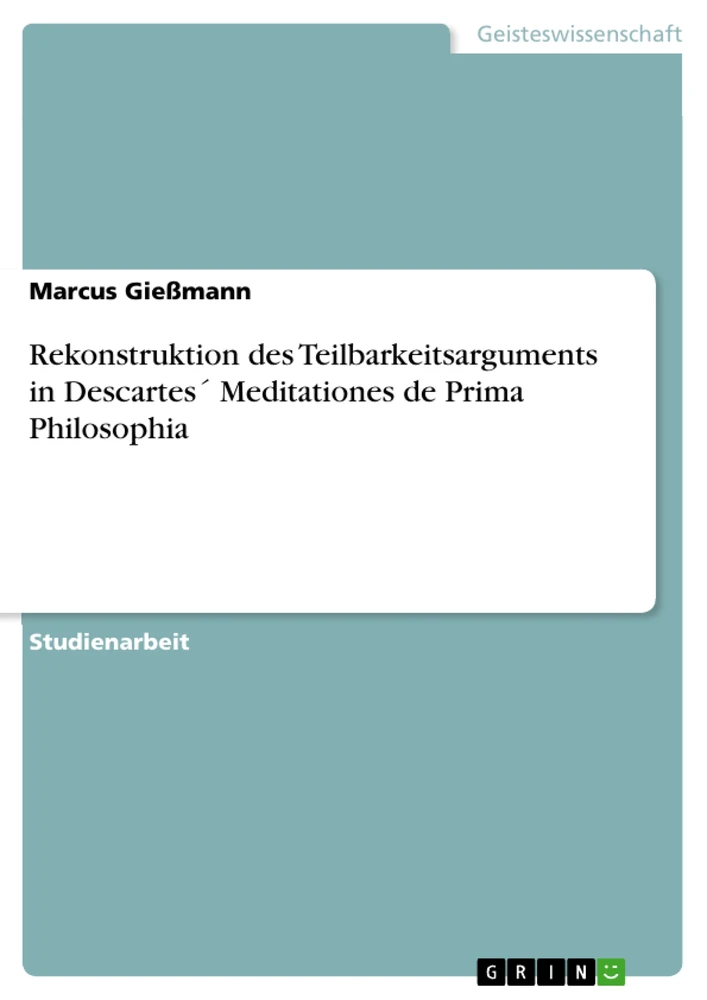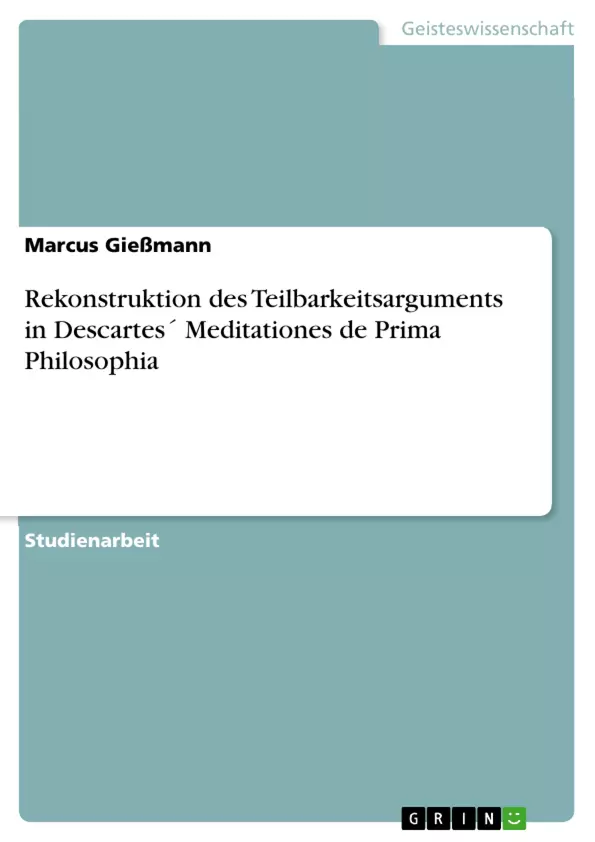Gegenstand dieser Arbeit ist die Rekonstruktion von Descartes´ Teilbarkeitsargument. Zuerst führe ich relevante Begriffe der Philosophie des Geistes ein. Danach werde ich Descartes´ Teilbarkeitsargument zuerst kommentieren sowie aussagenlogisch aufgliedern und darstellen. Im Anschluss daran werden verschiedene Einwände gegen Descartes´ Argument behandelt. Diese Arbeit schließt mit allgemeinen geistesphilosophischen Konsequenzen, die sich aus Descartes´ Position ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- Relevante Begriffe der Philosophie des Geistes
- Descartes' Meditationes de Prima Philosophia
- Das Teilbarkeitsargument in Descartes' Meditationes
- Rekonstruktion des Teilbarkeitsarguments
- Einwände
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Rekonstruktion von Descartes' Teilbarkeitsargument. Zuerst werden relevante Begriffe der Philosophie des Geistes eingeführt. Anschließend wird Descartes' Teilbarkeitsargument kommentiert, aussagenlogisch aufgliedert und dargestellt. Im Anschluss daran werden Einwände gegen Descartes' Argument behandelt. Die Arbeit schließt mit allgemeinen geistesphilosophischen Konsequenzen, die sich aus Descartes' Position ergeben.
- Relevante Begriffe der Philosophie des Geistes (Substanzdualismus, Eigenschaftsdualismus, Interaktionismus, Parallelismus, Okkasionalismus, Epiphänomenalismus)
- Descartes' Meditationes de Prima Philosophia (methodischer Zweifel, res cogitans, res extensa)
- Das Teilbarkeitsargument (Beweise für die Trennung von Körper und Geist)
- Einwände gegen das Teilbarkeitsargument
- Geistesphilosophische Konsequenzen aus Descartes' Position
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert relevante Begriffe der Philosophie des Geistes, wie Substanzdualismus, Eigenschaftsdualismus, Interaktionismus, Parallelismus, Okkasionalismus und Epiphänomenalismus. Das zweite Kapitel befasst sich mit Descartes' Meditationes de Prima Philosophia, insbesondere mit der Frage, was wir mit Sicherheit wissen können und wie Descartes den methodischen Zweifel einsetzt. Das dritte Kapitel stellt das Teilbarkeitsargument in Descartes' Meditationes vor. Das vierte Kapitel rekonstruiert das Teilbarkeitsargument. Das fünfte Kapitel behandelt Einwände gegen das Teilbarkeitsargument. Das sechste Kapitel reflektiert allgemeine geistesphilosophische Konsequenzen, die sich aus Descartes' Position ergeben.
Schlüsselwörter
Philosophie des Geistes, Substanzdualismus, Eigenschaftsdualismus, Interaktionismus, Parallelismus, Okkasionalismus, Epiphänomenalismus, Descartes, Meditationes de Prima Philosophia, methodischer Zweifel, res cogitans, res extensa, Teilbarkeitsargument, Einwände, geistesphilosophische Konsequenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Descartes' Teilbarkeitsargument?
Es ist ein Beweis für den Substanzdualismus: Da der Körper (Materie) teilbar ist, der Geist (res cogitans) jedoch unteilbar, müssen sie zwei verschiedene Substanzen sein.
Was versteht Descartes unter „res cogitans“ und „res extensa“?
"Res cogitans" ist das denkende Ding (der Geist), "res extensa" ist das ausgedehnte Ding (der materielle Körper), das Raum einnimmt.
Welche Einwände gibt es gegen das Teilbarkeitsargument?
Kritiker führen an, dass auch der Geist durch psychologische Phänomene (z.B. gespaltene Persönlichkeiten) geteilt sein könnte oder dass die Unteilbarkeit kein hinreichendes Kriterium für eine eigene Substanz ist.
Was ist der methodische Zweifel bei Descartes?
Descartes zweifelt an allem, was nicht absolut gewiss ist, um ein unerschütterliches Fundament für Wissen zu finden – was ihn letztlich zum „Cogito ergo sum“ führt.
Was sind die Folgen des Substanzdualismus für die Philosophie des Geistes?
Er führt zum Leib-Seele-Problem: Wie können zwei völlig verschiedene Substanzen (Geist und Materie) miteinander interagieren?
- Arbeit zitieren
- Marcus Gießmann (Autor:in), 2010, Rekonstruktion des Teilbarkeitsarguments in Descartes´ Meditationes de Prima Philosophia, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162461