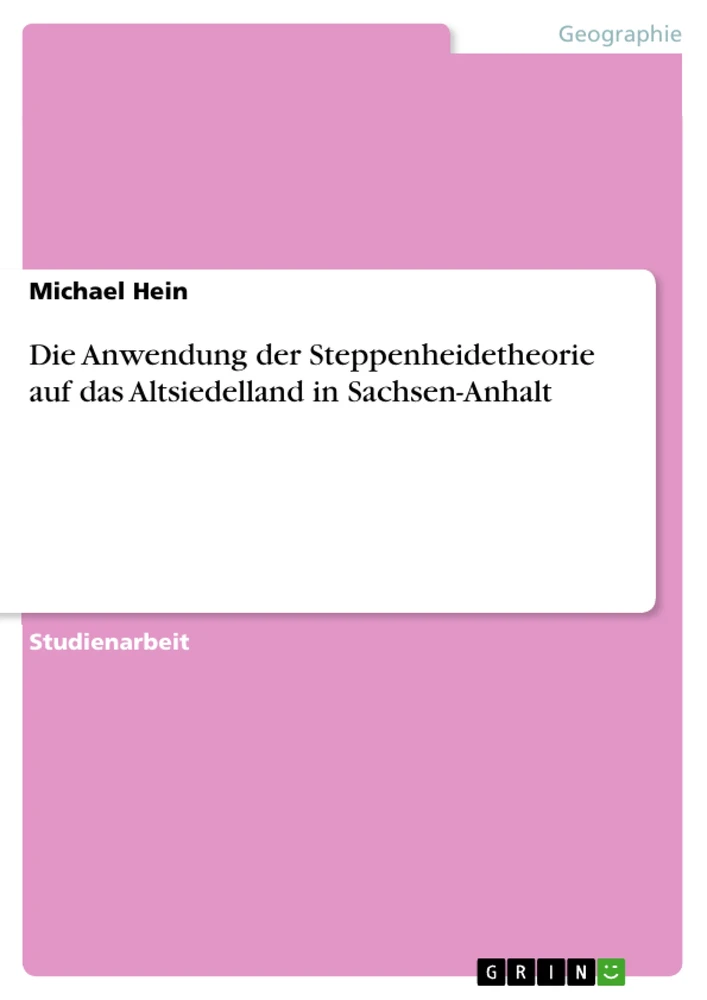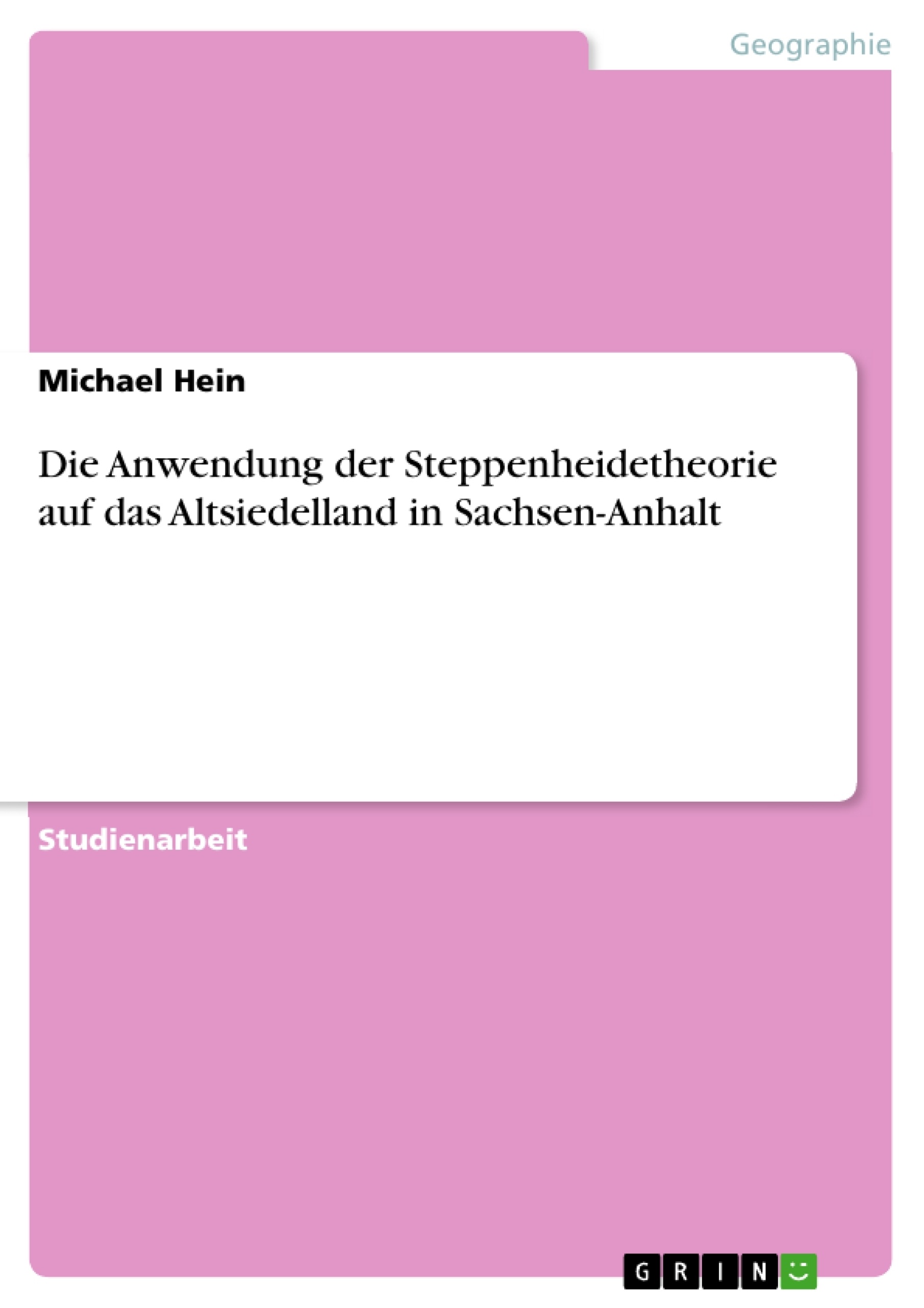Der Botaniker, Siedlungsgeograph und Landeskundler Robert Gradmann (1865 bis 1950) stellte im ausgehenden 19. Jahrhundert für den süddeutschen Raum die bis dahin präzedenzlose These auf, die ersten jungsteinzeitlichen Ackerbauern hätten bei ihrer Ankunft aus dem vorderen Orient eine allenfalls lückenhaft bewaldete Landschaft vorgefunden. Die großen Lichtungen und waldfreien Stellen hätten ihnen seiner Meinung nach die Landnahme außerordentlich erleichtert,
da nicht erst mühsame Rodungen vorgenommen werden mussten. Anlass zu diesem Postulat gab eine von Gradmann durchgeführte pflanzensoziologische Aufnahme der Schwäbischen Alb, bei der
er überraschend viele Steppenpflanzen erkannte, woraus er auf ein zeitliches Zusammenfallen von steppenähnlicher Vegetation und früher Besiedlung schloss. Gradmanns Untersuchungen wirkten
geradezu katalytisch auf ein Heer von Wissenschaftlern, die sich die Aufgabe stellten, die Standortansprüche der ersten Siedler und deren landschaftswirksames Handeln zu dechiffrieren. Urgeschichtliche Forschung bezeichnete GRADMANN (1924, S.241) schon sehr früh als ein
“verwickeltes Grenzgebiet“ zwischen Geographie, Geologie, Archäologie und Botanik, womit er ideologisch das Tor für fachübergreifende Disziplinen wie die Geoarchäologie oder die
Archäobotanik weit aufstieß. Schlägt man heute ein Lexikon der Geographie auf, so firmiert die Steppenheide-Theorie darin unter Disziplingeschichte, ihre Inhalte gelten allgemein als widerlegt
(MIEHE, S. 291). Die vorliegende Arbeit, „Die Steppenheide-Theorie und ihre Anwendung auf das Altsiedelland in Sachsen-Anhalt“ beabsichtigt, in sensu Gradmann die Wald-Offenland-Verteilung
dieses Gebietes bei Eintreffen der linienbandkeramischen Ackerbauern zu untersuchen, ohne sich dabei jedoch allzu nah an Gradmanns Methoden oder spezifische Aussagen anlehnen zu wollen.
Lediglich das grobe Gedankenkonstrukt wird adaptiert und anhand aktuellerer Forschung der Archäologie, Geobotanik, Biostratigraphie, sowie der Bodenkunde überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gradmanns „Steppenheide“-Theorie
- Einführung in das Untersuchungsgebiet
- Zum Beitrag der Archäologie
- Die Entwicklung und Lebensweise der linienbandkeramischen Kultur
- Zur Siedlungsplatzwahl der Linienbandkeramiker aus archäologischer Sicht
- Zum Beitrag der Geobotanik
- Zum Beitrag der Biostratigraphie
- Malakoanalyse
- Der Wert der Mollusken für die Landschaftsrekonstruktion
- Methodologische Grundlagen
- Malakoanalytische Befunde im Untersuchungsgebiet
- Pollenanalyse
- Methodik und Verwertbarkeit
- Zu den Besonderheiten der Palynologie in Lössgebieten
- Das Profil Zöschen – Ein palynologischer Befund im Untersuchungsgebiet
- Malakoanalyse
- Zum Beitrag der Bodenkunde
- Synopsis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der „Steppenheide-Theorie“ von Robert Gradmann und ihrer Anwendbarkeit auf das Altsiedelland in Sachsen-Anhalt. Ziel ist es, die Wald-Offenland-Verteilung in diesem Gebiet bei Eintreffen der linienbandkeramischen Ackerbauern zu untersuchen und Gradmanns Thesen anhand aktueller Forschungsergebnisse aus der Archäologie, Geobotanik, Biostratigraphie und Bodenkunde zu überprüfen.
- Die „Steppenheide-Theorie“ von Robert Gradmann und ihre Grundzüge
- Der Beitrag der Archäologie zur Rekonstruktion der Landschaft und der Lebensweise der linienbandkeramischen Kultur
- Die Bedeutung der Geobotanik, Biostratigraphie und Bodenkunde für die Untersuchung der Landschaftsgeschichte des Altsiedellandes
- Die Analyse von Malako- und Pollenanalysen als wichtige Indikatoren für die Umweltbedingungen
- Die Synthese der Ergebnisse aus den verschiedenen Disziplinen zur Klärung der Wald-Offenland-Verteilung im Altsiedelland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die „Steppenheide-Theorie“ von Robert Gradmann ein und erläutert den Hintergrund und die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 befasst sich mit den Grundzügen von Gradmanns Theorie, wobei auch auf seine wissenschaftlichen Leistungen in anderen Bereichen eingegangen wird. Kapitel 3 präsentiert die Geographie des Untersuchungsgebietes und stellt die relevanten landschaftlichen Merkmale vor. Kapitel 4 behandelt den Beitrag der Archäologie zur Rekonstruktion der Lebensweise und Siedlungsplatzwahl der linienbandkeramischen Kultur. Kapitel 5 fokussiert auf die Erkenntnisse der Geobotanik zur Landschaftsentwicklung des Altsiedellandes. Kapitel 6 erläutert die methodischen Grundlagen und Ergebnisse der Malako- und Pollenanalyse als wichtige Indikatoren für die Umweltbedingungen im Untersuchungsgebiet. Kapitel 7 beleuchtet die Erkenntnisse der Bodenkunde zur Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte des Altsiedellandes. Das abschließende Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert deren Bedeutung für die Diskussion der „Steppenheide-Theorie“ und ihre Anwendung auf das Altsiedelland in Sachsen-Anhalt.
Schlüsselwörter
Steppenheide-Theorie, Robert Gradmann, Altsiedelland, Sachsen-Anhalt, Linienbandkeramik, Archäologie, Geobotanik, Biostratigraphie, Malakoanalyse, Pollenanalyse, Bodenkunde, Landschaftsrekonstruktion, Umweltgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Steppenheide-Theorie von Robert Gradmann?
Gradmann vermutete, dass die ersten jungsteinzeitlichen Bauern bereits waldfreie, steppenähnliche Landschaften vorfanden, was die Besiedlung ohne mühsame Rodungen erleichtert habe.
Wie wird die Theorie heute wissenschaftlich bewertet?
In ihrer ursprünglichen Form gilt die Theorie heute als widerlegt. Moderne Forschungen zeigen, dass die Landschaft zur Zeit der Linienbandkeramik deutlich stärker bewaldet war, als Gradmann annahm.
Welche Rolle spielt die Linienbandkeramik in dieser Studie?
Die linienbandkeramische Kultur stellt die ersten Ackerbauern im Altsiedelland von Sachsen-Anhalt dar. Ihre Siedlungsplatzwahl ist zentral für die Untersuchung der damaligen Vegetation.
Was ist eine Malakoanalyse?
Die Malakoanalyse untersucht fossile Molluskenschalen (Schnecken und Muscheln). Da bestimmte Arten spezifische Lebensräume bevorzugen, lassen sie Rückschlüsse auf die damalige Offenland- oder Waldverteilung zu.
Wie hilft die Pollenanalyse bei der Landschaftsrekonstruktion?
Die Palynologie (Pollenanalyse) ermöglicht es, die Zusammensetzung der Vegetation über Jahrtausende hinweg zu verfolgen und so den Grad der Bewaldung zur Zeit der frühen Besiedlung zu bestimmen.
Welche Disziplinen arbeiten in der Geoarchäologie zusammen?
Die moderne Forschung verknüpft Geographie, Geologie, Archäologie, Bodenkunde und Botanik, um ein umfassendes Bild der Umweltgeschichte zu gewinnen.
- Citation du texte
- Michael Hein (Auteur), 2008, Die Anwendung der Steppenheidetheorie auf das Altsiedelland in Sachsen-Anhalt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162705