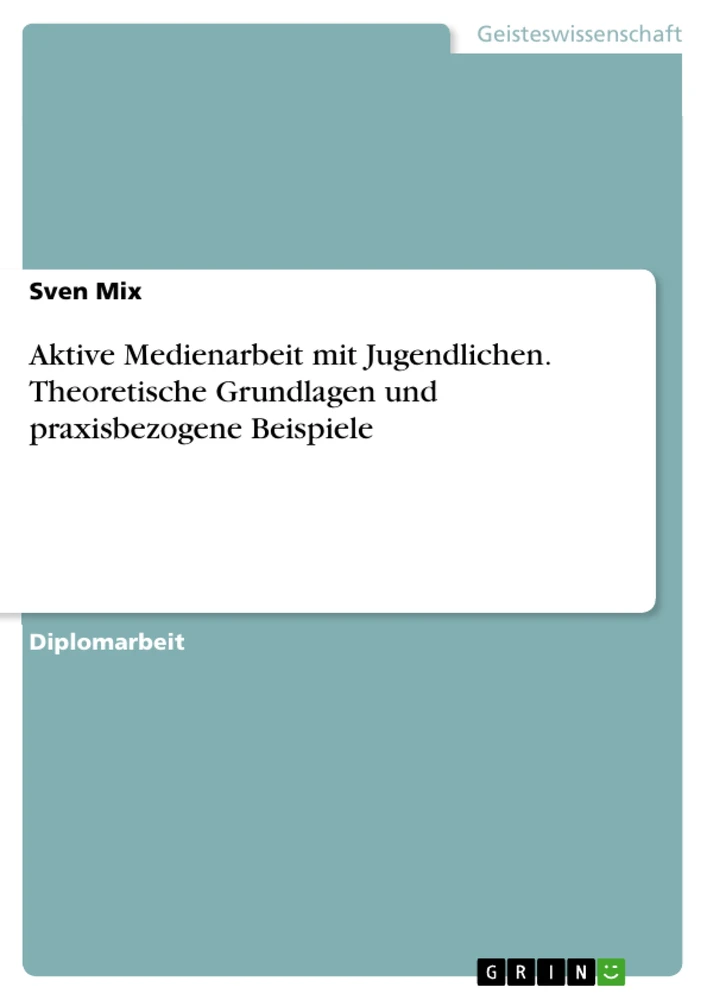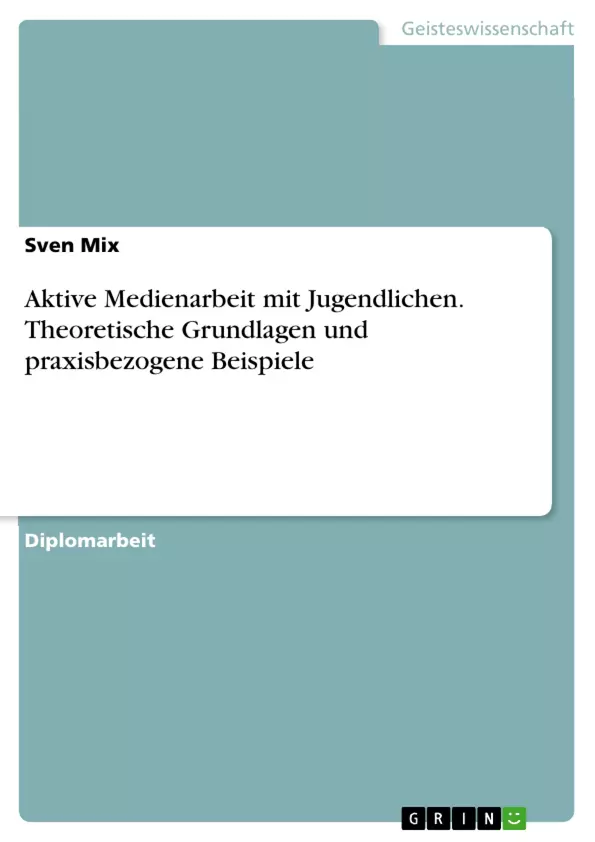In der heutigen Zeit spielen Medien eine immer größere Rolle, gerade für die Jugendlichen. Ob Musik, Computer, Internet oder Fotos machen mit dem Handy, Medien haben einen besonders großen Stellenwert in der Sozialisation und in der Lebenswelt Jugendlicher. Diese Tatsache impliziert die Chance, mit Hilfe von Medien die Jugendlichen dazu zu bewegen, sich intensiv mit Gegenstandsbereichen ihrer eigenen sozialen Realität auseinander zu setzen und dabei authentische Erfahrungen zu machen. Einen äußerst wirksamen methodischen Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik stellt dazu die aktive Medienarbeit dar.
In der folgenden Diplomarbeit sollen im ersten Teil die theoretischen Grundlagen der aktiven Medienarbeit mit Jugendlichen vermittelt werden. Hierbei wird erörtert, wie sich die aktive Medienarbeit überhaupt definiert, wie sie entstanden ist, welche Ziele sie verfolgt, welche Zielbereiche, pädagogische Grundlegung, Lernprinzipien und Inhalte sie hat, welche medienpädagogischen Positionen für sie entscheidend sind, sowie die Aufgaben einer handlungsorientierten Medienpädagogik.
Im einem zweiten Teil folgt die Auseinandersetzung mit Jugend, Gesellschaft und den Medien. Dabei wird auf Jugend als Lebensphase, die Adoleszenz, die Sichtweisen der Jugendforschung in Hinblick auf Jugend, auf Problembereiche und Problembewältigungsstrategien Jugendlicher und auf Jugendliche und die Massenmedien eingegangen.
Die folgenden Teile greifen die Praxis der aktiven Medienarbeit in der Jugendarbeit, in Schulen und nicht-institutionellen Formen auf, mit jeweils praxisbezogenen Beispielen.
Letztlich werden die erarbeiteten Aspekte in einem Fazit bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen der aktiven Medienarbeit
- Definition der aktiven Medienarbeit
- Zur Entstehung der aktiven Medienarbeit
- Die Leitziele: Authentische Erfahrung und kommunikative Kompetenz
- Zielbereiche der aktiven Medienarbeit
- Symbolischer Interaktionismus als Grundlegung der aktiven Medienarbeit
- Die Lernprinzipien der aktiven Medienarbeit
- Handelndes Lernen
- Exemplarisches Lernen
- Gruppenarbeit
- Inhalte der aktiven Medienarbeit
- Zentrale medienpädagogische Position für die aktive Medienarbeit
- Die gesellschaftskritische Position
- Die handlungsorientierte Position
- Die Aufgaben einer handlungsorientierten Medienpädagogik
- Jugend, Gesellschaft, Medien
- Jugend als Lebensphase
- Die Adoleszenz
- Die Betrachtung von Jugend in der Jugendforschung
- Die Probleme in der Lebenswelt von Jugendlichen
- Problembereiche in der Lebenswelt Jugendlicher
- Problembereich Schule und Arbeit
- Problembereich Ökologie und Frieden
- Problembereich Politik und politische Partizipation
- Problembereich Zukunft
- Problembewältigungsstrategien Jugendlicher
- Die Problembewältigungsstrategien des >Anpassen<
- Die Problembewältigungsstrategien des >Verändern<
- Die Problembewältigungsstrategien des >Sich zurückziehen<
- Konsequenzen für die aktive Medienarbeit
- Jugendliche und die Massenmedien
- Zur Mediennutzung Jugendlicher in ihrer Freizeit
- Die Funktionen von Massenmedien
- Konsequenzen für die aktive Medienarbeit
- Jugendmedienschutz
- Problembereiche in der Lebenswelt Jugendlicher
- Aktive Medienarbeit in der Jugendarbeit
- Definition der Kinder- und Jugendarbeit
- Daten aus der KJH-Statistik zur Kinder- und Jugendarbeit
- Die Kriterien aktiver Medienarbeit in der Jugendarbeit
- Die programmatischen Ziele emanzipatorischer Jugendarbeit
- Aktive Medienarbeit mit Multimedia in der Jugendarbeit
- Definition für die aktive Medienarbeit mit Computer und Internet
- Ziele und Kriterien für die aktive Medienarbeit mit Multimedia
- Die Voraussetzungen für Multimediaprojekte in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Multimediaprojekte in der Jugendarbeit
- Aller Anfang ist leicht: Web-Design für Einsteiger
- Der Fotoaktionstag - Digitale Fotos und Bilder verfremden
- Mp3 und Musikbearbeitung in der Jugendarbeit
- Online-Radio
- Video im Internet - Eine Fiktion!?
- NETGrandPrix - Ein Internet-Musikcontest
- Aktive Medienarbeit in der Schule
- Die Situation aktiver Medienarbeit in der Schule
- Beispiele von aktiver Medienarbeit an Schulen
- Projekt: Gründung einer Schülerzeitungsredaktion und Erstellung einer Schülerzeitung
- Projekt: >Zeitung in der Schule<
- Praxisbezogene Beispiele für den Beitrag einzelner Fächer zur aktiven Medienarbeit
- Beitrag des Fachs Deutsch zur aktiven Medienarbeit
- Beitrag des Fachs Kunsterziehung zur aktiven Medienarbeit
- Beitrag des Fachs Musik zur aktiven Medienarbeit
- Aktive Medienarbeit in nicht-institutionellen Formen
- Die Jugendpresse Deutschland
- Zur Entstehung der Jugendpresse Deutschland
- Das Leitbild der Jugendpresse Deutschland
- Die Projektgruppen der Jugendpresse Deutschland
- Medienwettbewerbe
- Die Jugendfilmszene
- Die Jugendfilmszene in Bayern
- Ein bundesweites Forum für die Jugendfilmszene: Das Bundesfestival Video
- Die Jugendpresse Deutschland
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Sie zielt darauf ab, theoretische Grundlagen zu vermitteln und praxisbezogene Beispiele zu liefern, um die Bedeutung und Relevanz dieses pädagogischen Ansatzes aufzuzeigen.
- Theoretische Fundierung aktiver Medienarbeit
- Jugendliche in ihrer Lebenswelt: Probleme und Bewältigungsstrategien
- Der Einfluss von Massenmedien auf Jugendliche
- Aktive Medienarbeit in verschiedenen Handlungsfeldern (Jugendarbeit, Schule, nicht-institutionelle Formen)
- Praxisbezogene Beispiele für medienpädagogische Projekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Bedeutung von Medien in der heutigen Zeit dar und hebt die aktive Medienarbeit als effektiven Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik hervor.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der aktiven Medienarbeit. Es definiert den Ansatz, beschreibt seine Entstehung und untersucht die Ziele, Lernprinzipien und Inhalte sowie zentrale medienpädagogische Positionen.
- Kapitel 3: Das Kapitel beleuchtet die Lebenswelt von Jugendlichen in Bezug auf Gesellschaft und Medien. Es betrachtet Jugend als Lebensphase, die Adoleszenz, die Jugendforschung und die Problemfelder in der Lebenswelt von Jugendlichen. Des Weiteren werden Problembewältigungsstrategien von Jugendlichen analysiert und der Einfluss von Massenmedien auf sie untersucht.
- Kapitel 4: Hier werden die Möglichkeiten und Herausforderungen der aktiven Medienarbeit in der Jugendarbeit dargestellt. Es wird auf die Definition der Kinder- und Jugendarbeit, Daten zur Situation, Kriterien der aktiven Medienarbeit und die programmatischen Ziele emanzipatorischer Jugendarbeit eingegangen.
- Kapitel 5: Das Kapitel widmet sich der aktiven Medienarbeit in der Schule. Es analysiert die aktuelle Situation, stellt praxisbezogene Beispiele vor und zeigt den Beitrag einzelner Fächer zur aktiven Medienarbeit auf.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der aktiven Medienarbeit in nicht-institutionellen Formen, insbesondere der Jugendpresse Deutschland und der Jugendfilmszene.
Schlüsselwörter
Aktive Medienarbeit, Medienpädagogik, Jugend, Gesellschaft, Massenmedien, Jugendmedienschutz, Jugendarbeit, Schule, Jugendpresse Deutschland, Jugendfilmszene, Kommunikative Kompetenz, Authentische Erfahrung, Emanzipation, Handlungskompetenz, Problembewältigung, Mediennutzung, Multimediaprojekte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist aktive Medienarbeit?
Ein handlungsorientierter Ansatz der Medienpädagogik, der Jugendliche dazu bewegt, durch eigene Medienproduktion authentische Erfahrungen zu machen.
Welche Lernprinzipien liegen der aktiven Medienarbeit zugrunde?
Zentrale Prinzipien sind handelndes Lernen, exemplarisches Lernen und die Arbeit in Gruppen.
In welchen Bereichen wird aktive Medienarbeit eingesetzt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen der Jugendarbeit, dem schulischen Kontext und nicht-institutionellen Formen wie der Jugendpresse.
Welche Problembewältigungsstrategien nutzen Jugendliche?
Jugendliche nutzen Strategien wie Anpassen, Verändern oder sich Zurückziehen, auf die die Medienarbeit pädagogisch reagieren kann.
Nennen Sie Beispiele für medienpädagogische Projekte.
Beispiele sind Web-Design für Einsteiger, Fotoaktionstage, Online-Radio, Video-Projekte und die Erstellung von Schülerzeitungen.
Was ist das Ziel emanzipatorischer Jugendarbeit?
Sie zielt auf die Förderung kommunikativer Kompetenz, authentischer Erfahrung und die Befähigung zur politischen und sozialen Partizipation ab.
- Quote paper
- Sven Mix (Author), 2010, Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theoretische Grundlagen und praxisbezogene Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162947