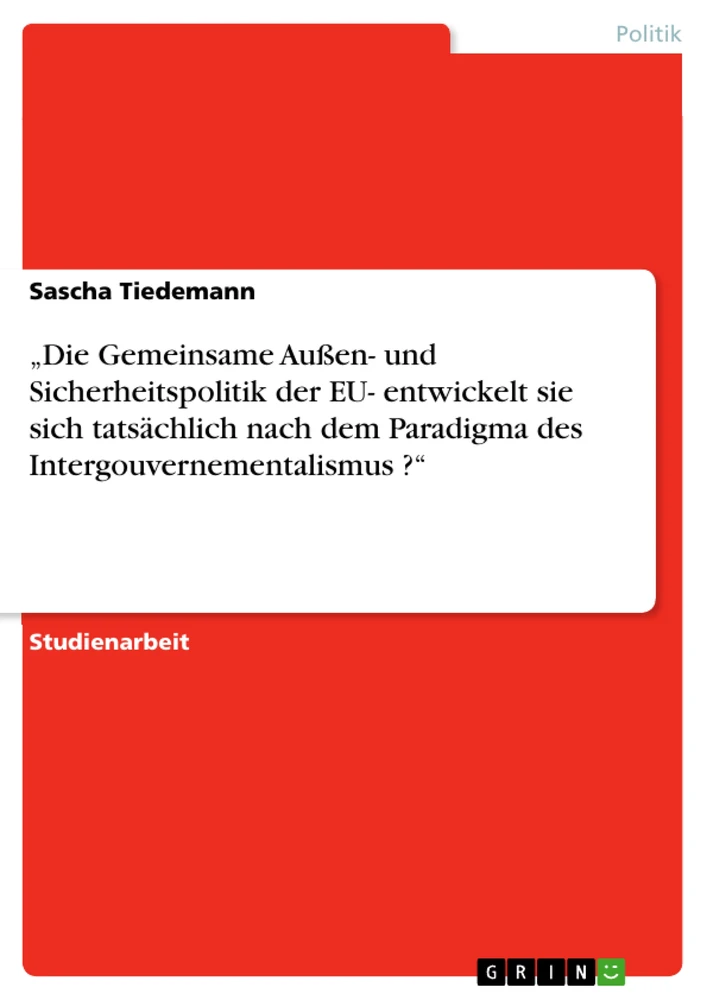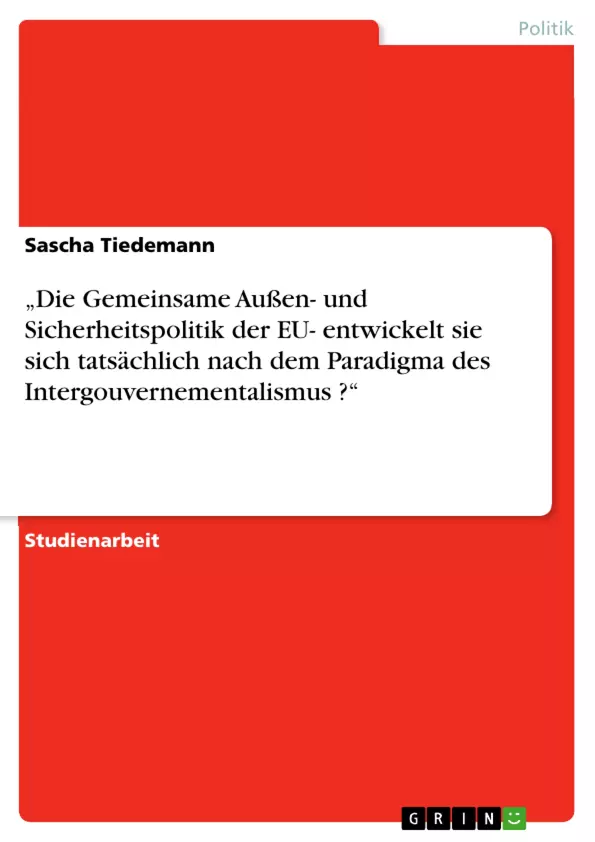Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat sich in Europa ein bis heute andauernder dynamischer Integrationsprozess entwickelt.
Dies war möglich, weil schon früh die Idee eines europäischen Staatenbundes entstand mit der Absicht, eines Tages die "Vereinigten Staaten von Europa" zu gründen.
Nach einer Phase loser Kooperation zwischen den einzelnen Staaten Europas, bildete sich im Laufe der Dekaden ein festes, gemeinsames Institutionengefüge, welches wir heute in Form der Europäischen Union (EU) erkennen können.
Bereits seit dem Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992 existiert nun die "Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik" (GASP) der EU innerhalb dieses Institutionengefüges.
Parallel zur Entwicklung der EU entstanden unter anderem schon seit den Anfangsjahren sogenannte Integrationstheorien, welche die Integrationsfähigkeit von verschiedenen Bereichen darstellen und bewerten sollten.
Eine dieser Theorien ist der Intergouvernementalismus des Politikwissenschaftlers Stanley Hoffmann.
Dieser geht in der Theorie in seiner Kernthese davon aus, dass die Nationalstaaten in den für sie relevanten Bereichen die Souveränität aufrecht erhalten, bzw. diese nicht an eine supranationale Ebene abgeben.
In Anbetracht der Tatsache, dass diese Theorie aus den 1960er Jahren stammt ist es durchaus interessant zu betrachten, inwiefern diese noch Relevanz für den jetzigen Integrationsverlauf der EU und speziell für die GASP hat.
Diese Frage und Beantwortung ist Kern der vorliegenden Arbeit.
Hierzu wird zunächst die GASP der EU in ihrer Gänze von den ersten Kooperationsbestrebungen bis in die heutige Phase der Integration nach dem Vertrag von Lissabon dargestellt.
Dem folgt eine Darstellung der Theorie des Intergouvernementalismus von Stanley Hoffmann.
Eine Analyse der GASP unter Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen des Intergouvernementalismus führt zur Beantwortung der Fragestellung.
Abschließend wird ein Ausblick für künftige Entwicklungen der GASP gegeben.
Ein wirklich interessantes Thema, welches im Rahmen eines Seminars (hier "European Governance") entstanden ist.
Die Arbeit bildet allerdings nicht nur die Thematik des Titels ab. Sie kann ebenfalls in Teilen für andere Themen, bzw. Arbeiten verwendet werden. Die GASP sowie der Intergouvernementalismus sind umfangreich beschrieben.
Mehrere Seiten Literaturverzeichnis erleichtern die weitere Recherche zur Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG.
- 2. DIE GEMEINSAME AUBEN- UND SICHERHEITSPOLITIK (GASP) DER EUROPÄISCHEN UNION ....
- 2.1. DIE GASP HEUTE.
- 3. DER INTERGOUVERNEMENTALISMUS NACH STANLEY HOFFMANN.
- 4. ANALYSE DER GASP UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG
- 5. AUSBLICK- WIE KANN DIE ZUKUNFT DER GASP AUSSEHEN?.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union unter dem Blickwinkel des Intergouvernementalismus. Sie fragt, ob sich die GASP tatsächlich nach dem Paradigma des Intergouvernementalismus entwickelt, und analysiert die Entwicklung und die aktuelle Situation der GASP vor dem Hintergrund der Intergouvernementalismus-Theorie von Stanley Hoffmann.
- Die Entwicklung der GASP von den frühen Ideen bis zur heutigen Form
- Die Grundprinzipien des Intergouvernementalismus nach Stanley Hoffmann
- Die Anwendbarkeit des Intergouvernementalismus auf die GASP in der heutigen Zeit
- Mögliche zukünftige Entwicklungen der GASP in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet den europäischen Integrationsprozess und die Entwicklung der GASP als wichtigen Bestandteil der Europäischen Union.
Kapitel 2 beschreibt die Geschichte der GASP von den frühen Ideen und ersten Schritten der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit bis hin zur heutigen Form. Es zeigt auf, wie die GASP aus einzelnen Intentionen von Nationalstaaten und institutionellen Ausarbeitungen zu einer konstitutionellen Verankerung und letztendlich zu einer intergouvernementalen Säule der EU geworden ist.
Kapitel 3 behandelt die Theorie des Intergouvernementalismus nach Stanley Hoffmann. Es erläutert die Grundfesten der Theorie und zeigt auf, wie die Theorie die Rolle der Nationalstaaten in der Weltpolitik und in der europäischen Integration beschreibt.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Europäischen Union, der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), dem Intergouvernementalismus, Stanley Hoffmann, europäischer Integration, Nationalstaaten, Sicherheitspolitik, politische Strategien, institutionelle Entwicklung, politisches System.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt der Intergouvernementalismus nach Stanley Hoffmann?
Die Theorie besagt, dass Nationalstaaten in zentralen Bereichen ihre Souveränität behalten und diese nicht an supranationale Institutionen wie die EU abgeben.
Wie hat sich die GASP seit dem Vertrag von Maastricht entwickelt?
Die Arbeit zeigt den Weg von frühen Kooperationsbestrebungen bis hin zur konstitutionellen Verankerung im Vertrag von Lissabon auf.
Ist die GASP eine supranationale oder intergouvernementale Säule?
Die Analyse untersucht, ob die GASP trotz fortschreitender Integration weiterhin primär durch die Zusammenarbeit souveräner Nationalstaaten (Intergouvernementalismus) geprägt ist.
Welche Rolle spielen Nationalstaaten in der EU-Außenpolitik?
Sie bleiben die Hauptakteure, die ihre nationalen Interessen in den Entscheidungsprozess der GASP einbringen und die strategische Ausrichtung steuern.
Welchen Ausblick gibt die Arbeit für die Zukunft der GASP?
Die Arbeit diskutiert mögliche Entwicklungsszenarien für die Außen- und Sicherheitspolitik vor dem Hintergrund aktueller globaler Herausforderungen.
- Citar trabajo
- Sascha Tiedemann (Autor), 2010, „Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU- entwickelt sie sich tatsächlich nach dem Paradigma des Intergouvernementalismus ?“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163007