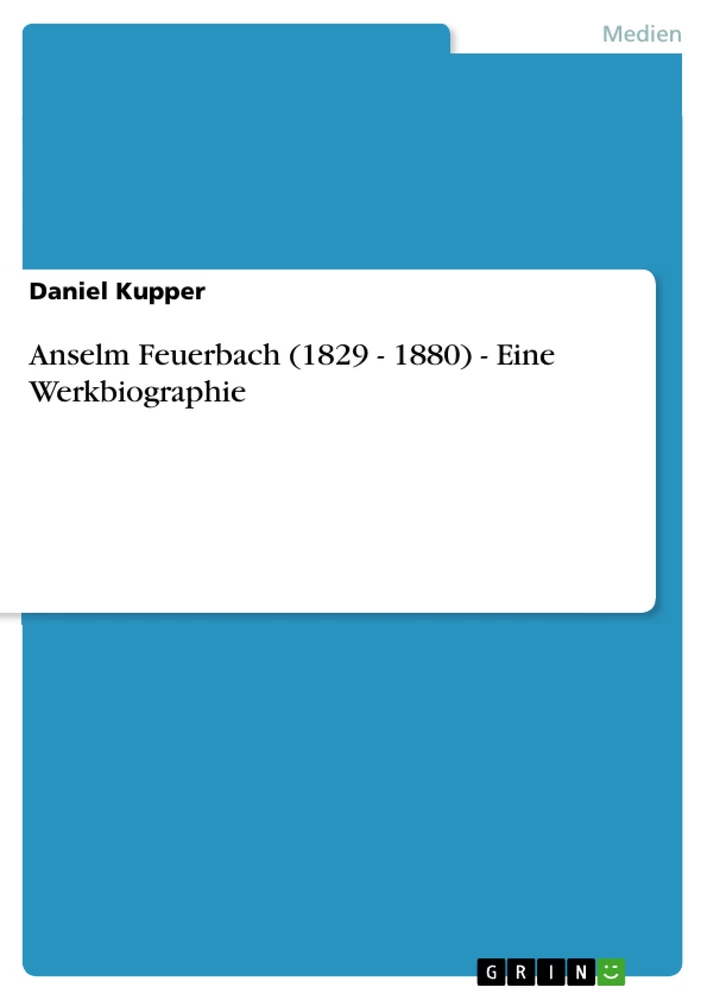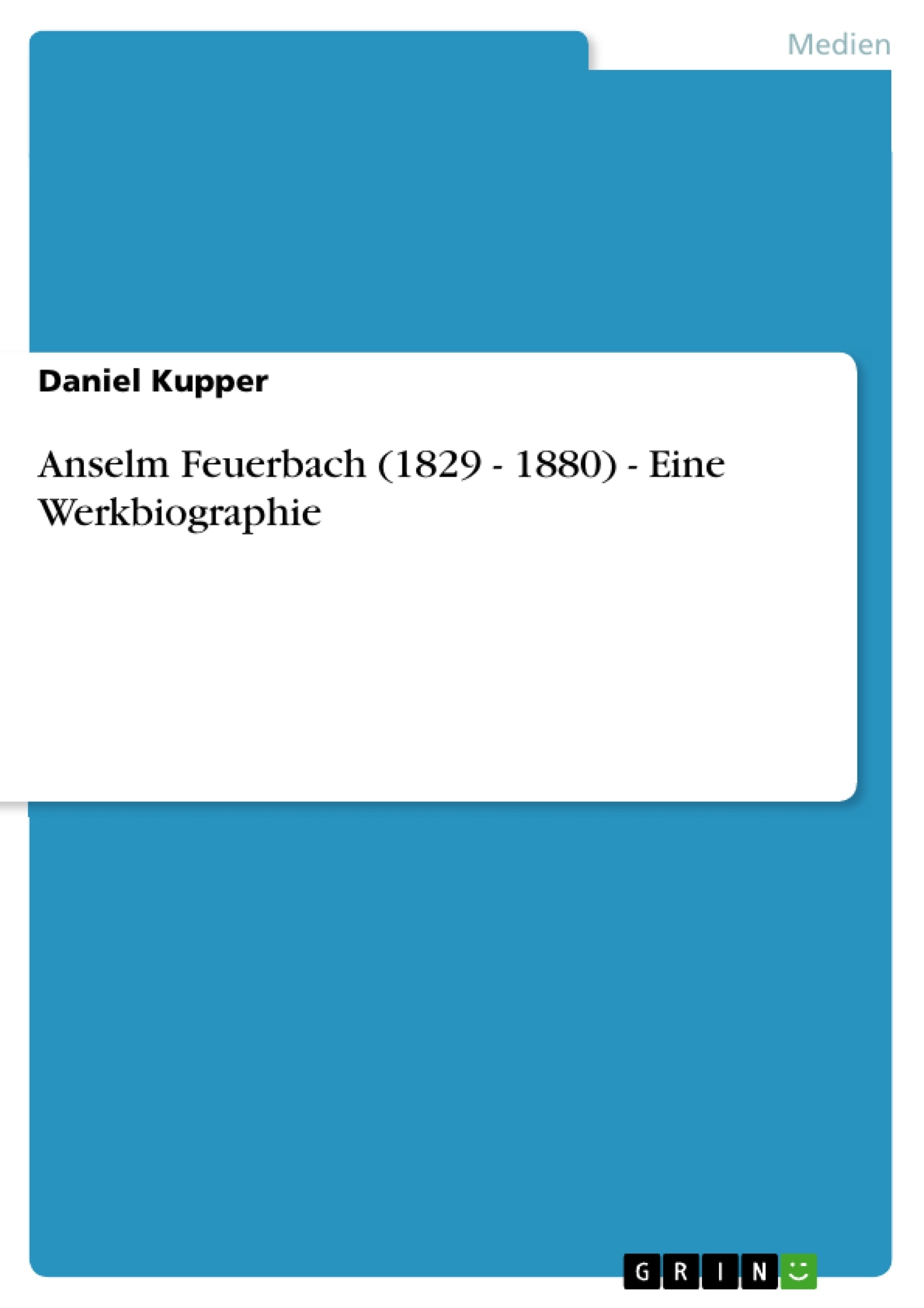Anselm Feuerbach (1829 - 1880) gehört zu den wichtigsten deutschen Malern des 19. Jahrhunderts. Zwischen 1900 und 1929 wurde er insbesondere durch die Rezeption des von seiner Stiefmutter Henriette Feuerbach herausgegebenen "Vermächtnisses" sowie einer zweibändigen Ausgabe der "Briefe an seine Mutter" zu einer Kultfigur. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er zwar in jedem einschlägigen kunstgeschichtlichen Überblick gegenwärtig, seine Bedeutung jedoch wurde fast vollständig auf die eines rückwärts gewandten Klassizisten reduziert, der als eklektizistischer Außenseiter gescheitert und an seiner Zeit verzweifelt war. Erst ab Mitte der 1970er Jahre begann eine Revision dieser Auffassung, die bis zum heutigen Tag anhält und bei der mehr und mehr die Modernität seiner Bildgestaltung ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses gerückt wird.
Die vorliegende Biographie ist die vollständig überarbeitete, revidierte und erweiterte Fassung der Rowohlt-Monographie für Feuerbach (rm 499) von 1993.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung
- Kindheit und Jugend (1829-1845)
- Ausbildung in Düsseldorf (1845-1847)
- München, Antwerpen, Paris (1848-1854)
- Karlsruhe (1854-1855)
- Venedig, Florenz (1855-1856)
- Rom (1856-1865)
- Die Seele Iphigenies als Spiegel künstlerischer Sehnsucht
- Rom (1865-1872)
- Die Idee der dialektischen Bilderpaare
- Wien (1873-1876)
- ,,Phänomenologie der Fehler“:,Fehlerhaftigkeit als Zeichen der Modernität
- Die letzten Lebensjahre
- Nachruhm und Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Werkbiographie von Anselm Feuerbach zielt darauf ab, sein Leben und Werk umfassend darzustellen und seine Rezeptionsgeschichte zu beleuchten. Sie untersucht die Einordnung Feuerbachs in die deutsche Kunstgeschichte und die widersprüchlichen Bewertungen seines Schaffens im Kontext der Moderne. Die Biographie geht über eine reine Chronologie hinaus und analysiert die Entwicklung seines künstlerischen Stils sowie seine Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst.
- Feuerbachs künstlerische Entwicklung und Stil
- Die Rezeption seines Werkes in der Kunstgeschichte
- Die Einordnung Feuerbachs in den Kontext der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts
- Die Auseinandersetzung mit der Moderne und die Kritik an Feuerbachs Werk
- Feuerbachs Leben und seine Einflüsse
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung: Diese Vorbemerkung erläutert die Überarbeitung und Erweiterung einer früheren Monographie. Es wird auf die Entscheidung verzichtet, Abbildungen einzubinden, da die Werke Feuerbachs größtenteils online verfügbar sind und viele Leser bereits über entsprechende Publikationen verfügen. Wichtige Werke werden dennoch mit bibliographischen Hinweisen genannt, um deren Auffindbarkeit zu erleichtern.
Einleitung: Die Einleitung stellt Anselm Feuerbachs Werk als ein Problem der deutschen Kunstgeschichte dar und vergleicht die Rezeption seines Werkes mit dem „Fall Böcklin“. Sie betont die einseitige Sichtweise der Vertreter der Moderne um 1900, die die Leistung der Deutschrömer überschattet und zu einer verzerrten Bewertung Feuerbachs geführt hat. Es wird auf die kontroverse Rezeptionsgeschichte Feuerbachs hingewiesen, die zwischen der Legende vom verkannten Genie und der Betonung seines Scheiterns schwankt. Die Einleitung thematisiert das historische Erklärungsvakuum, das sich aus der unklaren Bewertung des Werks ergibt.
Kindheit und Jugend (1829-1845): Dieses Kapitel behandelt Feuerbachs frühe Jahre, seine Familie und die ersten künstlerischen Einflüsse. Es legt den Grundstein für das Verständnis seiner späteren Entwicklung und seiner künstlerischen Orientierung.
Ausbildung in Düsseldorf (1845-1847): Dieses Kapitel befasst sich mit Feuerbachs Ausbildungszeit in Düsseldorf, wo er seine künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickelte und erste Kontakte zur Kunstszene knüpfte. Es beschreibt die Einflüsse und die künstlerischen Entwicklungsschritte in dieser Phase.
München, Antwerpen, Paris (1848-1854): Dieser Abschnitt beschreibt Feuerbachs Reisen und Aufenthalte in München, Antwerpen und Paris, wobei er verschiedene künstlerische Einflüsse aufnahm und seinen Stil weiterentwickelte. Die Analyse konzentriert sich auf die künstlerischen und persönlichen Erfahrungen, die diese Zeit prägten.
Karlsruhe (1854-1855) und Venedig, Florenz (1855-1856): Diese Kapitel befassen sich mit Feuerbachs Zeit in Karlsruhe sowie seinen Reisen nach Venedig und Florenz. Sie beleuchten den Einfluss der jeweiligen künstlerischen und kulturellen Umgebung auf seine Werke und seine weitere künstlerische Entwicklung.
Rom (1856-1865): Feuerbachs lange Zeit in Rom war eine entscheidende Phase für seine künstlerische Entwicklung. Das Kapitel analysiert seinen künstlerischen Stil in dieser Zeit sowie seine künstlerischen Auseinandersetzungen und Inspirationen.
Die Seele Iphigenies als Spiegel künstlerischer Sehnsucht: Dieses Kapitel untersucht ein bestimmtes Werk Feuerbachs und analysiert dessen Bedeutung im Kontext seiner künstlerischen Gesamtentwicklung und den darin zum Ausdruck kommenden Sehnsüchten.
Rom (1865-1872) und Die Idee der dialektischen Bilderpaare: Dieser Abschnitt setzt die Darstellung von Feuerbachs Zeit in Rom fort und analysiert die Entwicklung seiner „Idee der dialektischen Bilderpaare“ – eine wichtige Konzeption in seinem künstlerischen Denken.
Wien (1873-1876): Dieses Kapitel beschreibt Feuerbachs Aufenthalt in Wien, seine künstlerischen Aktivitäten und die Kontakte zu der Wiener Kunstszene. Die Analyse fokussiert sich auf die Besonderheiten seines Schaffens während dieser Zeit und seine Einflüsse.
,,Phänomenologie der Fehler“:,Fehlerhaftigkeit als Zeichen der Modernität: Dieses Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt von Feuerbachs Werk und seiner künstlerischen Konzeption und setzt es in Beziehung zu den modernen Kunstströmungen.
Die letzten Lebensjahre: Dieses Kapitel beschreibt die letzten Jahre von Feuerbachs Leben, seine künstlerischen Arbeiten und den Zustand seiner Gesundheit. Es analysiert den Einfluss seiner letzten Lebensphase auf sein Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Anselm Feuerbach, deutsche Kunstgeschichte, 19. Jahrhundert, Deutschrömer, Moderne, Kunstkritik, Rezeption, Stilentwicklung, dialektische Bilderpaare, künstlerisches Scheitern, Klassizismus, Romantik.
Häufig gestellte Fragen zur Werkbiographie von Anselm Feuerbach
Was ist der Inhalt dieser Werkbiographie von Anselm Feuerbach?
Diese Werkbiographie bietet einen umfassenden Überblick über das Leben und Werk des Malers Anselm Feuerbach. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Feuerbachs künstlerischer Entwicklung, seiner Einordnung in die deutsche Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und der Analyse seiner widersprüchlichen Rezeption, insbesondere im Kontext der Moderne.
Welche Themen werden in der Biographie behandelt?
Die Biographie behandelt Feuerbachs Kindheit und Jugend, seine Ausbildung in Düsseldorf, seine Reisen nach München, Antwerpen, Paris, Karlsruhe, Venedig, Florenz und Rom. Sie analysiert seine künstlerische Stilentwicklung, seine Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst und die Entwicklung seiner „Idee der dialektischen Bilderpaare“. Wichtige Aspekte sind die Rezeption seines Werkes in der Kunstgeschichte, die Kritik an seinem Schaffen und die Einordnung in den Kontext des Klassizismus und der Romantik. Einzelne Kapitel widmen sich der Analyse spezifischer Werke und Phasen seines Lebens, wie beispielsweise seiner Zeit in Wien und seinen letzten Lebensjahren.
Welche Kapitel umfasst die Biographie?
Die Biographie gliedert sich in folgende Kapitel: Vorbemerkung, Einleitung, Kindheit und Jugend (1829-1845), Ausbildung in Düsseldorf (1845-1847), München, Antwerpen, Paris (1848-1854), Karlsruhe (1854-1855), Venedig, Florenz (1855-1856), Rom (1856-1865), Die Seele Iphigenies als Spiegel künstlerischer Sehnsucht, Rom (1865-1872), Die Idee der dialektischen Bilderpaare, Wien (1873-1876), „Phänomenologie der Fehler“: Fehlerhaftigkeit als Zeichen der Modernität, Die letzten Lebensjahre, Nachruhm und Rezeption.
Wie wird Feuerbachs Werk in der Biographie eingeordnet?
Die Biographie untersucht Feuerbachs Werk im Kontext der deutschen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und analysiert seine kontroverse Rezeption. Sie beleuchtet die einseitige Sichtweise der Moderne um 1900, die zu einer verzerrten Bewertung seines Schaffens geführt hat. Feuerbachs Werk wird nicht nur chronologisch dargestellt, sondern auch im Hinblick auf seine Stilentwicklung, seine künstlerischen Einflüsse und seine Auseinandersetzung mit dem Klassizismus und der Romantik analysiert.
Warum enthält die Biographie keine Abbildungen?
In der Vorbemerkung wird erläutert, dass auf die Einbindung von Abbildungen verzichtet wurde, da Feuerbachs Werke größtenteils online verfügbar sind und viele Leser bereits über entsprechende Publikationen verfügen. Wichtige Werke werden jedoch mit bibliographischen Hinweisen genannt, um deren Auffindbarkeit zu erleichtern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Biographie?
Schlüsselwörter, die die Thematik der Biographie beschreiben, sind: Anselm Feuerbach, deutsche Kunstgeschichte, 19. Jahrhundert, Deutschrömer, Moderne, Kunstkritik, Rezeption, Stilentwicklung, dialektische Bilderpaare, künstlerisches Scheitern, Klassizismus, Romantik.
Für wen ist diese Biographie gedacht?
Diese Biographie richtet sich an alle, die sich für Anselm Feuerbach, die deutsche Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und die Kunstkritik interessieren. Sie ist besonders geeignet für Studierende, Wissenschaftler und Kunstinteressierte, die sich auf akademischer Ebene mit Feuerbachs Leben und Werk auseinandersetzen möchten.
- Citar trabajo
- Dr. Daniel Kupper (Autor), 2011, Anselm Feuerbach (1829 - 1880) - Eine Werkbiographie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163040