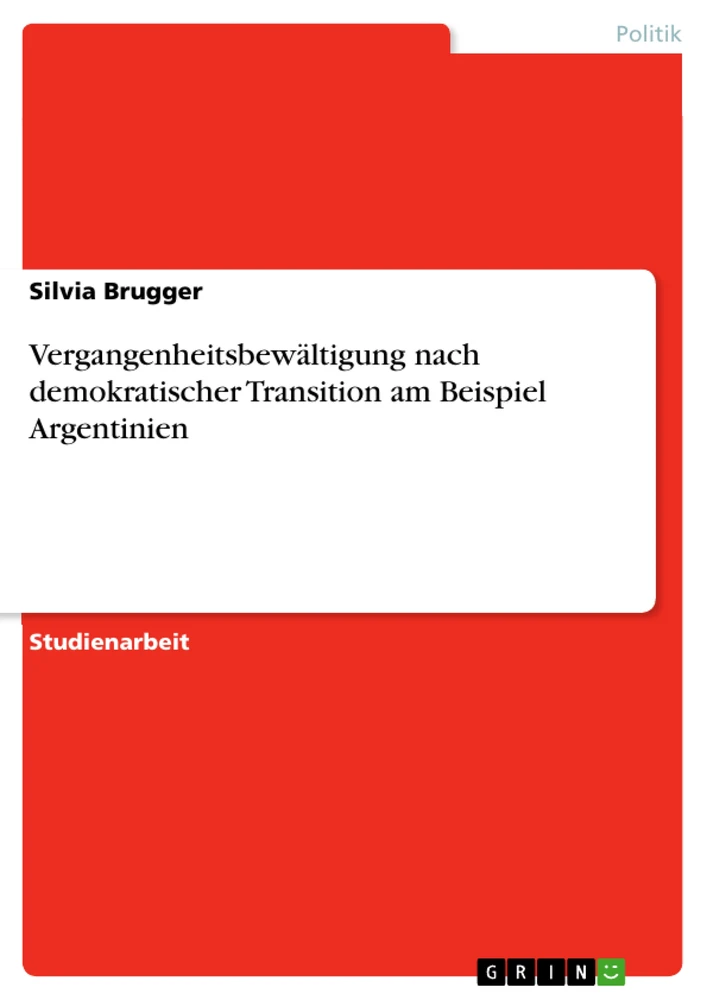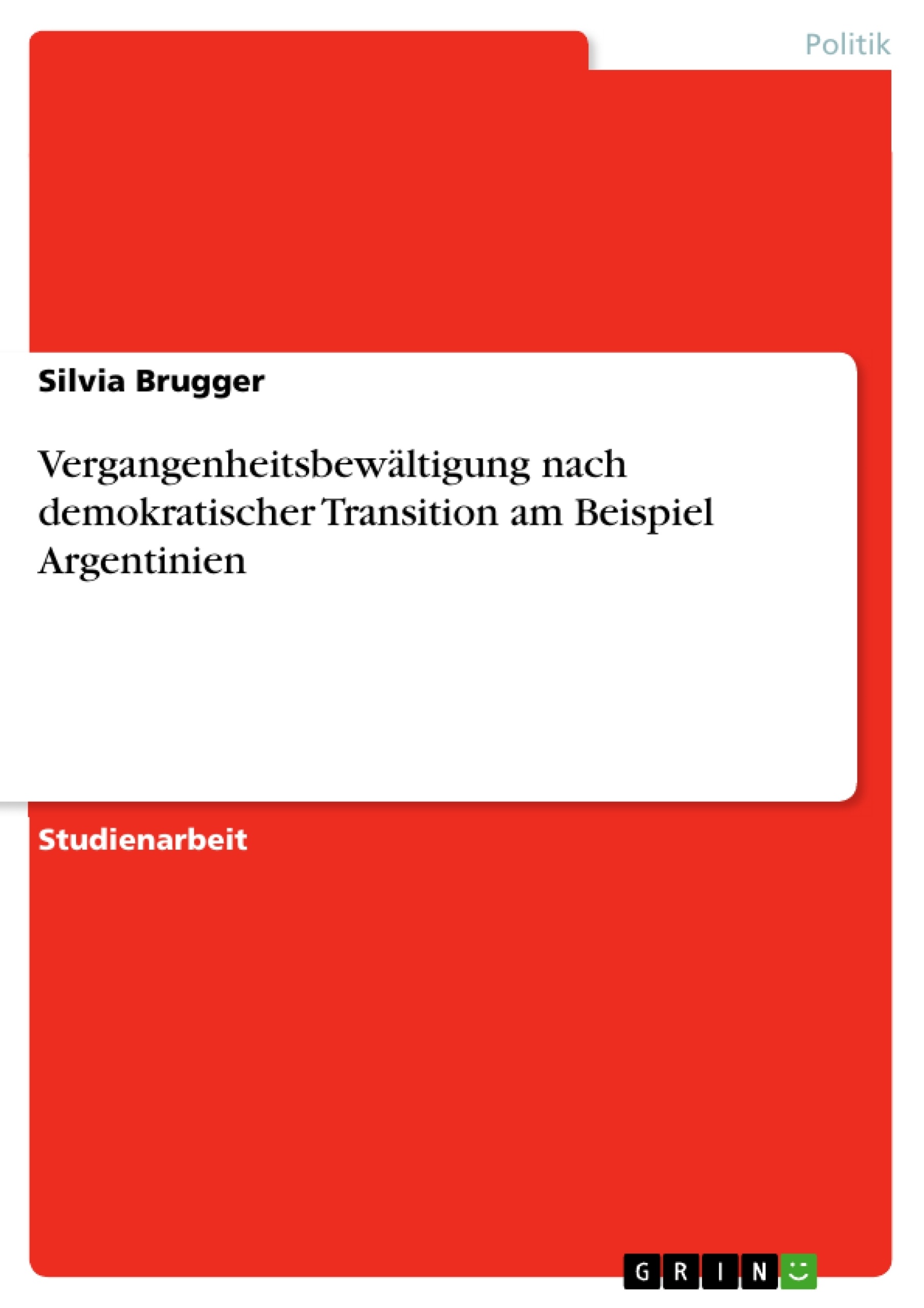Nach siebzehn Jahren Militärdiktatur mit der traurigen Bilanz von geschätzten 30.000 Verschwundenen, 1.200 Hingerichteten, 500 zwangsentführten Kindern, etwa 500.000 Exilanten und 30.000 politischen Gefangenen kehrte Argentinien im Jahre 1983 zur demokratischen Staatsform zurück. Mit welchen Herausforderungen sich die erste Zivilregierung nach der Transition konfrontiert sah, lässt sich aus diesen Zahlen leicht ersehen. Forderungen nach Wahrheit und Gerechtigkeit musste ebenso entsprochen werden wie einer drohenden Destabilisierung der jungen demokratischen Institutionen durch rebellierende Militärs. Der politische Handlungsrahmen erweist sich in diesem Zusammenhang als hilfreicher Erklärungsfaktor für den Umgang mit der Vergangenheit.
Im Kontext von Arten der Vergangenheitsbewältigung nach demokratischer Transition im Allgemeinen soll in dieser Arbeit der Frage nach dem Umgang mit den unter Militärherrschaft begangenen Menschenrechtsverbrechen in Argentinien auf den Grund gegangen werden. Aus Platzgründen wird nur die erste postdiktatorale Regierung unter dem Präsidenten Raúl Alfonsín untersucht, welche sich nach einem vielversprechenden Beginn unter dem Credo „Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen“ bald dem Säbelrasseln der Streitkräfte unterordnete und die juristische Aufarbeitung immer weiter einschränkte.
Zu diesem Zwecke soll nach einem allgemeinen Überblick über den Zusammenhang von Vergangenheitsaufarbeitung und demokratischer Konsolidierung das Konzept des Umgangs mit der Vergangenheit im Hinblick auf eine nationale Versöhnung näher erläutert sowie unterschiedliche Wege der Vergangenheitsbewältigung aufgezeigt werden. Vor diesem Hintergrund sollen daran anschließend, anhand des Fallbeispiels Argentinien, nach einem kurzen historischen Abriss die Ausgangsbedingungen für die erste demokratische Regierung untersucht werden, um schließlich die Vergangenheitspolitik Alfonsíns einer kritischen Analyse zu unterwerfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Vergangenheitsbewältigung nach demokratischer Transition
- 1. Demokratie und Erinnerung: Vergangenheitspolitik in jungen Demokratien
- 2. Vergangenheitsbewältigung und nationale Versöhnung
- 3. Wahrheit oder Strafe: Wege der Vergangenheitsbewältigung
- 3.1. Strafverfahren: Rechtliche Aufarbeitung
- 3.2. Wahrheitskommissionen: Politisch-historische Aufarbeitung
- II. Fallbeispiel Argentinien
- 1. Militärdiktatur in Argentinien 1976-1983
- 2. Ausgangsbedingungen für die Vergangenheitsbewältigung
- 2.1. Sozio-kulturelle Faktoren in Argentinien
- 2.2. Besonderheiten der argentinischen Menschenrechtsbewegung
- 2.3. Demokratische Transition
- 3. Wahrheit und partielle Gerechtigkeit: Vergangenheitsbewältigung der ersten demokratischen Regierung
- 3.1. Die Wahrheitskommission CONADEP
- 3.1.1. Zusammensetzung und Mandat
- 3.1.2. Arbeitsweise und Ergebnisse
- 3.2. Strafverfolgung vor nationalen Gerichten
- 3.2.1. Prozesse gegen Hauptverantwortliche
- 3.2.2. Schlusspunktgesetz (Ley de Punto Final)
- 3.2.3. Befehlsnotstandsgesetz (Ley de Obediencia Debida)
- 3.3. Bewertung der Vergangenheitspolitik unter Alfonsín
- 3.1. Die Wahrheitskommission CONADEP
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Vergangenheitsbewältigung nach demokratischer Transition am Beispiel Argentiniens. Sie analysiert den Umgang mit den Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur (1976-1983) und beleuchtet die Herausforderungen, die sich für die erste demokratische Regierung unter Raúl Alfonsín stellten. Die Arbeit geht dabei der Frage nach, wie die Vergangenheitspolitik die Stabilität der jungen Demokratie beeinflusste und welche Strategien zur Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit verfolgt wurden.
- Vergangenheitsbewältigung und demokratische Konsolidierung
- Nationale Versöhnung im Kontext von Menschenrechtsverletzungen
- Politisch-ethische Dilemmata der Vergangenheitspolitik
- Strafverfahren versus Wahrheitskommissionen
- Die Rolle der argentinischen Menschenrechtsbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Militärdiktatur in Argentinien und die Herausforderungen der ersten demokratischen Regierung nach der Transition dar. Sie führt die zentralen Fragen der Arbeit ein und skizziert die methodische Vorgehensweise.
- I. Vergangenheitsbewältigung nach demokratischer Transition: Dieser Abschnitt beleuchtet den Zusammenhang von Vergangenheitsbewältigung und Demokratisierung. Er analysiert verschiedene Wege der Vergangenheitsaufarbeitung und die politischen und ethischen Dilemmata, die sich für junge Demokratien stellen.
- II. Fallbeispiel Argentinien: Dieses Kapitel stellt den historischen Hintergrund der argentinischen Militärdiktatur dar und analysiert die Ausgangsbedingungen für die Vergangenheitspolitik der ersten demokratischen Regierung. Es geht auf die Rolle der Menschenrechtsbewegung und die sozio-kulturellen Faktoren ein.
- 3. Wahrheit und partielle Gerechtigkeit: Vergangenheitsbewältigung der ersten demokratischen Regierung: Dieser Abschnitt widmet sich der Analyse der Vergangenheitspolitik unter Raúl Alfonsín. Es werden die Arbeit der Wahrheitskommission CONADEP, die Strafverfolgung vor nationalen Gerichten und die Bewertung der Vergangenheitspolitik detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit thematisiert die Vergangenheitsbewältigung im Kontext der demokratischen Transition. Sie konzentriert sich auf die Themen Menschenrechtsverletzungen, Wahrheitsfindung, nationale Versöhnung, Strafverfolgung und die Rolle von Wahrheitskommissionen im politischen Prozess. Zentrale Begriffe sind: Vergangenheitspolitik, Demokratie, Erinnerungskultur, Staatsbürgerkultur, Menschenrechte, Transition, Militärdiktatur, Gerechtigkeit, Strafverfahren, CONADEP, Argentinien.
Häufig gestellte Fragen
Wie verlief die demokratische Transition in Argentinien 1983?
Nach dem Ende der Militärdiktatur kehrte Argentinien unter Präsident Raúl Alfonsín zur Demokratie zurück, konfrontiert mit der Aufgabe, massive Menschenrechtsverletzungen aufzuarbeiten.
Was war die Aufgabe der CONADEP?
Die CONADEP war eine Wahrheitskommission, die das Schicksal der „Verschwundenen“ untersuchte und die Verbrechen der Diktatur dokumentierte.
Was besagen das Schlusspunktgesetz und das Befehlsnotstandsgesetz?
Diese Gesetze wurden unter Druck des Militärs erlassen, um die juristische Aufarbeitung zu begrenzen und weitere Strafverfolgungen gegen Militärangehörige zu verhindern.
Welche Rolle spielte die Menschenrechtsbewegung in Argentinien?
Gruppen wie die Madres de Plaza de Mayo waren entscheidend für den öffentlichen Druck zur Wahrheitsfindung und Gerechtigkeit.
Was versteht man unter „Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen“?
Dies war das Credo der Regierung Alfonsín, das den Versuch beschreibt, Täter zu bestrafen, ohne die junge Demokratie durch Militärrebellionen zu gefährden.
- Citation du texte
- Silvia Brugger (Auteur), 2008, Vergangenheitsbewältigung nach demokratischer Transition am Beispiel Argentinien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163071