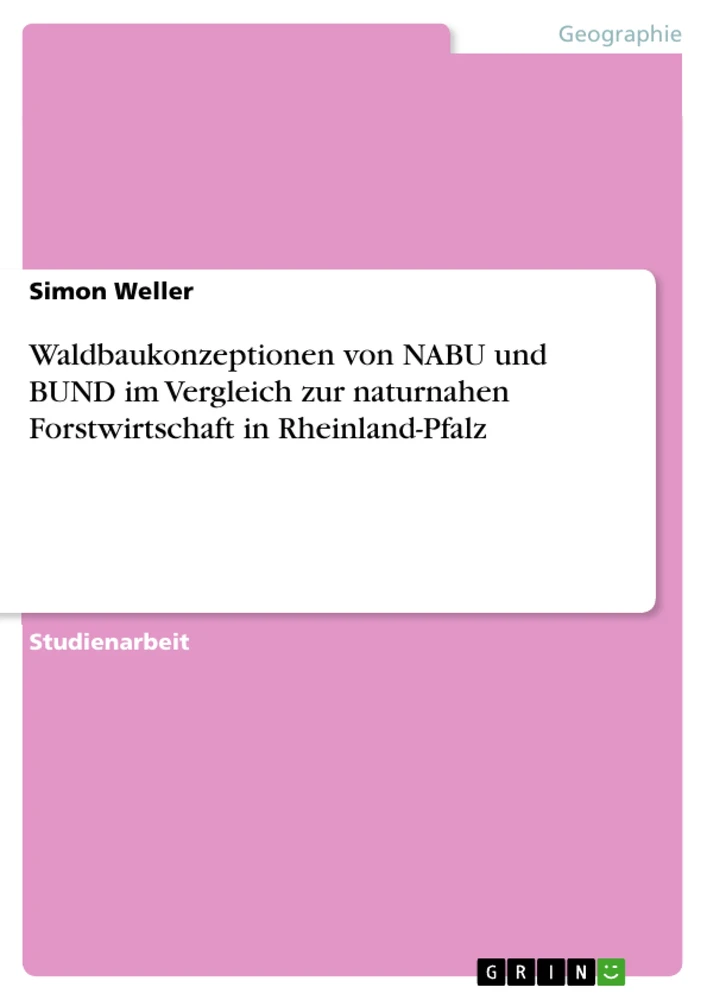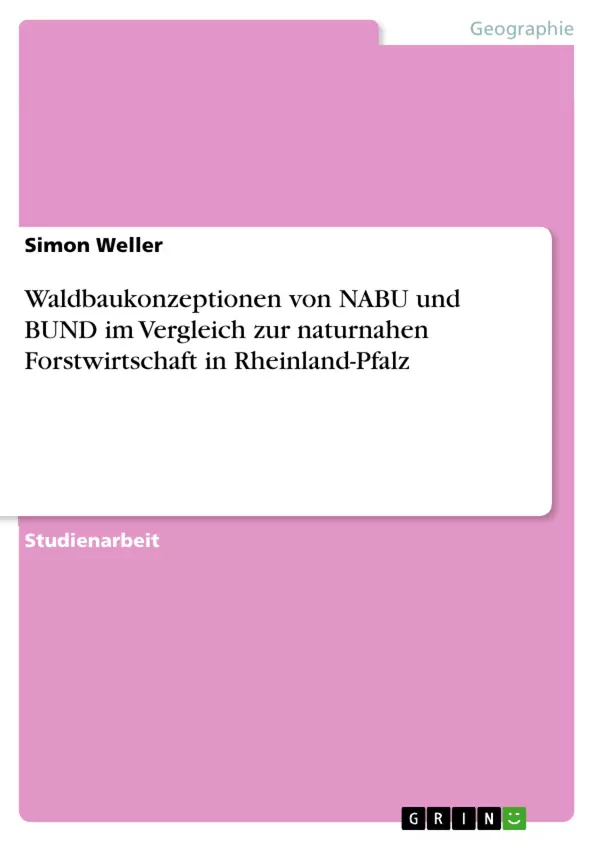Übernutzung und Vernichtung des Waldes durch den Menschen werden heute oft als Probleme der Entwicklungsländer wahrgenommen. Während der vergangenen Jahrhunderte, insbesondere während der Industrialisierung, litt jedoch auch der Wald auf dem Gebiet der heutigen BRD unter intensiver Nutzung und Raubbau. Große Gebiete wurden entwaldet, verbliebene Wälder waren oft stark degradiert. Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen wurde in der deutschen Forstwirtschaft schon früh das Prinzip der Nachhaltigkeit eingeführt, demzufolge dem Wald nur soviel Holz entnommen werden darf, wie nachwachsen kann. Durch Aufforstung stieg der Anteil des Waldes an der Gesamtfläche wieder an. Nachhaltigkeit wurde jedoch lange nur als rein wirtschaftliche Nachhaltigkeit verstanden. Aufgeforstet wurde meist mit Baumarten, die schnellen Profit versprachen. Nadelholzarten verdrängten zunehmend Buchen- und Laubmischwälder. Standortuntypische Baumarten in Monokultur, unökologische Ernteverfahren und unangepasste Jagd prägten vielerorts einen Wald, der als Ökosystem sehr instabil war und ständiger menschlicher Eingriffe bedurfte. Mit dem Erstarken der Umweltbewegung in den 1970er Jahren wurden diese Zustände zunehmend kritisiert. Natur- und Umweltschutzorganisationen wie BUND und NABU forderten eine radikale Umorientierung des Waldbaus nach den Prinzipien einer naturgemäßen, ökologischen Waldwirtschaft. Aus den schweren Folgen von Stürmen und Käferplagen in den 1990er Jahren erwuchs die Einsicht auch aus ökonomischen Gründen erstrebenswert sind. Die Ministerien und Landesforstverwaltungen der meisten Bundesländer reagierten und verankerten mehr Ökologie im Waldbau. In Rheinland-Pfalz war der Erlass der waldbaulichen Richtlinie "Ziele und Grundsätze einer ökologischen Waldentwicklung" 1993 ein entscheidender Schritt zur Etablierung des Konzepts der "naturnahen" Waldbewirtschaftung. Das Konzept enthält dabei viele der Grundsätze der von den Naturschutzorganisationen geforderten "naturgemäßen" Waldwirtschaft. Auf den ersten Blick scheint hier also der Naturschutz seine Ziele weitgehend erreicht zu haben, die Probleme der Vergangenheit scheinen gelöst. Im Folgenden soll durch einen differenzierten Vergleich der waldbaulichen Konzepte des Landes Rheinland-Pfalz einerseits und der Naturschutzorganisationen BUND und NABU andererseits geklärt werden, ob dieser Eindruck den Tatsachen entspricht und etwaige Unterschiede und Schwierigkeiten herausgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wald in Rheinland-Pfalz
- Waldbaukonzeptionen von BUND und NABU und des Landes RLP
- Naturnahe Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz
- Naturgemäße Waldwirtschaft nach BUND und NABU
- Waldbaukonzeptionen von BUND und NABU und des Landes RLP im Vergleich
- Konfliktpunkt Verkehrs- und Arbeitssicherheit
- Konfliktpunkt Jagd
- Konfliktpunkt Natura 2000 Gebiete
- Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Konzepte der naturnahen Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz und vergleicht diese mit den Forderungen von Naturschutzorganisationen wie BUND und NABU. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Konzepte zu analysieren und mögliche Konflikte aufzuzeigen.
- Entwicklung der Waldwirtschaft in Deutschland
- Naturnahe Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz
- Konzepte von BUND und NABU zur naturgemäßen Waldwirtschaft
- Vergleich der Konzepte
- Konflikte und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Waldwirtschaft in Deutschland und die Herausforderungen, die durch Übernutzung und Raubbau entstanden sind. Sie führt das Prinzip der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft ein und zeigt die Bedeutung von ökologischen Aspekten bei der Waldbewirtschaftung auf.
Wald in Rheinland-Pfalz
Dieser Abschnitt beschreibt die Besitzverhältnisse im rheinland-pfälzischen Wald und die Flächenbilanz. Er beleuchtet die Baumartenverteilung und den Anteil des Waldbiotops an der Gesamtwaldfläche.
Waldbaukonzeptionen von BUND und NABU und des Landes RLP
Dieses Kapitel geht auf die unterschiedlichen Konzepte der Waldbewirtschaftung ein. Es werden die Grundsätze der „naturnahen Waldbewirtschaftung“ in Rheinland-Pfalz sowie die Forderungen von BUND und NABU zur „naturgemäßen Waldwirtschaft“ dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Waldwirtschaft in Rheinland-Pfalz, insbesondere mit den Konzepten der naturnahen und naturgemäßen Waldbewirtschaftung. Dabei werden Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Artenvielfalt, Waldbiotope, Forstpolitik und Naturschutzorganisationen behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen naturnaher und naturgemäßer Waldwirtschaft?
Die „naturnahe“ Waldwirtschaft ist das offizielle Konzept des Landes Rheinland-Pfalz, während „naturgemäße“ Waldwirtschaft die oft radikaleren ökologischen Forderungen von Verbänden wie BUND und NABU beschreibt.
Welche historischen Probleme führten zum Umdenken im Waldbau?
Jahrhundertealte Übernutzung, Monokulturen mit standortuntypischen Nadelhölzern und schwere Sturmschäden in den 1990er Jahren machten deutlich, dass rein wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht ausreicht.
Was sind die zentralen Konfliktpunkte zwischen Forstverwaltung und Naturschutzverbänden?
Wichtige Streitpunkte sind die Verkehrs- und Arbeitssicherheit im Wald, die Jagdstrategien sowie die Umsetzung von Schutzmaßnahmen in Natura 2000-Gebieten.
Seit wann verfolgt Rheinland-Pfalz eine ökologische Waldentwicklung?
Ein entscheidender Schritt war der Erlass der Richtlinie „Ziele und Grundsätze einer ökologischen Waldentwicklung“ im Jahr 1993.
Welche Ziele verfolgt das Konzept der naturnahen Waldwirtschaft?
Ziele sind die Förderung stabilerer Ökosysteme, der Schutz der Artenvielfalt und die Abkehr von instabilen Monokulturen hin zu Laubmischwäldern.
- Quote paper
- Simon Weller (Author), 2009, Waldbaukonzeptionen von NABU und BUND im Vergleich zur naturnahen Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163147