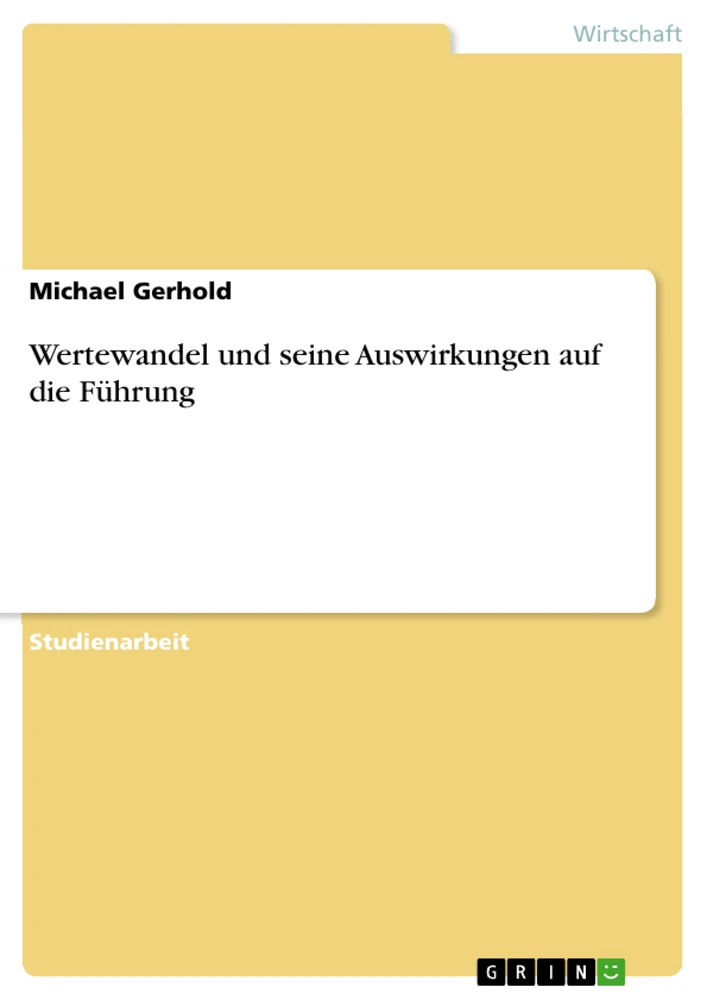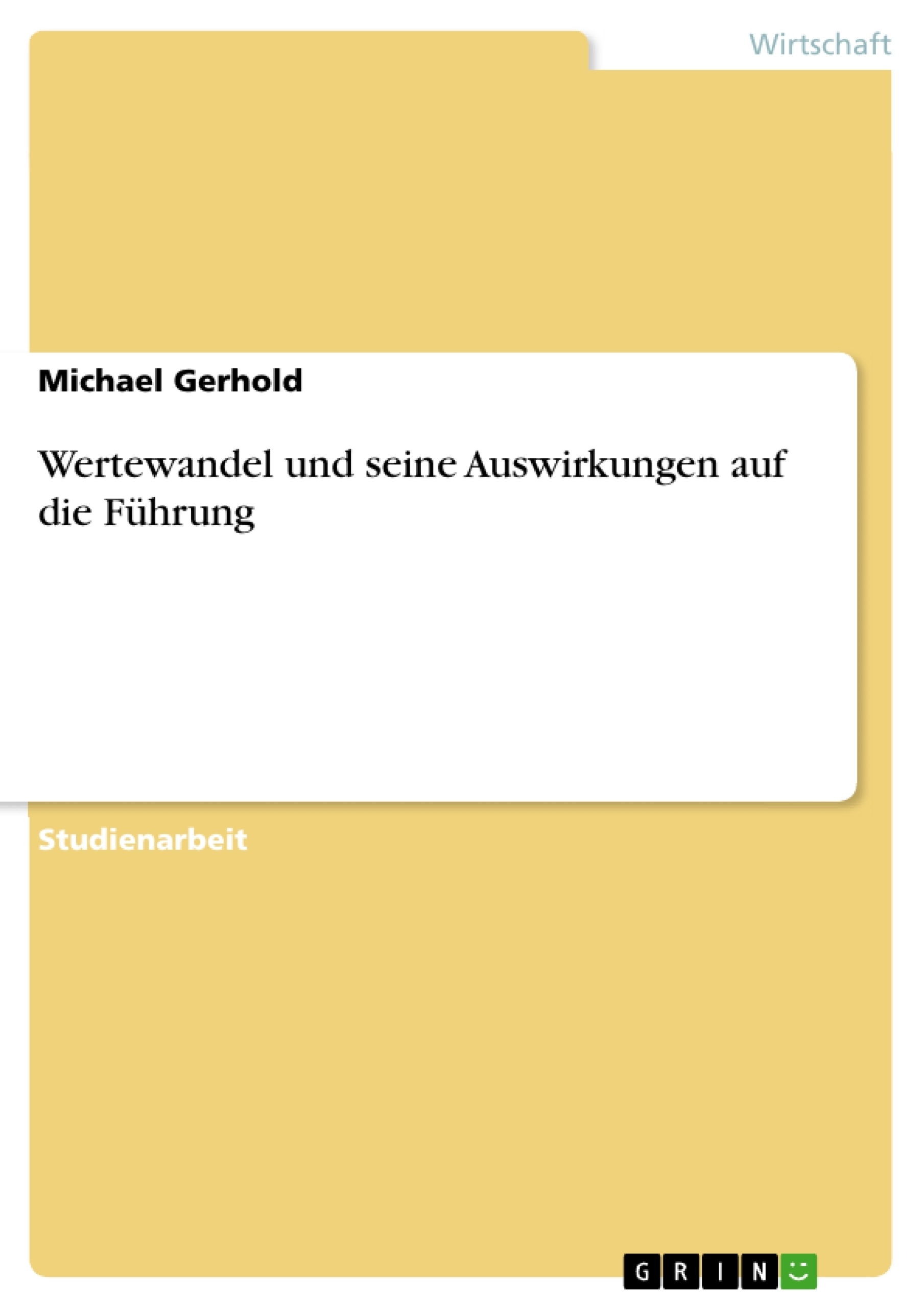Wertewandel führt zu vielen Veränderungen in der Gesellschaft. Dies ist auch verständlich, wenn man bedenkt, dass jede Entscheidung auf einem Wertesystem beruht – ein Mensch wertet zu jeder Zeit. Ob es eine einfache oder komplexe Entscheidung ist , jede Entscheidung wird von der individuellen Wertehaltung beeinflusst. Auch in der Mitarbeiterführung stellt man einen Wandel fest. Daher beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage, ob Wertewandel Führung beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Führung
- Definition
- Das Führungsstilkontinuum
- Wertewandel am Beispiel Deutschland
- Deutschlands Weg zum Dienstleistungsstaat
- Erklärungsansätze
- Fazit
- Entwicklung des Führungsstils
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einfluss des Wertewandels auf die Führung. Die Hypothese ist, dass Führung durch den Wertewandel beeinflusst wird, da im Führungsprozess Entscheidungen getroffen werden, die auf einem Wertesystem basieren.
- Definition von Führung und Unterscheidung zwischen situationsbeständigem Stil und situationsabhängigem Verhalten
- Analyse des Wertewandels am Beispiel Deutschlands, insbesondere der Entwicklung zum Dienstleistungsstaat
- Erklärung des Wertewandels anhand von Erklärungsansätzen
- Untersuchung der Entwicklung des Führungsstils im Kontext des Wertewandels
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: ob und wie Wertewandel Führung beeinflusst. Die Hypothese, dass Führung durch den Wertewandel beeinflusst wird, wird aufgrund der Tatsache aufgestellt, dass Entscheidungen im Führungsprozess auf einem Wertesystem basieren.
Führung
Definition
Der Abschnitt beschäftigt sich mit der Definition von Führung und stellt verschiedene Ansätze dar. Es wird deutlich gemacht, dass Führung eine lernbare Eigenschaft ist, die stark vom Verhalten des Vorgesetzten abhängt.
Das Führungsstilkontinuum
Dieser Abschnitt beschreibt das Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt, welches autoritären und kooperativen Führungsstil als Extrempunkte auf einem Kontinuum darstellt. Der Abschnitt erläutert die verschiedenen Klassifikationen des Führungsstilkontinuums und betont, dass sich der Entscheidungsspielraum vom autoritären zum kooperativen Führungsstil verschiebt.
Wertewandel am Beispiel Deutschland
Deutschlands Weg zum Dienstleistungsstaat
Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung Deutschlands, insbesondere die Transformation zum Dienstleistungsstaat. Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen werden als Grundlage für den Wertewandel dargestellt.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Wertewandel die Mitarbeiterführung?
Da jede Führungsentscheidung auf einem Wertesystem basiert, führen gesellschaftliche Wertänderungen zwangsläufig zu einer Anpassung der Führungsstile und Erwartungshaltungen.
Was ist das Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt?
Es beschreibt verschiedene Abstufungen zwischen autoritärem und kooperativem Führungsstil, wobei sich der Entscheidungsspielraum je nach Modell zum Mitarbeiter hin verschiebt.
Welche Rolle spielt die Entwicklung zum Dienstleistungsstaat?
Der Wandel Deutschlands zum Dienstleistungsstaat hat neue Anforderungen an die Flexibilität und Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestellt und so den Wertewandel beschleunigt.
Ist Führung eine angeborene Eigenschaft?
Führung wird heute als eine lernbare Eigenschaft angesehen, die stark vom Verhalten des Vorgesetzten und dem situativen Kontext abhängt.
Was unterscheidet Stil von Verhalten in der Führung?
Ein Führungsstil ist tendenziell situationsbeständig, während Führungsverhalten flexibel auf die jeweilige Situation und die Bedürfnisse der Mitarbeiter reagiert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Michael Gerhold (Autor:in), 2010, Wertewandel und seine Auswirkungen auf die Führung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163281