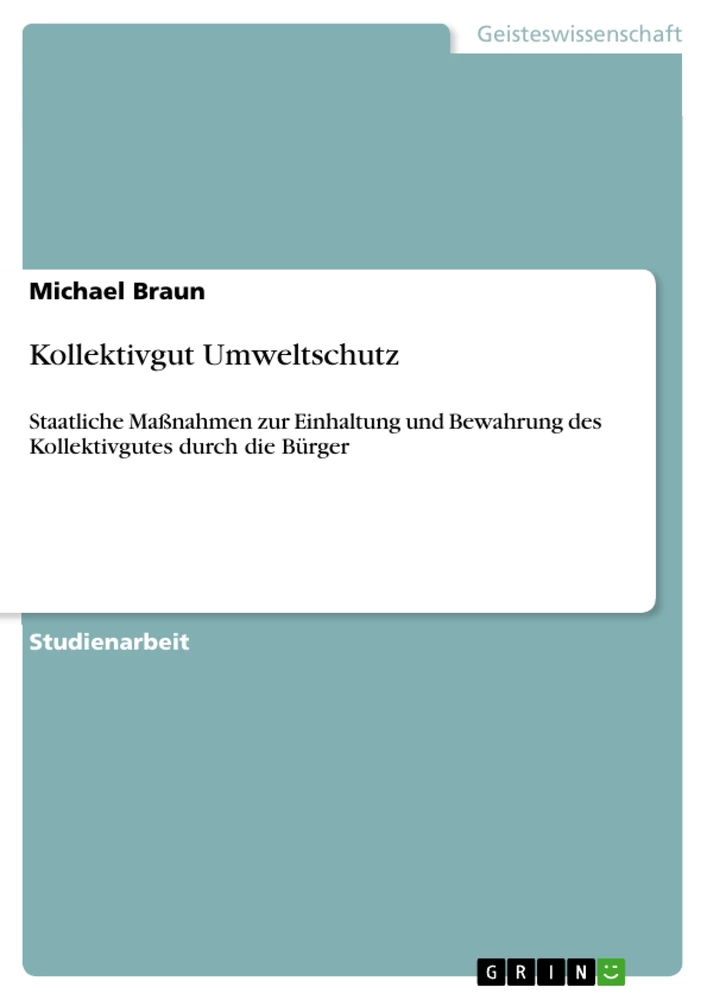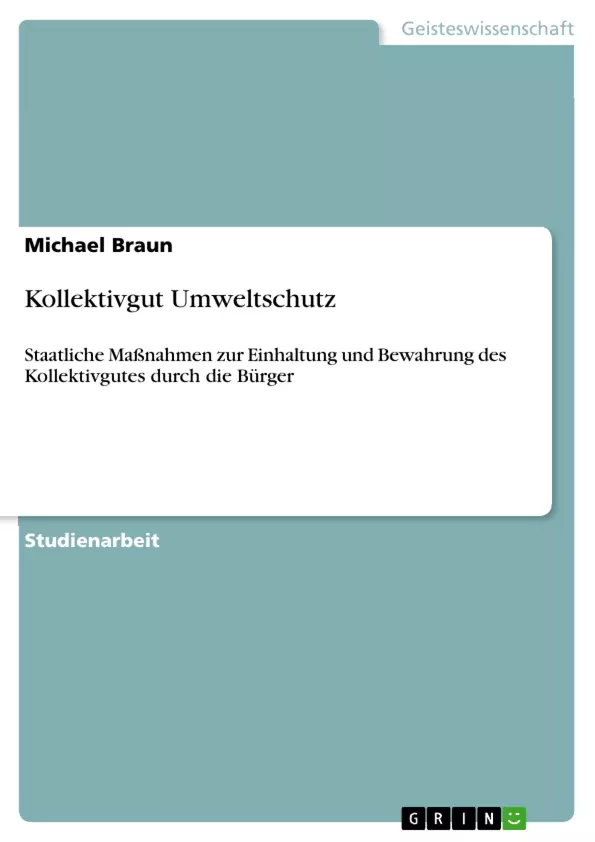Die Thematik Umweltschutz ist in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Aufgaben der Menschheit geworden. Insbesondere die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, die großflächigen Überschwemmungen in Pakistan und die Waldbrände in Russland in jüngster Vergangenheit zeigen, welche Brisanz der Umweltschutz für die Menschheit besitzt. Dabei rückt das Thema „Klimawandel“ immer mehr in den medialen Fokus. Forscher prognostizieren seit Langem eine Zunahme von Umweltkatastrophen, als Antwort Jahrhunderte langer Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt durch den Menschen.
Als eine der ersten wissenschaftlichen Studien über die Begrenztheit natürlicher Ressourcen veröffentlichten Meadows et al. (1972) im Auftrag des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“. Darin prognostizieren sie ein starkes Bevölkerungswachstum und eine daraus resultierende Nahrungsmittel- und Rohstoffknappheit. Die Modernisierungstheorie und der damit einhergehende technische Fortschritt lassen die Thesen Meadows et al. nicht zutreffen. Dieser ermöglichte in der Vergangenheit die Substitution eines knappen Rohstoffes durch einen Ersatzstoff. Somit stellt die Knappheit der Ressourcen ein kleineres Problem gegenüber den CO2-Emmissionen durch Verbrauch von fossilen Ressourcen dar (Diekmann 2001: 41-42). Viele Forscher prognostizieren eine einhergehende Erderwärmung mit dem CO2-Ausstoß. Daneben bewirken die anhaltende Abholzung der Regenwälder und die Zerstörung natürlicher Lebensräume ihr übriges.
Im Jahr 1992 fand erstmals eine UN-Konferenz zum Thema Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro statt, der 178 Staaten beisaßen. Seit dieser Konferenz bis einschließlich der zweiten UN-Konferenz, 17 Jahre später in Kopenhagen, konnten sich die beteiligten Staaten nicht auf eine gemeinsame Zielsetzung einigen.
Diese Sachlage wirft die Frage auf, warum es zum Scheitern einer gemeinsamen Umweltpolitik gekommen ist. Die Problematik und die Gründe hierfür in Verbindung mit der Kollektivgut Theorie werden unter Punkt 2 erläutert.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich auf die Fragestellung, wie der Staat dafür Sorge tragen kann, dass die Bürger die Herstellung und Bewahrung des Kollektivguts Umweltschutz leisten.
In diesem Zusammenhang wird im Anschluss an die Kollektivgut Theorie die Rational Choice Theorie erläutert. Unter Punkt 4 ist die Handlungsfähigkeit des Staates in der Umweltpolitik in Zusammenhang mit den externen Effekten beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Umweltschutz – Bedeutung und Aktualität
- Kollektivgüter Umwelt und Umweltschutz
- Theoretischer Ansatz zur Erklärung des Umwelthandelns
- Rational-Choice Theorie
- Einsatz der Rational-Choice Theorie im Umweltschutz
- Handlungsfähigkeit des Staates in der Umweltpolitik
- Ordnungsrechtliche Instrumente des Staates
- Ökonomische Anreizinstrumente des Staates
- Umweltgebühren
- Umweltzertifikate
- Umwelthaftungsrecht
- Informelle und kooperative Instrumente
- Fazit und kritische Anmerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert staatliche Maßnahmen zur Einhaltung und Bewahrung des Kollektivguts Umweltschutz. Sie untersucht dabei die Schwierigkeiten, die aus der Nicht-Ausschließbarkeit und der Nicht-Rivalität von Umweltschutzgütern entstehen und die die Bereitschaft einzelner Akteure zum Umweltschutz verringern.
- Kollektivgutproblematik und Trittbrettfahrerverhalten
- Rolle des Staates in der Umweltpolitik
- Instrumente der Umweltpolitik: Ordnungsrechtliche, Ökonomische, Informelle und Kooperative
- Rational-Choice Theorie als Erklärungsansatz für Umwelthandeln
- Kritik an der Umweltpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung und Aktualität des Umweltschutzes anhand aktueller Umweltkatastrophen und der wissenschaftlichen Debatte um den Klimawandel. Das zweite Kapitel thematisiert die Kollektivgutproblematik des Umweltschutzes, wobei die Eigenschaften von Kollektivgütern und die daraus resultierenden Herausforderungen für die Bereitstellung von Umweltschutzleistungen im Fokus stehen.
Kapitel 3 stellt die Rational-Choice Theorie als theoretischen Ansatz zur Erklärung des Umwelthandelns vor und analysiert, wie diese Theorie auf den Umweltschutz angewendet werden kann. Das vierte Kapitel behandelt die Handlungsfähigkeit des Staates in der Umweltpolitik und die Bedeutung von externen Effekten.
Kapitel 5, 6 und 7 untersuchen verschiedene Instrumente des Staates, die zur Einhaltung und Bewahrung des Kollektivguts Umweltschutz dienen: ordnungsrechtliche Instrumente, ökonomische Anreize und informelle sowie kooperative Ansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Umweltschutz als Kollektivgut, der Rational-Choice Theorie, der Handlungsfähigkeit des Staates in der Umweltpolitik und der Analyse unterschiedlicher Instrumente der Umweltpolitik. Besondere Aufmerksamkeit wird den externen Effekten und dem Trittbrettfahrerverhalten gewidmet.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Umweltschutz als „Kollektivgut“ bezeichnet?
Umweltschutz ist ein Kollektivgut, weil niemand von seiner Nutzung ausgeschlossen werden kann (Nicht-Ausschließbarkeit) und die Nutzung durch einen die Verfügbarkeit für andere nicht mindert (Nicht-Rivalität).
Was ist das „Trittbrettfahrer-Problem“ im Umweltschutz?
Da jeder vom Umweltschutz profitiert, unabhängig davon, ob er selbst dazu beiträgt, haben rationale Akteure oft keinen Anreiz, Kosten für den Umweltschutz zu tragen, und verlassen sich auf die Leistungen anderer.
Wie erklärt die Rational-Choice-Theorie das Umwelthandeln?
Sie geht davon aus, dass Individuen nur dann in Umweltschutz investieren, wenn der persönliche Nutzen die Kosten übersteigt. Da dies selten der Fall ist, bleibt individuelles Engagement oft hinter dem gesellschaftlich Notwendigen zurück.
Welche ökonomischen Instrumente kann der Staat einsetzen?
Der Staat nutzt Instrumente wie Umweltgebühren (Steuern), Umweltzertifikate (Emissionshandel) und das Umwelthaftungsrecht, um ökologisches Handeln finanziell attraktiv zu machen.
Was sind externe Effekte in der Umweltpolitik?
Externe Effekte sind Kosten (z.B. Luftverschmutzung), die bei der Produktion entstehen, aber nicht vom Verursacher, sondern von der Allgemeinheit getragen werden. Der Staat versucht, diese zu „internalisieren“.
Warum scheitern oft internationale Klimakonferenzen?
Oft scheitern sie an der Kollektivgutproblematik auf globaler Ebene: Staaten fürchten Wettbewerbsnachteile, wenn sie allein strenge Auflagen einführen, während andere als Trittbrettfahrer profitieren.
- Citation du texte
- Michael Braun (Auteur), 2010, Kollektivgut Umweltschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163304