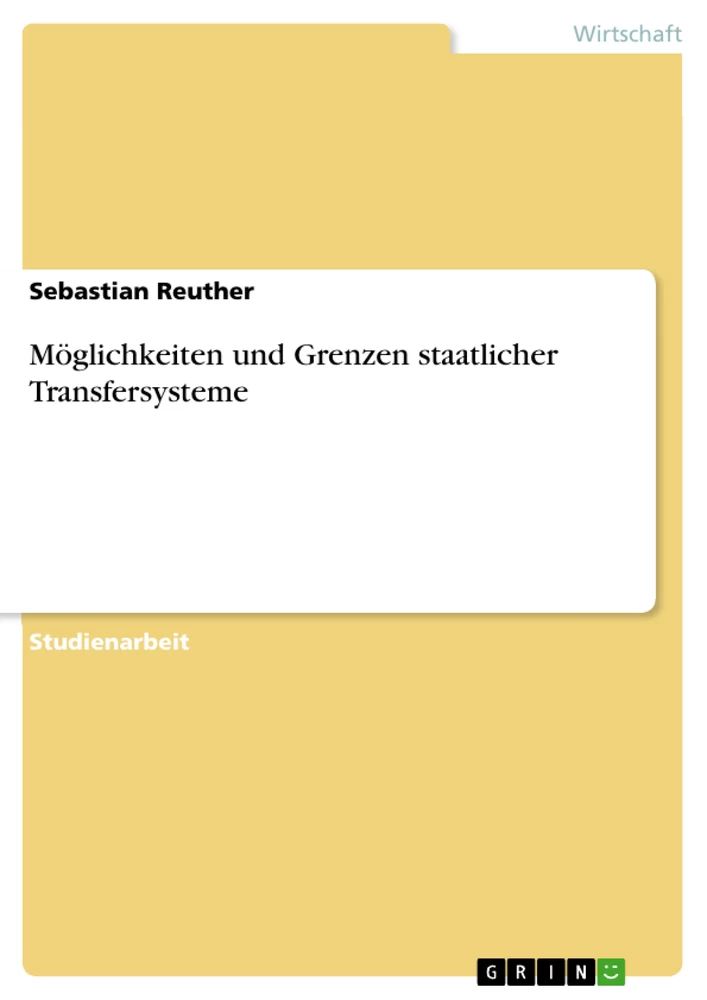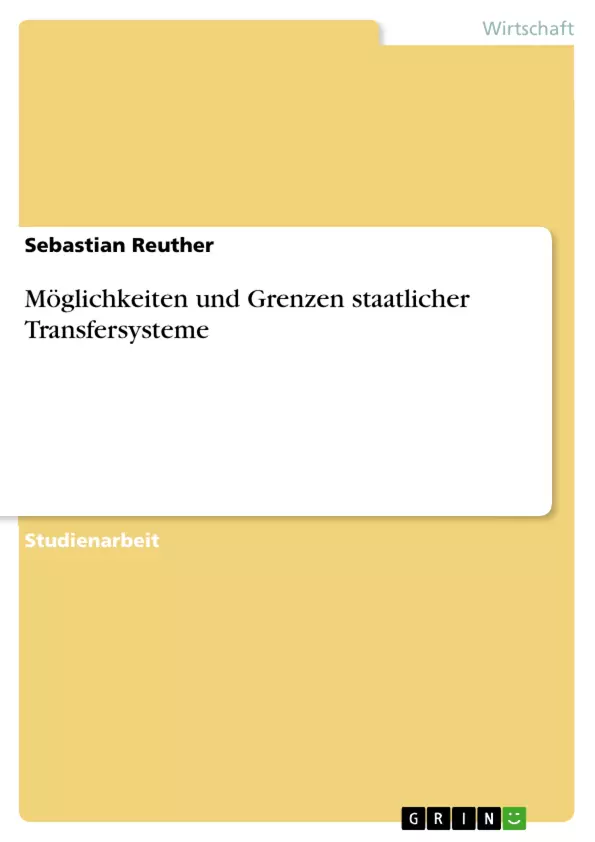„Gleichheit nur für Gleiche, nicht für alle. Und so hält man auch die Ungleichheit für recht, und sie ist es ja auch, aber nicht für alle, sondern für Ungleiche.“
(Aristoteles)
Die Fürsorge für seine Bürger in Form einer Absicherung gegen die Risiken des Lebens ist der Kerngedanke, der jedem Sozialstaat innewohnt. Er soll sein Handeln an den Wertvorstellungen ausrichten, die zu einem sozial erwünschten gesellschaftlichen Ergebnis führen. Max Weber, der Vater der deutschen Soziologie, schrieb bereits 1922 in seinem Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft, dass für die Besitzlosen „[…] naturgemäß Recht und Verwaltung im Dienst des Ausgleichs der ökonomischen und sozialen Lebenschancen gegenüber den Besitzenden zu stehen [haben]“ (ebd.: 565). Hier wird der Aufgabenbereich des Sozialstaates noch erweitert. Seine Aufgabe läge demnach, neben der ökonomischen Sicherung benachteiligter Gruppen, auch darin unter dem Postulat der sozialen Gerechtigkeit einen Chancenausgleich zwischen seinen Bürgern zu erwirken. In der Bundesrepublik Deutschland ist dieses Prinzip in § 1 Abs. 1 Sozialgesetzbuch verbindlich festgeschrieben.
Um die erwünschten sozialpolitischen Ziele verwirklichen zu können, stehen dem Staat verschiedene Instrumente zur Verfügung. Zu ihnen gehören unter anderem die interpersonellen Verteilungskorrekturen durch die Gewährung von Transferleistungen gegenüber Bedürftigen aber auch Nicht-Bedürftigen. Je nach Ausgestaltung des Steuer- und Transfersystems können diese Leistungen den Großteil der sozialpolitischen Maßnahmen ausmachen. Um die Dimensionen zu verdeutlichen, sei angemerkt, dass in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2007 ungefähr 42,4 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung staatliche Sozialleistungen empfangen haben (vgl. IWK, 2010: 1).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Sozialpolitik
- Einkommenspolitik
- Transferzahlungen
- Sozialstaatsprinzip
- Korrektur der Primärverteilung
- Wirkungen von Transferleistungen
- Resultate redistributiver Einkommens- und Sozialpolitik
- Einkommensverteilung Deutschland
- Staatliche Umverteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Transfersysteme in Deutschland. Sie untersucht, wie das System durch Transferleistungen die Einkommensverteilung korrigieren und soziale Ungleichheit abmildern kann. Darüber hinaus werden die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Gesellschaft und die Herausforderungen, die sich aus der wachsenden Zahl der Leistungsempfänger ergeben, beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung von Sozialpolitik, Einkommenspolitik und Transferzahlungen
- Das Sozialstaatsprinzip und die korrigierende Funktion von Transferleistungen
- Die Auswirkungen von Transferleistungen auf die Einkommensverteilung und die Gesellschaft
- Die Rolle des Staates in der Steuerung und Gestaltung von Transfersystemen
- Die Herausforderungen und Grenzen staatlicher Transfersysteme
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Problemstellung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Sozialstaates und seiner Aufgabe ein, die Lebensrisiken der Bürger abzusichern und soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Die Bedeutung von Transferleistungen als Instrument der Sozialpolitik wird hervorgehoben und die Frage nach den Grenzen und Möglichkeiten staatlicher Eingriffe in den sozialen Bereich aufgeworfen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe wie Sozialpolitik, Einkommenspolitik und Transferzahlungen, um eine klare Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Dabei wird auf den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und ihre Rolle im Kontext des Sozialstaates eingegangen.
- Sozialstaatsprinzip: Hier wird das Prinzip des Sozialstaates als Grundlage für die Gewährung von Transferleistungen erläutert. Die korrigierende Funktion von Transferleistungen hinsichtlich der Primärverteilung und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Gesellschaft werden analysiert.
- Resultate redistributiver Einkommens- und Sozialpolitik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen staatlicher Maßnahmen auf die Einkommensverteilung in Deutschland. Es werden Daten und Statistiken zur Einkommensverteilung und zur staatlichen Umverteilung analysiert, um ein Bild von der Wirksamkeit und Effektivität des deutschen Transfersystems zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Einkommenspolitik, Transferleistungen, Sozialstaat, Redistribution, Einkommensverteilung, soziale Ungleichheit, Deutschland, Sozialgesetzbuch, staatliche Eingriffe, Lebensrisiken, Sozialleistungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel staatlicher Transferleistungen?
Das Hauptziel ist die Absicherung der Bürger gegen Lebensrisiken und der Ausgleich sozialer Ungleichheit durch die Umverteilung von Einkommen im Sinne der sozialen Gerechtigkeit.
Was versteht man unter dem Sozialstaatsprinzip?
Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, für einen gerechten sozialen Ausgleich zu sorgen und benachteiligte Gruppen ökonomisch abzusichern, wie es in Deutschland im Sozialgesetzbuch festgeschrieben ist.
Wie beeinflussen Transfersysteme die Einkommensverteilung?
Durch Steuern und Abgaben auf der einen sowie Transferzahlungen (wie Kindergeld oder Sozialhilfe) auf der anderen Seite wird die Primärverteilung korrigiert, um die Schere zwischen Arm und Reich zu verkleinern.
Wie viele Menschen in Deutschland beziehen staatliche Leistungen?
Beispielhaft für das Jahr 2007 erhielten etwa 42,4 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung in Deutschland staatliche Sozialleistungen, was die enorme Dimension des Transfersystems verdeutlicht.
Wo liegen die Grenzen staatlicher Transfersysteme?
Grenzen ergeben sich aus der finanziellen Belastbarkeit des Staates, potenziellen negativen Anreizeffekten auf dem Arbeitsmarkt und der wachsenden Zahl der Leistungsempfänger im Verhältnis zu den Beitragszahlern.
- Citar trabajo
- Sebastian Reuther (Autor), 2010, Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Transfersysteme, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163328