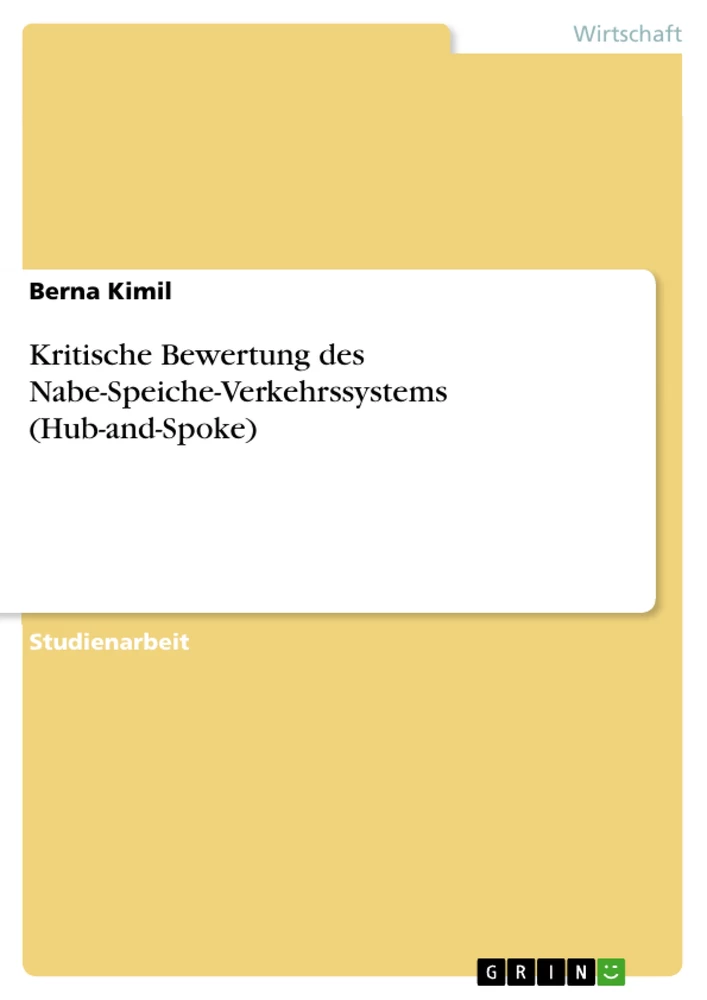Das Thema meiner Hausarbeit in dem Logistik Seminar beschäftigt sich mit der kritischen Bewertung des Hub-and-Spoke, bzw. Nabe-Speiche-Verkehrssystems.
Das Hub-and-Spoke System wurde als erstes von FedEx entwickelt, dabei werden Sendungen zu einem zentralen Umschlagplatz geflogen, sortiert, in Flugzeuge verladen und weiter versendet. Dieses System wird mittlerweile von den meisten Fluggesellschaften übernommen.
Das Rastersystem, welches dem Hub-and-Spoke System oft gegenübergestellt wird, lässt sich charakterisieren als Verkehrsverbindungen von jedem Punkt nach jedem Punkt des Verkehrsnetzes. Dieses System wurde oft in Verkehrsbetrieben wie Stückgut-Speditionen, Paketdiensten oder im Personen-Linienverkehr eingesetzt.
Dieses System wurde meiner Meinung nach vom Hub-and-Spoke System überholt, worauf ich im Rahmen der Hausarbeit noch näher eingehen werde.
Das Hub-and-Spoke System bringt allerdings nicht nur Vorteile, wie z.B. der Kostendegression durch Kapazitätsauslastung mit sich, sondern auch Nachteile. Nachdem ich einige Begriffe erläutert habe, behandele ich die Entstehung, Funktionsweise und Voraussetzungen des Hub-and-Spoke Systems. Darauf folgen Vorteile sowie die kritische Betrachtungsweise des Systems. Mit einer Schlussbetrachtung werde ich die Hausarbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Distributionslogistik
- 2.2 Hub-and-Spoke System
- III. Beginn des Hub-and-Spoke Systems
- 3.1 Erfahrungskurven-Analyse
- 3.2 Entstehung bei Federal Express
- 3.3 Beginn im Flugverkehr
- IV. Funktionsweise des Hub-and-Spoke Systems
- V. Voraussetzungen des Systems
- VI. Vorteile des Hub-and-Spoke Systems
- VII. Kritische Bewertung des Hub-and-Spoke Systems
- 7.1 Längere Reisezeiten
- 7.2 Ausfallrisiko
- 7.3 Kapazitätsauslastung
- 7.4 Kapazitätsbegrenzung
- 7.5 Folgen von Verspätungen
- 7.6 Hub-and-Spoke versus Depot-Netzwerk
- 7.7 Keine Nutzung im Straßenpersonenverkehr
- VIII. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Hub-and-Spoke-Verkehrssystem kritisch. Die Zielsetzung besteht darin, die Funktionsweise, Vorteile und Nachteile dieses Systems zu beleuchten und eine umfassende Bewertung vorzunehmen. Dabei wird insbesondere auf die Entwicklung, die Voraussetzungen und die kritischen Aspekte eingegangen.
- Entwicklung und Entstehung des Hub-and-Spoke-Systems
- Funktionsweise und logistische Voraussetzungen
- Vorteile und Effizienzgewinne des Systems
- Kritische Betrachtung der Nachteile und Risiken
- Vergleich mit alternativen Verkehrssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der kritischen Bewertung des Hub-and-Spoke-Verkehrssystems ein. Sie beschreibt kurz das System, stellt es dem Rastersystem gegenüber und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung der zentralen Fragestellung und der methodischen Vorgehensweise, welche die kritische Auseinandersetzung mit den Vorteilen und Nachteilen des Hub-and-Spoke Systems umfasst.
II. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe Distributionslogistik und Hub-and-Spoke-System. Die Distributionslogistik wird als Gestaltung, Planung und Steuerung der Güterverteilung beschrieben, inklusive des Informationsflusses. Das Hub-and-Spoke-System wird als sternförmige Anordnung von Transportwegen mit einem zentralen Knotenpunkt (Hub) erläutert. Die präzisen Definitionen legen die Grundlage für das weitere Verständnis der Arbeit.
III. Beginn des Hub-and-Spoke Systems: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Hub-and-Spoke-Systems. Es beginnt mit der Erfahrungskurvenanalyse, die die Grundlage für die Kostenoptimierung durch Skaleneffekte liefert. Die Rolle von Federal Express bei der Einführung des Systems in den USA wird hervorgehoben. Die Beschreibung des Wachstums von FedEx und der Übernahme des Systems durch andere Fluggesellschaften unterstreicht den Erfolg dieses Transportmodells.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kritische Bewertung des Hub-and-Spoke-Verkehrssystems
Was ist der Hauptgegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Hub-and-Spoke-Verkehrssystem kritisch. Sie beleuchtet die Funktionsweise, Vorteile und Nachteile dieses Systems und liefert eine umfassende Bewertung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Entstehung des Hub-and-Spoke-Systems, die Funktionsweise und logistischen Voraussetzungen, die Vorteile und Effizienzgewinne, eine kritische Betrachtung der Nachteile und Risiken sowie einen Vergleich mit alternativen Verkehrssystemen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinitionen (Distributionslogistik und Hub-and-Spoke-System), Beginn des Hub-and-Spoke-Systems (Erfahrungskurven-Analyse, Entstehung bei Federal Express, Beginn im Flugverkehr), Funktionsweise des Hub-and-Spoke-Systems, Voraussetzungen des Systems, Vorteile des Hub-and-Spoke-Systems, Kritische Bewertung des Hub-and-Spoke-Systems (längere Reisezeiten, Ausfallrisiko, Kapazitätsauslastung, Kapazitätsbegrenzung, Folgen von Verspätungen, Hub-and-Spoke versus Depot-Netzwerk, Keine Nutzung im Straßenpersonenverkehr) und Schlussbetrachtung.
Was wird unter „Distributionslogistik“ und „Hub-and-Spoke-System“ verstanden?
Distributionslogistik wird als Gestaltung, Planung und Steuerung der Güterverteilung beschrieben, inklusive des Informationsflusses. Das Hub-and-Spoke-System ist eine sternförmige Anordnung von Transportwegen mit einem zentralen Knotenpunkt (Hub).
Wie ist das Hub-and-Spoke-System entstanden?
Die Entstehung wird anhand der Erfahrungskurvenanalyse, der Rolle von Federal Express in den USA und der Übernahme des Systems durch andere Fluggesellschaften erläutert. Die Kostenoptimierung durch Skaleneffekte spielte eine wichtige Rolle.
Welche Vorteile bietet das Hub-and-Spoke-System?
Die Seminararbeit beschreibt die Vorteile des Systems, die jedoch in der kritischen Bewertung relativiert werden.
Welche Nachteile und Risiken birgt das Hub-and-Spoke-System?
Die kritische Bewertung umfasst Aspekte wie längere Reisezeiten, Ausfallrisiko, Kapazitätsauslastung und -begrenzung, Folgen von Verspätungen und einen Vergleich mit Depot-Netzwerken. Die Nicht-Anwendbarkeit im Straßenpersonenverkehr wird ebenfalls thematisiert.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Seminararbeit angewendet?
Die Arbeit verfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit den Vorteilen und Nachteilen des Hub-and-Spoke-Systems, basierend auf einer umfassenden Analyse der Literatur und der dargestellten Aspekte.
- Quote paper
- Berna Kimil (Author), 2006, Kritische Bewertung des Nabe-Speiche-Verkehrssystems (Hub-and-Spoke), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163374