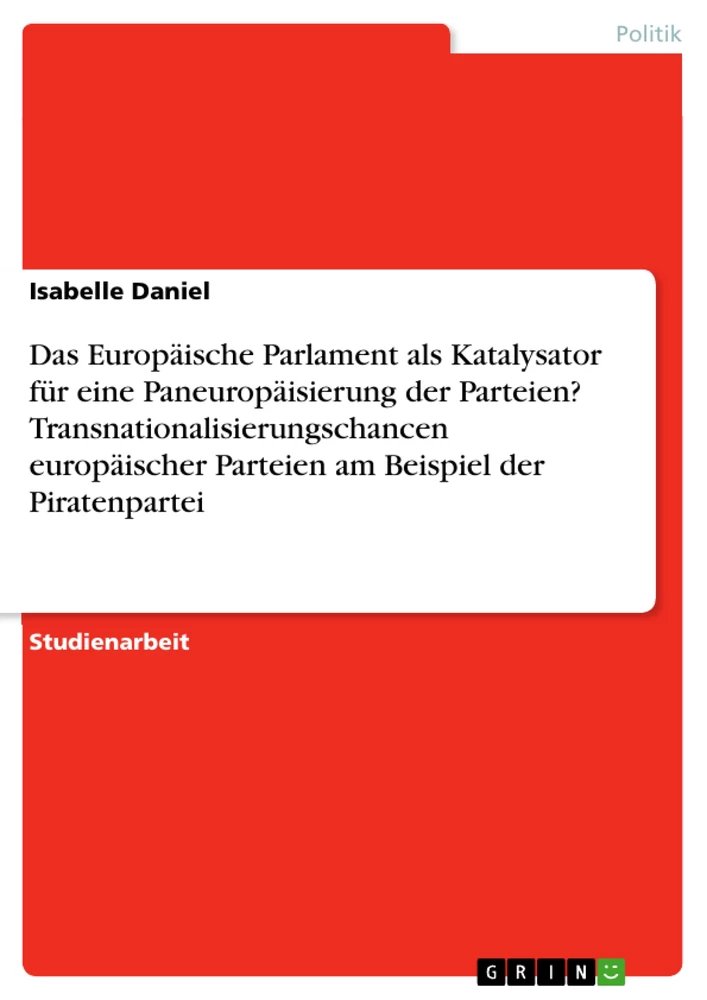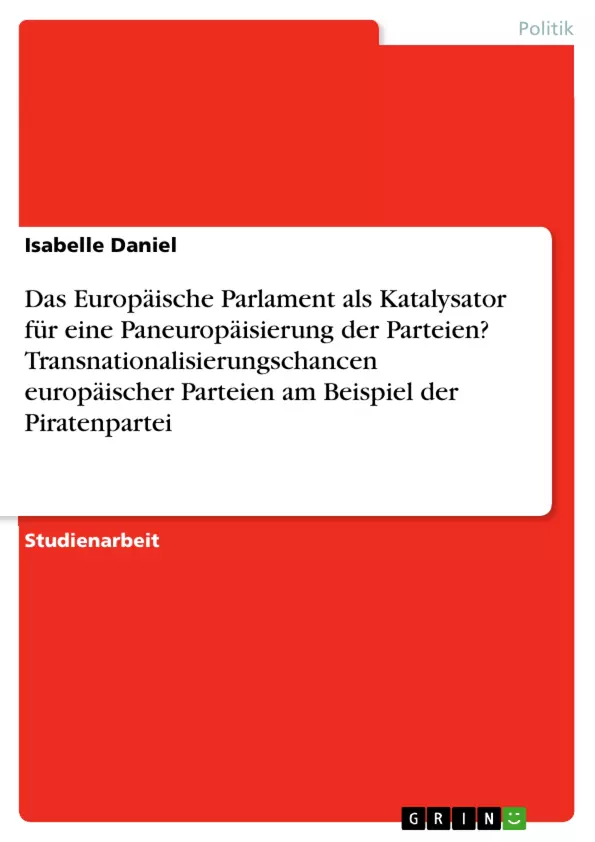Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einhergehen soll eine vertiefende Supranationalisierung der Europäischen Union und ihrer Institutionen. Besonders betroffen in dem Sinne, dass sich bislang nationale Kompetenzen auf die supranationale Ebene verlagern, ist das Europäische Parlament (nachfolgend EP). Ihm obliegt mit der Kompetenzerweiterung durch Lissabon auch eine Mitverantwortung dafür, wie stark sich das institutionelle Gefüge im Dreieck Brüssel-Luxemburg-Straßburg in der näheren Zukunft supranationalisiert.
Abhängig ist das EP dabei jedoch von der Entwicklung der europäischen Fraktionen. Unter den europäischen Fraktionen findet eine in ihrer Ausgestaltung stark divergierende Internationalisierung statt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen einer institutionell hervorgerufenen Supranationalisierung und der realen – sofern vorhandenen – Paneuropäisierung der internationalen Organe. Als zu analysierende Institutionen dienen das EP einerseits und die europäischen Parteien andererseits. Auf einen ersten theoretischen Teil, in dem die Unterschiede zwischen Fraktionen und Parteien geklärt werden sowie eine Typologisierung und Einordnung von Parteien vorgenommen wird, folgt eine Analyse, die sich vor allem mit der Frage auseinandersetzt, wie erstrebenswert eine Paneuropäisierung der Parteien in Bezug auf eine erhöhte Effektivität des EP eigentlich ist. Dabei soll insbesondere beobachtet werden, welche Parteien in Folge der zuvor vorgenommen Typologisierung sich mit einer Transnationalisierung leichter bzw. schwerer tun.
Die Ausgangsthese der Autorin lautet, dass es kleinen und modernen1 Parteien leichter fällt, sich zu paneuropäisieren als großen, etablierten Parteien. Die Anzahl ihrer Mitglieder und die Nutzung moderner Netzwerke spielt in Folge dieser These eine gewichtigere Rolle für eine potenzielle Paneuropäisierung als die politikinhaltliche Ausrichtung der Partei. Nicht zuletzt soll aber auch untersucht werden, ob eine Paneuropäisierung der Parteien für eine supranationale Zukunft der Europäischen Union überhaupt notwendig ist.
Als empirisches Beispiel wird im 4. Kapitel die Piratenpartei angeführt. Da es sich ihrem Selbstverständnis zufolge bei ihr bereits um eine internationale Partei handelt, kann anhand ihrer Organisation und Struktur untersucht werden, inwiefern eine „paneuropäische Partei“ zu einer stärker supranationalen Ausrichtung des EP beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Das Europäische Parlament.
- Geschichte..
- Der Maastrichter Vertrag 1992
- Der Amsterdamer Vertrag 1999
- Der Vertrag von Nizza 2003
- Der Vertrag von Lissabon 2009
- Aufbau und Funktionen
- Aufbau
- Funktionen
- Demokratiedefizite des Parlaments.
- Die europäischen Fraktionen...
- Die Fraktionen im Europäischen Parlament
- Die Europäische Volkspartei.
- Die Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament..
- Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE).
- Grüne/ Europäische Freie Allianz..
- Weitere Fraktionen.........
- Funktionen der Fraktionen.
- Was unterscheidet Fraktionen von Parteien?
- Parteien
- Typologisierung von Parteien
- Wann ist eine Partei eine „Kleinpartei\"?
- Die Piratenpartei – eine paneuropäische Partei?
- Parteiprogramm…...
- Erhöhte Internationalisierungschancen der Piratenpartei?
- SCHLUSSBETRACHTUNG..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob das Europäische Parlament als Katalysator für eine Paneuropäisierung von Parteien dienen kann. Sie analysiert die Wechselwirkung zwischen einer institutionell hervorgerufenen Supranationalisierung der Europäischen Union und der realen Paneuropäisierung von Parteien. Insbesondere wird untersucht, welche Parteien sich aufgrund ihrer Größe, Struktur und politischen Ausrichtung leichter oder schwerer paneuropäisieren lassen.
- Die Rolle des Europäischen Parlaments als Institution im Kontext der Supranationalisierung der Europäischen Union
- Die Herausforderungen und Chancen der Paneuropäisierung von Parteien
- Die Analyse der europäischen Fraktionen und ihrer unterschiedlichen Internationalisierungsgrade
- Die Typologisierung von Parteien und die Frage, welche Parteien sich leichter paneuropäisieren lassen
- Die Piratenpartei als empirisches Beispiel für eine paneuropäische Partei
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Paneuropäisierung von Parteien im Kontext der supranationalen Entwicklung der Europäischen Union ein und stellt die Forschungsfrage und die These der Autorin dar. Das zweite Kapitel beleuchtet das Europäische Parlament als Institution und dessen Rolle im supranationalen System der EU. Dabei wird auf die Geschichte des Parlaments, seine Struktur und Funktionen sowie die Herausforderungen durch Demokratiedefizite eingegangen. Das dritte Kapitel widmet sich den europäischen Fraktionen, ihren Funktionen und dem Unterschied zu nationalen Parteien. Im vierten Kapitel erfolgt eine Typologisierung von Parteien mit besonderer Berücksichtigung der Frage, wann eine Partei als "Kleinpartei" betrachtet werden kann. Das fünfte Kapitel stellt die Piratenpartei als empirisches Beispiel für eine paneuropäische Partei vor und analysiert deren Programm, Struktur und Möglichkeiten zur Internationalisierung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Europäisches Parlament, Paneuropäisierung, Parteien, Fraktionen, supranationale Integration, Transnationalisierung, Kleinparteien, Piratenpartei, Europa der zwei Geschwindigkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hatte der Vertrag von Lissabon auf das Europäische Parlament?
Er führte zu einer massiven Kompetenzerweiterung und stärkte die Rolle des Parlaments im supranationalen Gefüge der EU.
Was ist der Unterschied zwischen europäischen Fraktionen und Parteien?
Fraktionen sind Zusammenschlüsse von Abgeordneten im Parlament zur politischen Arbeit, während europäische Parteien eher lose Dachverbände nationaler Parteien sind.
Warum dient die Piratenpartei als Beispiel für eine paneuropäische Partei?
Aufgrund ihres internationalen Selbstverständnisses und der Nutzung moderner Netzwerke gilt sie als Modell für eine grenzüberschreitende Parteistruktur.
Fällt kleinen Parteien die Paneuropäisierung leichter?
Die These der Arbeit lautet, dass kleine, moderne Parteien sich leichter transnational organisieren können als große, etablierte Parteiapparate.
Was sind die "Demokratiedefizite" des Europäischen Parlaments?
Trotz Kompetenzgewinn wird oft kritisiert, dass die Verbindung zwischen Wählern und den supranationalen Entscheidungen in Brüssel noch zu schwach ist.
- Quote paper
- Isabelle Daniel (Author), 2010, Das Europäische Parlament als Katalysator für eine Paneuropäisierung der Parteien? Transnationalisierungschancen europäischer Parteien am Beispiel der Piratenpartei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163388