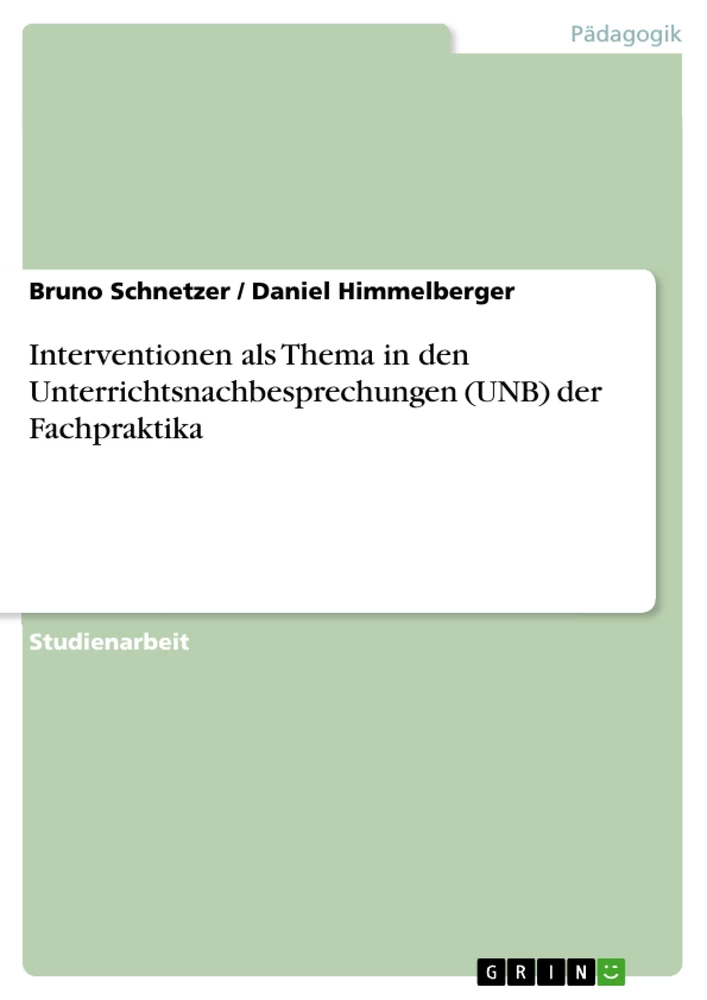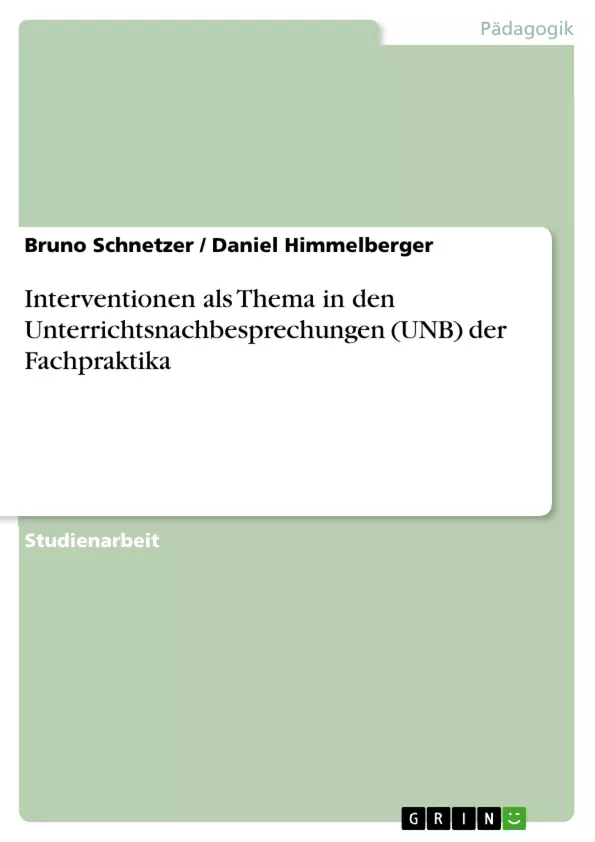Untersuchungen aus verschiedensten Ländern zeigen, dass die Belastung der Lehrpersonen im Zusammenhang mit Disziplinschwierigkeiten gross ist. Gewöhnlich ist auch nicht der fachliche Aspekt des Unterrichtens die anspruchvollste Aufgabe, sondern die Führung und der Umgang mit der Klasse. Die Autoren, Bruno Schnetzer und Daniel Himmelberger, sind als Praxislehrkräfte der Pädagogischen Hochschule Bern tätig und begleiten seit Jahren Lehramtsstudierende in den Fachpraktika an der Sekundarstufe 1 in Zollikofen. Ihrer Vermutung, wonach das Thema Interventionen bei den Unterrichtsnachbesprechungen mit den Studierenden stiefmütterlich behandelt wird, gehen sie in ihrer Zertifikatsarbeit nach.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung – Persönlicher Bezug
2 Begriffsdefinitionen
2.1 Interventionen
2.2 Störungen im Unterricht
3 Empirische Studie zu Unterrichtsnachbesprechungen (UNB) in der Lehrerbildung
3.1 Die Unterrichtsnachbesprechung in den Lehrpraktika Eine <<Nahtstelle von Wissen und Handeln>>? von Jürg Schüpbach (2005)
3.1 Eigene Fragestellung
4 Methodische Überlegungen
4.1 Auswahl und Entwicklung der Erhebungsinstrumente
4.1.1 Der Fragebogen
5 Das Fallbeispiel: Die Sekundarstufe I Zollikofen – eine Partnerschule der PH Bern
5.1 Eckdaten zu unserer Schule
5.2 Unterrichtsnachbesprechungen an der Sekundarstufe I Zollikofen
6 Ergebnisse
6.1 Die Praktikumsart und die Geschlechterverteilung
6.2 Die Einschätzung der Praktikumsbetreuung
6.3 Verbesserungsvorschläge zur Betreuung der Fachpraktika
6.4 Die Thematisierungshäufigkeit von Interventionen in den UNB
6.5 Der Stellenwert des Themas „Interventionen“
6.6 Der zeitliche Anteil für Interventionen während der UNB
6.7 Die erbrachte Aufmerksamkeit gegenüber den Interventionen in den UNB
6.8 Vorwiegende Interventionsarten
6.9 Häufigkeit der besprochenen Interventionsarten
6.10 Die Art der Thematisierung von Interventionen
6.11 Die Eignung der Thematisierungsarten für Interventionen
7 Fazit
8 Abstract
9 Schlussbemerkungen
10 Literaturverzeichnis
11 Anhang
1 Einleitung – Persönlicher Bezug
Ausgehend von unserer Tätigkeit als Praxislehrkräfte an der Sekundarstufe I Zollikofen (7.-9. Schuljahr Real und Sek) und unseren Literaturrecherchen nach dem Workshop „Interventionen in schwierigen Situationen“ mit Beatrice Sutter, haben wir uns entschlossen als Team das Thema „Interventionen als Gegenstand der Unterrichtsnachbesprechungen im Fachpraktikum an der Sekundarstufe I Zollikofen“ zu bearbeiten.
Daniel Himmelberger unterrichtet an der Sek. I Zollikofen gegenwärtig an einer 9. Realklasse, welche sehr heterogen und multikulturell zusammengesetzt ist. 9 von 20 Schulkindern stammen aus dem arabischen Sprachraum und gehören von ihrer Religionszugehörigkeit dem muslimischen Glauben an. Die Arbeit als Klassenlehrer beinhaltet nebst dem Vermitteln von Fachkompetenz vor allem auch das Erarbeiten einer möglichst entwicklungsfördernder Selbst- und Sozialkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern.
Bruno Schnetzer unterrichtet an vier verschiedenen Sekundarschulklassen das Fach Mathematik und arbeitet dort vorwiegend als Fachlehrkraft. Diese Klassen sind etwas homogener zusammengesetzt und Verständigungsschwierigkeiten und Störungen stehen nicht im Vordergrund. Aber auch bei ihm stellt sich immer wieder die Frage, inwiefern die Selbst- und die Sozialkompetenz als unabdingliche Grundlage für einen erfolgreichen Unterricht vorausgesetzt werden können und inwiefern Interventionen im Unterricht angebracht sind, um die Zielsetzungen der Lehrkraft zu erreichen.
Hans-Peter Nolting (2002, S. 29) schreibt in der Einleitung zu seinem Werk Störungen in der Schulklasse – ein Leitfaden zur Vorbeugung und Konfliktlösung: „Das grösste Problem für Lehrerinnen und Lehrer ist gewöhnlich nicht das unterrichten der eigenen Fächer, sondern der Umgang mit der Klasse. Zugleich ist dies aber die Aufgabe, auf die in der Ausbildung am wenigsten vorbereitet wird. So bleibt denn auch der Umgang mit „Störungen“ weitgehend dem persönlichen Temperament und Gutdünken der jeweiligen Lehrkraft überlassen und wird viel zu wenig von professionellen Kenntnissen und Fertigkeiten bestimmt.“
Als Zielsetzung für unsere Arbeit haben wir uns auf die Beantwortung der Frage konzentriert, inwiefern Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen an der Sekundarstufe I Zollikofen thematisiert und reflektiert werden. Wir wollen aufzeigen, welchen Stellenwert sie dabei einnehmen.
Aufgrund unserer Erfahrung im Unterrichten haben wir über Jahre hinweg festgestellt, dass auch oder gerade in den Fachpraktika Interventionen oft nötig sind, um den Unterricht förderorientiert zu gestalten. Zugleich ist es eine Tatsache, dass bei den Besprechungen mit den Studentinnen und Studenten das Thema Interventionen oft stiefmütterlich behandelt wird und gerne dem Gutdünken und dem persönlichen Unterrichtsstil der einzelnen Lehrkraft überlassen wird. Hier möchten wir ansetzen und unsere Untersuchungen anstellen. Uns interessiert vor allem der Umgang mit Störungen und Widerständen in den Klassen. Bei den Unterrichtsnachbesprechungen der Fachpraktika 1 und 2 stellen wir oft fest, dass der grösste Teil der Zeit für fachliche und methodische Aspekte verwendet wird und Störungen und diesbezügliche Interventionen nur am Rande thematisiert werden. Es gibt offenbar eine gewisse Handlungsunsicherheit, jede Lehrkraft reagiert bei ähnlichen Vorfällen unterschiedlich, es existiert kaum ein Konsens und Interventionen werden zwischen den Lehrkräften nur wenig abgesprochen und obliegen dem individuellen Gutdünken. Gewöhnlich ist aber nicht der fachliche Aspekt des Unterrichtens die anspruchsvollste Aufgabe, sondern die Führung und der Umgang mit der Klasse. Hier sehen wir Handlungsbedarf. Wir sind der Meinung, dass diesem Thema bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde.
Jürg Rüedi (2007, S. 19) schreibt in seinem Buch Disziplin in der Schule: „Wie gross die Belastung der Lehrpersonen im Zusammenhang mit Disziplinschwierigkeiten ist, zeigen Untersuchungen aus den verschiedensten Ländern. Schon 1980 bezeichneten Lehrpersonen in den USA den Umgang mit undisziplinierten Kindern als eine der Hauptquellen für ihr Ausbrennen (vgl. BARTH 1997, S. 105). Dass Disziplinschwierigkeiten auch rund zwanzig Jahre später ein belastendes Thema bleiben, zeigt die vom Lehrerverband (1998) durchgeführte schriftliche Befragung. Zwei Drittel der befragten Lehrpersonen gaben an, dass sie nach der Arbeit nicht abschalten können, sondern dass sie von den Disziplinschwierigkeiten in der sogenannten Freizeit begleitet, ja verfolgt werden.“
Die Ergebnisse dieser Befragung werfen viele Fragen auf: Etwa ob die Lehrkräfte heute die Versäumnisse der Gesellschaft gutmachen müssen? – Oder ob sie erzieherische Arbeit leisten müssen, die eigentlich von den Eltern übernommen werden sollte? – Vielleicht werden die Lehrkräfte auch zu wenig unterstützt? – Wie können sich die Lehrkräfte effizient dagegen wehren? - Welche Art von Interventionen können sie im Unterricht einsetzen, damit das Lernklima gut bleibt und die Schwierigkeiten bei der Klassenführung nicht überhand nehmen?
Als mögliche Hypothesen haben wir folgende Sätze aufgestellt:
- Interventionen werden im Fachpraktikum nur marginal thematisiert.
- Es herrscht eine grosse Handlungsunsicherheit bezüglich Interventionen im Unterricht.
- Das Interventionsspektrum ist oft auf wenige Massnahmen eingeschränkt.
- Im Studienplan der PHBern werden Interventionen im Zusammenhang mit der Unterrichtsführung / Klassenführung nur am Rande thematisiert.
Daraus resultierten folgende Fragestellungen:
- Inwiefern werden Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen thematisiert und reflektiert?
- Welche Interventionsmöglichkeiten werden von den Praxislehrkräften bzw. Praktikantinnen und Praktikanten angewendet?
- Inwiefern sind „Interventionen“ im Studienplan der PHBern vorgesehen?
Aus diesen drei Fragestellungen haben wir schliesslich eine eingrenzende Fragestellung für unsere Arbeit herausdestilliert.
Sie lautet wie folgt: Inwiefern werden Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen an der Sekundarstufe I Zollikofen thematisiert und reflektiert?
Als Verfahren zur Datenerhebung haben wir vor allem Problemzentrierte Interviews mit den Praxislehrkräften der Sekundarstufe I Zollikofen eingesetzt. Auch ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten kommen dabei zu Wort. Hierbei wurden halbstrukturierte Befragungen unter Zuhilfenahme eines Interviewleitfadens durchgeführt. Die Auswertung der Interviewprotokolle erfolgte mit Hilfe der „Qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring (2003).
Zwecks Triangulation verschiedener Zugänge haben wir ergänzend zu den Problemzentrierten Interviews mit den Praxislehrkräften der Sekundarstufe I Zollikofen auch noch Fragebögen an ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten eingesetzt.
Mit unserer Arbeit zum Thema Interventionen möchten wir einen Beitrag zur Behebung unserer alltäglichen Schwierigkeiten im Umgang mit Störungen in der Klasse leisten und zeigen wie wichtig es ist dieses Thema bei den Unterrichtsnachbesprechungen mit den Studentinnen und Studenten aufzugreifen. Nur wer bewusst mit Störungen im Unterricht umgehen kann und diese richtig einzuschätzen vermag, kann auch entsprechend professionell darauf reagieren und die Interventionen so einsetzen, dass sie dem Unterricht nachhaltig verbessern. Und dies ist von uns aus gesehen ein pädagogisch sinnvolles Ziel: Interventionen nicht als kurzfristige Feuerwehrübung, sondern als überlegte und nachhaltige Massnahmen für einen gut reflektierten Unterricht.
2 Begriffsdefinitionen
In der Folge befassen wir uns näher mit „Interventionen“ als Thema in Unterrichtsnachbesprechungen (UNB). Es soll daher zuerst eine Begriffsklärung stattfinden, um den Gegenstandsbereich abzustecken.
Zum Thema Interventionen gibt es verschiedene Begriffsdefinitionen, die einerseits im Bildungswesen und andererseits aber auch im völkerrechtlichen Sinne verwendet werden.
Wir beschränken uns in unserer Zertifikatsarbeit auf die Begriffsverwendung im sozialen Bereich, insbesondere im Bildungswesen, wo wir uns im Speziellen für die Interventionen in den Unterrichtsnachbesprechungen (UNB) interessieren.
2.1 Interventionen
Im Wörterbuch für Erziehung und Unterricht von Köck & Ott (1997, S. 338) wird die soziale Intervention wie folgt definiert: „Die soziale Intervention stellt die entsprechende Übertragung des Begriffes auf soziale Kleingebilde wie Kleingruppen, Klassen, Arbeitsteams usw. dar. Vor allem der Erzieher ist von seinem pädagogischen Auftrag her zu sozialen Interventionen legitimiert, es ist aber ebenso seiner pädagogischen Verantwortung anheimgestellt, seine Interventionen auf das notwendige Mindestmass zu beschränken, wenn sein Engagement nicht in Gängelung umschlagen soll. Eine spezielle Bedeutung kommt der sozialen Intervention bei gruppendynamischen Trainingsmethoden und bei psychotherapeutischen Massnahmen zu. Sie bezeichnet hier das weiterführende, klärende Eingreifen und Denkanstösse des Trainers bzw. Psychotherapeuten.“
Eine andere Definition des Begriffs Intervention finden wir im Pädagogik-Lexikon von Reinhold, Pollak und Heim (1999, S. 277). Diese Definition ist in zwei Teile gegliedert, wobei der erste Teil eine wie eine Gebrauchsanweisung klingt, wie eine Intervention zu gebrauchen ist:
„Intervention meint ein bewusstes, zielgerichtetes Eingreifen, das in fünf Schritten abläuft:
- Problemerfassung
- Informationssammlung
- Methodenwahl
- Methodenanwendung
- Auswertung
Intervention zielt auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmalen von Individuen oder von Strukturen, Normen und sozioökonomischen Bedingungen (sozialer) Felder ab.“
Eine ausführliche dritte Begriffsdefinition von Interventionen stammt aus dem dtv-Wörterbuch zur Psychologie von Fröhlich (1993, S. 225f) und ist in mehrere Teile gegliedert:
„(1) Allgemeine Bezeichnung für Massnahmen, die durch gezieltes Eingreifen in Organismen, soziale oder technische Systeme dem Auftreten von Störungen vorbeugen, Störungen beheben und/oder ihre Folgen eindämmen sollen. In der medizinischen und psychologischen Gesundheitsversorgung zählen hierzu neben Therapie bzw. Psychotherapie alle Massnahmen der Prävention und Rehabilitation.
(2) Als psychologische Intervention (psychological intervention) gelten alle Massnahmen, die mit psychologischen Mitteln das Erleben und Verhalten ansprechen und durch den Abbau von Störungen bei gleichzeitigem Aufbau positiver Einstellungen (z.B. Ichstärke, Kontrollüberzeugungen) sowie kreativer, kommunikativer und sozialer Fähigkeiten der Förderung von Gesundheit, harmonischem Zusammenleben, Wohlbefinden und Zufriedenheit dienen. […]
In der Pädagogischen Psychologie schliesslich gelten als Intervention z.B. Massnahmen zur Verbesserung von Bedingungen des Lehrens und Lernens.“
In unserer Zertifikatsarbeit interessieren wir uns insbesondere für die Interventionen im schulischen Bereich, insbesondere im Fachpraktikum. Dort sind die Begriffsdefinitionen ziemlich allgemein gehalten und bedürfen je nach Problemstellung weiterer Erklärungen. Aus Erfahrung wissen wir, dass jede Störung im Unterricht anders ist und wegen ihrer Komplexität per Definition oft nur schwer einzugrenzen und zu verstehen ist.
Gemäss Reinhold, Pollak und Heim (1999, S. 277) können wir Interventionen als „ein bewusstes, zielgerichtetes Eingreifen“ verstehen. Dieses verläuft in fünf Schritten: Problemerfassung, Informationssammlung, Methodenwahl, Methodenanwendung und Auswertung. „Intervention zielt dabei auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmalen von Individuen oder von Strukturen.“
Auch bei Fröhlich (1993, S. 225) wird Intervention allgemein als „ gezieltes Eingreifen“ definiert, um dem Auftreten von Störungen vorzubeugen, Störungen zu beheben und/oder ihre Folgen einzudämmen. Speziell in der Pädagogischen Psychologie als „ Massnahmen zur Verbesserung von Bedingungen des Lehrens und Lernens.“
Der Begriff wird auch bei Köck & Ott (1997, S. 338) als „klärendes Eingreifen“ aufgeführt.
Zusammenfassend verstehen wir unter Intervention ein bewusstes, zielgerichtetes Eingreifen, das Störungen vorbeugen, Störungen beheben und/oder ihre Folgen eindämmen und dadurch zur Verbesserung der Bedingungen des Lehrens und Lernens führen soll.
2.2 Störungen im Unterricht
In der Literatur finden wir diverse Definitionen für Unterrichtsstörungen, so zum Beispiel nach Winkler (2005): „Eine Unterrichtsstörung liegt dann vor, wenn der Unterricht gestört ist, d.h. wenn das Lehren und Lernen stockt, aufhört, pervertiert, unerträglich oder inhuman wird.*
Hierbei sind verschiedene Formen von Unterrichtsstörungen zu unterscheiden. Grob können diese in folgende drei Bereiche unterteilt werden:
1. Unterrichtsstörungen, die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern resultieren (z.B. Zwischenrufe, Drohungen, verbale Konflikte, Obszönitäten).
2. Unterrichtsstörungen, die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen der Lehrkräfte resultieren (z.B. uninteressanter und nicht abwechslungsreicher Lehrstil, ungerechte Behandlung, ironische oder sarkastische Bemerkungen).
3. Unterrichtsstörungen, die durch äussere Ereignisse entstehen (z.B. schlechte Raum und Medienausstattung, Lärm von ausserhalb, extreme Wetterlage).
In unserer Arbeit interessieren wir uns ausschliesslich für Unterrichtsstörungen der ersten Art, solche die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern resultieren. Es handelt sich um disziplinarisch e Störungen, die aus einem nicht lernbezogenen Verhalten entspringen.
Weshalb beschränken wir uns auf den ersten Bereich?
Aufgrund unserer beruflichen Erfahrung vermuten wir, dass disziplinarische Störungen (1. Bereich) in den UNB nur beschränkt oder gar nicht thematisiert werden, währenddessen die beiden letzteren Bereiche in der Regel ausgiebig zur Sprache kommen.
Viele Lehrpersonen leiden vermehrt unter Disziplinschwierigkeiten an den Schulen. Da Disziplinlosigkeit, fehlender Respekt und die daraus folgenden Störungen unseren Unterricht stark beeinträchtigen, werden wir uns in dieser Arbeit gerade diesem Aspekt der disziplinarischen Störungen im Unterricht zuwenden. Auch im Wissen darum, dass solche Störungen nie vollständig behoben werden können wie bereits Wilhelm Busch in Max und Moritz geschrieben hat:
„Menschen necken, Tiere quälen,
Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen,
Das ist freilich angenehmer
Und dazu auch viel bequemer,
als in Kirche oder Schule
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, inwiefern Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen an der Sekundarstufe I Zollikofen thematisiert und reflektiert werden. Die Arbeit soll aufzeigen, welchen Stellenwert diese Thematik einnimmt.
Welche Hypothesen werden in dieser Arbeit aufgestellt?
Folgende Hypothesen werden aufgestellt:
- Interventionen werden im Fachpraktikum nur marginal thematisiert.
- Es herrscht eine grosse Handlungsunsicherheit bezüglich Interventionen im Unterricht.
- Das Interventionsspektrum ist oft auf wenige Massnahmen eingeschränkt.
- Im Studienplan der PHBern werden Interventionen im Zusammenhang mit der Unterrichtsführung / Klassenführung nur am Rande thematisiert.
Welche Fragestellungen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Fragen:
- Inwiefern werden Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen thematisiert und reflektiert?
- Welche Interventionsmöglichkeiten werden von den Praxislehrkräften bzw. Praktikantinnen und Praktikanten angewendet?
- Inwiefern sind „Interventionen“ im Studienplan der PHBern vorgesehen?
Wie lautet die eingrenzende Fragestellung?
Die eingrenzende Fragestellung lautet: Inwiefern werden Interventionen aus dem Unterricht des Fachpraktikums während der Unterrichtsnachbesprechungen an der Sekundarstufe I Zollikofen thematisiert und reflektiert?
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung eingesetzt?
Zur Datenerhebung wurden vor allem problemzentrierte Interviews mit den Praxislehrkräften der Sekundarstufe I Zollikofen eingesetzt. Auch ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten kommen dabei zu Wort. Ergänzend wurden Fragebögen an ehemalige Praktikantinnen und Praktikanten verwendet.
Wie werden Interventionen in dieser Arbeit definiert?
Unter Intervention wird ein bewusstes, zielgerichtetes Eingreifen verstanden, das Störungen vorbeugen, Störungen beheben und/oder ihre Folgen eindämmen und dadurch zur Verbesserung der Bedingungen des Lehrens und Lernens führen soll.
Welche Arten von Unterrichtsstörungen werden in dieser Arbeit betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Unterrichtsstörungen, die aus Eigenschaften und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern resultieren (disziplinarische Störungen).
Warum wird der Fokus auf disziplinarische Störungen gelegt?
Es wird vermutet, dass disziplinarische Störungen in den Unterrichtsnachbesprechungen nur beschränkt oder gar nicht thematisiert werden, während andere Arten von Störungen (z.B. solche, die aus dem Verhalten der Lehrkräfte oder äusseren Ereignissen resultieren) ausführlicher besprochen werden.
- Citar trabajo
- Bruno Schnetzer (Autor), Daniel Himmelberger (Autor), 2010, Interventionen als Thema in den Unterrichtsnachbesprechungen (UNB) der Fachpraktika, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163408