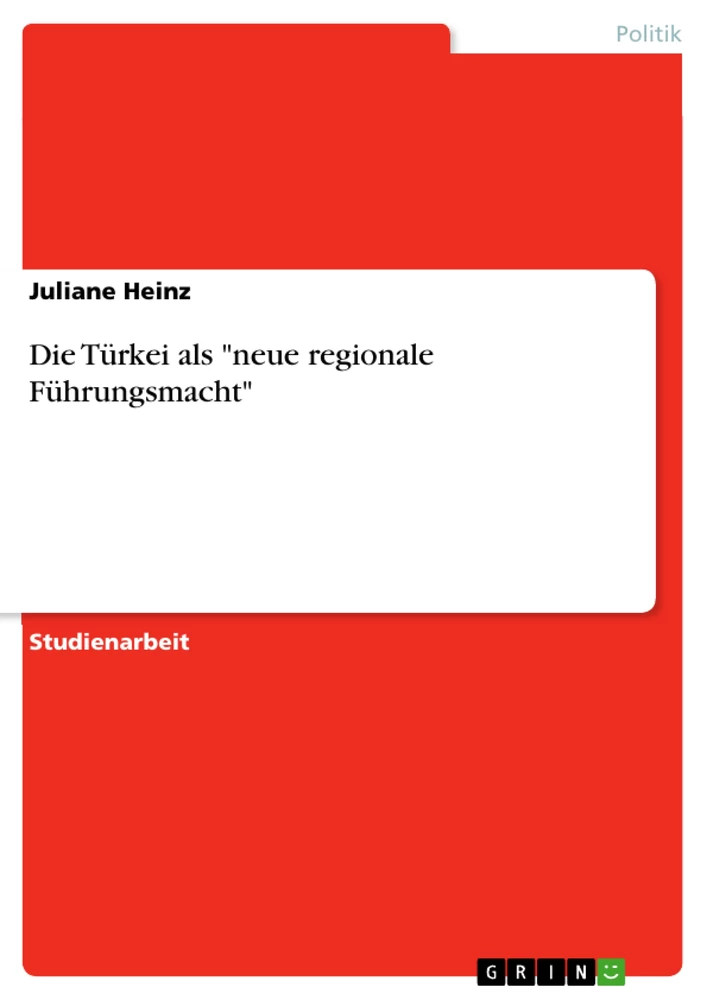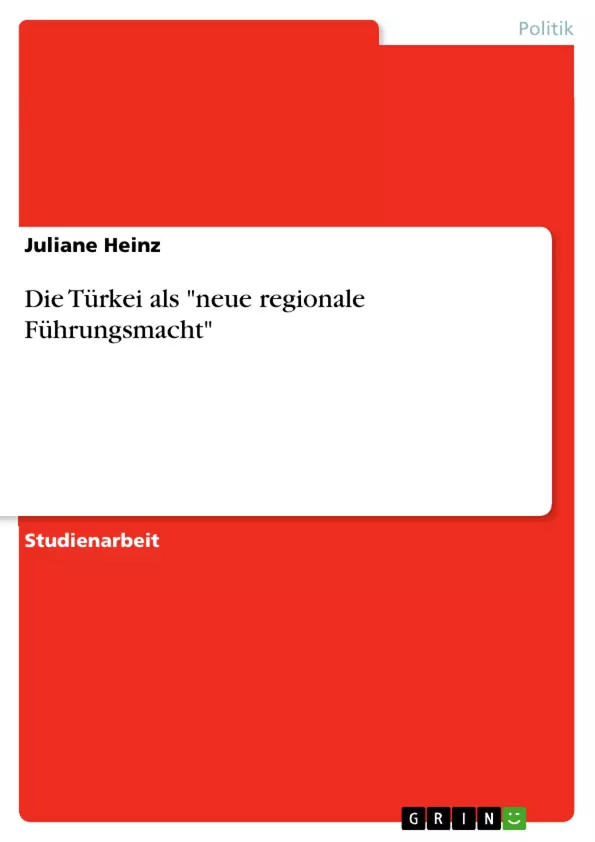Die internationalen Beziehungen sind von vielfältigen Mächtekonstellationen geprägt. Seit dem Ende der Ost-West Konfrontation gab es eine globale Machtverschiebung, mit der Konsequenz, dass die Vereinigten Staaten von Amerika als die einzige Supermacht verblieben. Parallel dazu gewannen anderen Staaten an Einfluss und wiederum andere verloren an Einfluss. In der Geschichte gab es schon immer eine Differenzierung zwischen Groß- und Mittelmächten sowie das Bestreben danach, Machthierarchien im internationalen System zu deklarieren. Zu Zeiten der Globalisierung kann die USA als einzige Supermacht nicht mehr alle Probleme allein lösen; sie braucht Kooperationspartner in den verschiedenen Regionen der Welt. Findet sie einen diesen Kooperationspartner in der Türkei?
Das Ziel der folgenden Arbeit soll darin bestehen, das Konzept der regionalen Führungsmacht vorzustellen, und dieses anhand der Türkei zu prüfen. Dementsprechend habe ich die Arbeit folgendermaßen aufgebaut: der Einleitung folgt eine kurze Darstellung der innenpolitischen Lage in der türkischen Republik seit dem Amtsantritt der AKP-Regierung 2002. Anschließend wird in Kapitel 3 umfassend auf die Außenpolitik eingegangen, vor allem auf aktuelle Entwicklungen. Dazu wird das Konzept der strategischen Tiefe von Außenminister Davutoglu vorgestellt. Zudem werden die Beziehungen mit einzelnen wichtigen Nachbarstaaten, Regionen und anderen wichtigen Akteuren wie den USA und der EU dargestellt. Anschließend prüfe ich in Anlehnung an den Kriterien von Detlef Nolte in Kapitel 5, ob und inwieweit man von der Türkei als regionale Führungsmacht sprechen kann oder ob es noch andere Konzepte gibt, in die die Türkei sich einordnen lässt.
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nahm die internationale Debatte über die Rolle der türkischen Republik als zivilisatorisches Entwicklungsmodell für die Modernisierung der Region des Nahen und Mittleren Ostens und als kulturelle Brücke zwischen dem ‚Westen‘ und der ‚islamischen Welt‘ zu. Der Forschungsstand speziell zur Türkei als ‚neuer regionaler Führungsmacht‘ ist jedoch sehr dünn bestückt. Primär ist die Literatur auf die EU oder den Modellcharakter der Türkei ausgerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Innenpolitik
- Außenpolitik
- Das Konzept der strategischen Tiefe
- Die Nahostpolitik
- Syrien
- Irak
- Israel
- Iran
- Die Turkstaaten und der Kaukasus
- Die Vereinigten Staaten von Amerika
- Die Europäische Union
- Merkmale einer regionalen Führungsmacht und das Konzept von Detlef Nolte
- Die innere Dynamik des Staates
- Ein Teil einer abgegrenzten Region
- Der Anspruch auf die Führungsrolle/ Selbstverständnis
- Der Einfluss auf andere Staaten
- Die Anerkennung der Führungsrolle von anderen Staaten
- Die Ressourcen für die regionale Machtprojektion
- Militärische Ressourcen
- Ökonomische Ressourcen
- Die regionale Vernetzung
- Die Herausbildung einer regionalen Identität
- Die regionale Sicherheitsagenda maßgeblich definieren
- Die Einbindung in globale Zusammenschlüsse
- Hindernisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Türkei als „neue regionale Führungsmacht“ betrachtet werden kann. Dazu wird zunächst das Konzept der regionalen Führungsmacht vorgestellt und anschließend anhand der Türkei geprüft. Die Arbeit analysiert die innenpolitische Lage der Türkei und beleuchtet die Außenpolitik mit besonderem Fokus auf aktuelle Entwicklungen, das Konzept der strategischen Tiefe und die Beziehungen zu wichtigen Nachbarstaaten, Regionen und anderen wichtigen Akteuren. Anhand der Kriterien von Detlef Nolte wird schließlich untersucht, ob die Türkei die Merkmale einer regionalen Führungsmacht erfüllt.
- Analyse der innenpolitischen Lage der Türkei
- Darstellung der türkischen Außenpolitik
- Einordnung der Türkei in das Konzept der strategischen Tiefe
- Beurteilung der Türkei anhand der Kriterien für eine regionale Führungsmacht
- Identifizierung möglicher Herausforderungen für die Türkei als potentielle Führungsmacht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit skizziert den Kontext der internationalen Beziehungen, die durch vielfältige Mächtekonstellationen geprägt sind. Im Fokus steht die Frage, ob die Türkei eine neue Rolle als regionale Führungsmacht einnehmen kann. Im zweiten Kapitel wird die innenpolitische Lage der Türkei seit dem Amtsantritt der AKP-Regierung im Jahr 2002 beleuchtet. Es werden wichtige Entwicklungen, wie die Verfassungsänderungen und die Rolle des Militärs, dargestellt.
Kapitel 3 widmet sich umfassend der türkischen Außenpolitik und analysiert das Konzept der strategischen Tiefe, das von Außenminister Davutoglu entwickelt wurde. Die Beziehungen zu einzelnen wichtigen Nachbarstaaten wie Syrien, Irak, Israel und Iran, sowie zu Regionen wie den Turkstaaten und dem Kaukasus werden näher betrachtet. Außerdem werden die Beziehungen zu den USA und der EU beleuchtet.
Im vierten Kapitel werden die Merkmale einer regionalen Führungsmacht anhand der Kriterien von Detlef Nolte analysiert und auf die Türkei angewendet. Es werden die innere Dynamik des Staates, die Ressourcen für die regionale Machtprojektion und die regionale Vernetzung der Türkei untersucht.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Türkei und dem Konzept der regionalen Führungsmacht. Im Mittelpunkt stehen Themen wie die innenpolitische Situation, die Außenpolitik, die strategische Tiefe, die Beziehungen zu wichtigen Nachbarstaaten und die Rolle der Türkei als potentielle Führungsmacht in der Region. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören Türkei, regionale Führungsmacht, strategische Tiefe, Nahostpolitik, Turkstaaten, USA, EU und Detlef Nolte.
Häufig gestellte Fragen
Ist die Türkei eine neue regionale Führungsmacht?
Die Arbeit prüft dies anhand der Kriterien von Detlef Nolte und analysiert die innen- und außenpolitische Dynamik der Türkei seit der Regierungsübernahme der AKP im Jahr 2002.
Was bedeutet das Konzept der „strategischen Tiefe“?
Das von Ahmet Davutoğlu entwickelte Konzept zielt darauf ab, die historische und geografische Lage der Türkei zu nutzen, um eine aktive und multidimensionale Außenpolitik zu führen.
Welche Rolle spielt die Türkei im Nahen Osten?
Die Arbeit beleuchtet die Beziehungen zu Syrien, Irak, Israel und dem Iran sowie den Anspruch der Türkei, als kulturelle Brücke zwischen dem Westen und der islamischen Welt zu fungieren.
Welche Kriterien definieren eine regionale Führungsmacht?
Dazu gehören unter anderem militärische und ökonomische Ressourcen, der Anspruch auf Führung, die regionale Vernetzung und die Anerkennung durch andere Staaten.
Welche Hindernisse gibt es für den Führungsanspruch der Türkei?
Es werden interne Dynamiken, Spannungen in der Region und die komplexen Beziehungen zu Supermächten wie den USA und der EU als potenzielle Herausforderungen identifiziert.
- Arbeit zitieren
- B.A. Juliane Heinz (Autor:in), 2009, Die Türkei als "neue regionale Führungsmacht", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163446