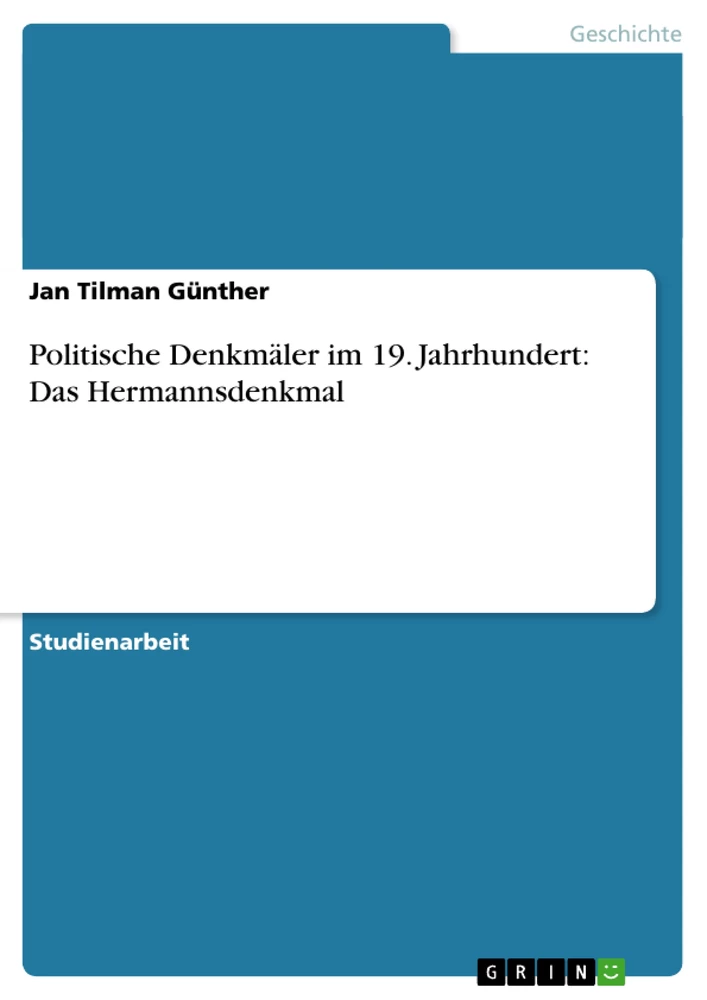Politische Denkmäler im 19. Jahrhundert:
Das Hermannsdenkmal
1. Einleitung
„Er hat die Stadt zum Erben eingesetzt“, erklärte Doktor Scheffelweis wichtig. „Wahrscheinlich bauen wir von dem Geld ein Säuglingsheim.“
„Bauen Sie?“ Diederich feixte verachtungsvoll. „Einen nationaleren Zweck können sie sich wohl nicht denken?“
Heinrich Mann: Der Untertan (1916)
Das 19. Jahrhundert war ein „Jahrhundert der Denkmäler“, nicht nur in Deutschland. Denkmäler galten allgemein als Medien politischer Inhalte, die dauerhaft und öffentlich transportiert werden sollten. Denkmäler beschwören kulturelle und politische Inhalte aus einer mythischen Vergangenheit, schreiben die symbolischen Sinnzusammenhänge in die Gegenwart fort und haben den Anspruch, auch noch in die fernere Zukunft zu wirken. Insbesondere nach 1871 setzte eine regelrechte „Denkmalwuth“ ein, die im Sinne des nation buildings die innere Einheit des jungen deutschen Kaiserreichs symbolisch vorantreiben sollte. „Nationen sind geistige Wesen, Gemeinschaften, die existieren, solange sie in den Köpfen und Herzen der Menschen sind, und die erlöschen, wenn sie nicht mehr gedacht und gewollt werden [...]“ (Schulze 1994, 110). Analog zur Nation gilt für die nationalpolitischen Denkmäler: Die Integration gelingt nur soweit, wie sich die Staatssubjekte freiwillig der Idee anschließen. Die hierbei wirksamen Mechanismen von Inklusion und Ausschluss lassen sich an den Denkmälern selbst, stärker jedoch an der überlieferten Rezeption und Deutung der Zeitgenossen analysieren. Hier liegt der Interessenschwerpunkt der jüngeren Forschung. In welcher Weise werden Mythen gedeutet und in symbolische Politik umgewandelt, welcher soziale Raum wird durch die Denkmäler geschaffen, welche Nation konstituiert sich in welcher Weise? Diese Fragestellung soll auch die vorliegende Arbeit leiten, der Schwerpunkt liegt deshalb auf der politischen Öffentlichkeit, die sich in den Denkmalsfesten entfaltete sowie auf der Rezeption in der Presse. Außerdem soll die Finanzierung untersucht werden, eine Analyseebene, die Reinhard Ahlings in seinem umfangreichen Werk „Monument und Nation“ als „Indiz für die tatsächliche Relevanz eines Projektes“ (Ahlings 1996, 19) anführt.
Ahlings erweitert die Typologie der Nationaldenkmäler, die Thomas Nipperdey in seinem für die Denkmalforschung grundlegender Aufsatz „Nationalidee und Nationaldenkmal im 19. Jahrhundert“ von 1968 entwickelt hat. Nipperdey entwirft fünf Idealtypen der polit. Denkmäler
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nationalpolitische Denkmäler im 19. Jahrhundert
- Denkmäler bis 1871
- Denkmäler im Deutschen Kaiserreich 1871 - 1914
- Reichsgründungs- und Kaiserdenkmäler
- Bismarck-Denkmäler
- Das Hermannsdenkmal
- Die Subskriptionsbewegung
- Das Hermannsdenkmal in der Öffentlichkeit
- Das Fest zur Schließung des Grundsteingewölbes 1841
- Das Fest zur Fertigstellung 1875
- Die 1900-Jahrfeier der Schlacht im Teutoburger Wald 1909
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Symbolik des Hermannsdenkmals im 19. Jahrhundert und analysiert dessen Rolle im Prozess der nationalen Identitätsbildung in Deutschland. Der Fokus liegt auf der öffentlichen Rezeption des Denkmals, insbesondere anlässlich der verschiedenen Festveranstaltungen, und der Finanzierung des Projekts als Indikator für dessen politische Relevanz. Die Arbeit betrachtet das Denkmal im Kontext der Entwicklung des Denkmalbaus im 19. Jahrhundert und bezieht die Forschungsergebnisse zu vergleichbaren Denkmälern mit ein.
- Der Hermannsmythos als Gründungsmythos des Deutschen Reiches
- Die Mechanismen von Inklusion und Exklusion im Kontext des Denkmals
- Die Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins im Spiegel des Denkmals
- Die Rolle der öffentlichen Festveranstaltungen und der Presse in der Rezeption des Denkmals
- Die Finanzierung des Hermannsdenkmals als Indikator für dessen politische Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des 19. Jahrhunderts als „Jahrhundert der Denkmäler“ ein und betont die Bedeutung von Denkmälern als Medien politischer Inhalte. Sie skizziert die Forschungsfrage der Arbeit, die sich mit der politischen Öffentlichkeit im Kontext der Denkmalsfeste, der Rezeption in der Presse und der Finanzierung des Hermannsdenkmals auseinandersetzt. Die Einleitung stellt den Bezug zu den Arbeiten von Ahlings und Nipperdey her, die die Typologie nationalpolitischer Denkmäler untersuchen.
Nationalpolitische Denkmäler im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des Denkmalbaus im 19. Jahrhundert in Deutschland. Es beschreibt verschiedene Typen politischer Denkmäler, darunter nationalmonarchische, Denkmalkirchen, Denkmäler der Bildungs- und Kulturnation, Denkmäler der demokratisch konstituierten Nation und Denkmäler der nationalen Sammlung. Die Ausführungen zeigen den historischen Wandel der Nationaldenkmäler und des Nationalbewusstseins auf und legen die Grundlage für die detaillierte Analyse des Hermannsdenkmals im darauf folgenden Kapitel.
Das Hermannsdenkmal: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Hermannsdenkmal, seinen Entstehungsprozess (einschliesslich der Subskriptionsbewegung) und seine öffentliche Rezeption. Es analysiert die Bedeutung der Festveranstaltungen zur Grundsteinlegung, zur Fertigstellung und zur 1900-Jahrfeier der Varusschlacht für die Konstruktion und Veränderung des nationalen Narrativs. Die verschiedenen Phasen der Rezeption des Denkmals und die sich verändernden Bedeutungszuweisungen werden beleuchtet, um die Flexibilität des politischen Mythos zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Hermannsdenkmal, Nationaldenkmal, Nationalbewusstsein, 19. Jahrhundert, Deutsches Kaiserreich, politische Symbolik, Mythenbildung, nationale Identität, Inklusion, Exklusion, Denkmalsfeste, Presse, Finanzierung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Nationalpolitische Denkmäler im 19. Jahrhundert - Fokus Hermannsdenkmal
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die politische Symbolik des Hermannsdenkmals im 19. Jahrhundert und dessen Rolle in der nationalen Identitätsbildung Deutschlands. Der Fokus liegt auf der öffentlichen Rezeption des Denkmals (insbesondere bei Festveranstaltungen), sowie dessen Finanzierung als Indikator für seine politische Bedeutung. Die Arbeit betrachtet das Denkmal im Kontext des allgemeinen Denkmalbaus des 19. Jahrhunderts und vergleicht es mit ähnlichen Bauwerken.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den Hermannsmythos als Gründungsmythos, die Mechanismen von Inklusion und Exklusion im Kontext des Denkmals, die Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins im Spiegel des Denkmals, die Rolle öffentlicher Festveranstaltungen und der Presse in der Rezeption und die Finanzierung des Hermannsdenkmals als Indikator für seine politische Relevanz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über nationalpolitische Denkmäler im 19. Jahrhundert, ein Kapitel zum Hermannsdenkmal selbst und Schlussbetrachtungen. Das Kapitel zu den nationalpolitischen Denkmälern bietet einen Überblick über die Entwicklung des Denkmalbaus im 19. Jahrhundert in Deutschland und beschreibt verschiedene Typen politischer Denkmäler. Das Kapitel zum Hermannsdenkmal konzentriert sich auf seinen Entstehungsprozess, die Subskriptionsbewegung und seine öffentliche Rezeption anlässlich verschiedener Festveranstaltungen (Grundsteinlegung, Fertigstellung, 1900-Jahrfeier der Varusschlacht).
Wie wird das Hermannsdenkmal in der Arbeit betrachtet?
Das Hermannsdenkmal wird als zentrales Beispiel für die politische Symbolik und Mythenbildung im 19. Jahrhundert analysiert. Seine Entstehung, Finanzierung und die öffentliche Rezeption anlässlich verschiedener Feste werden untersucht, um die Flexibilität des politischen Mythos und seine Bedeutung für die nationale Identität zu beleuchten.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf die Arbeiten von Ahlings und Nipperdey, die die Typologie nationalpolitischer Denkmäler untersuchen. Weitere Quellen werden im Detail im Text selbst genannt (nicht im vorliegenden Preview).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Hermannsdenkmal, Nationaldenkmal, Nationalbewusstsein, 19. Jahrhundert, Deutsches Kaiserreich, politische Symbolik, Mythenbildung, nationale Identität, Inklusion, Exklusion, Denkmalsfeste, Presse, Finanzierung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende, die sich mit der Geschichte des 19. Jahrhunderts, der deutschen Nationalgeschichte, der politischen Symbolik und der Mythenbildung auseinandersetzen. Sie ist für eine akademische Zielgruppe konzipiert.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist beim Verlag [Name des Verlages einfügen] erhältlich.
- Citar trabajo
- Jan Tilman Günther (Autor), 2002, Politische Denkmäler im 19. Jahrhundert: Das Hermannsdenkmal, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16346