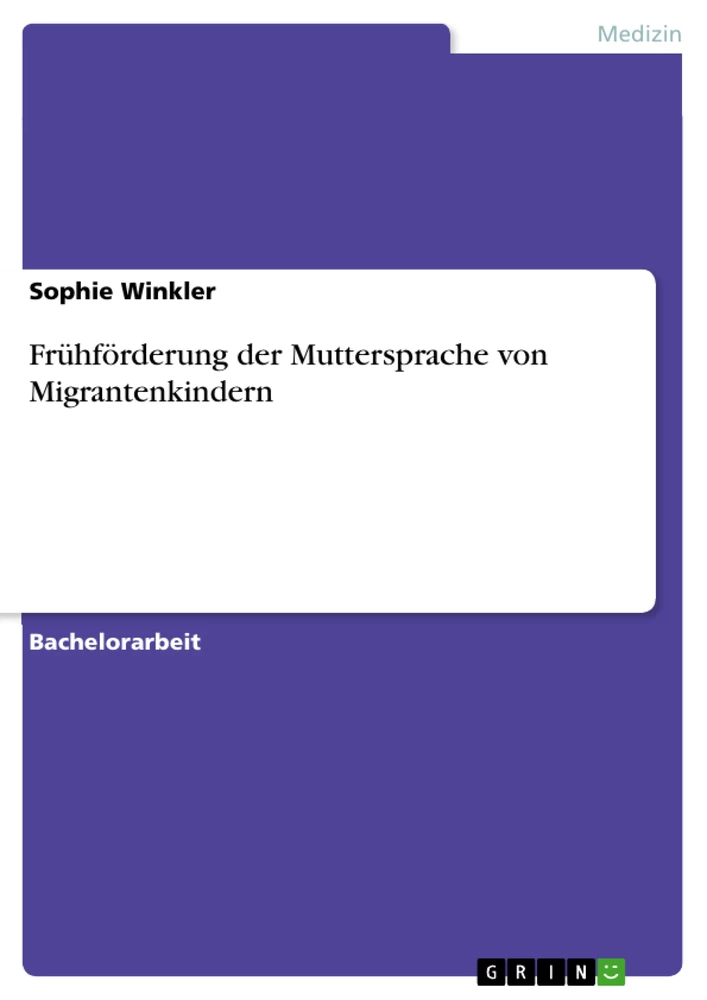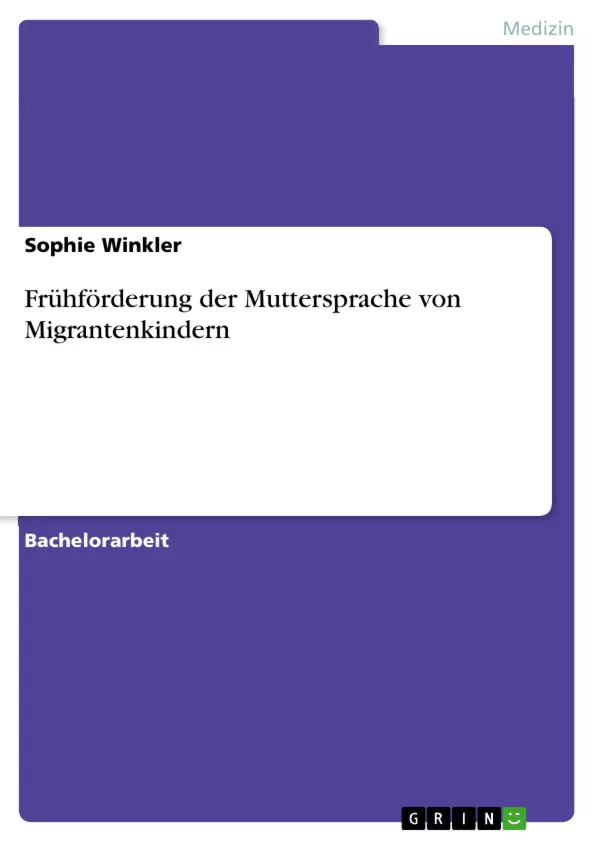Die Frühförderung der Muttersprache von Migrantenkindern spielt in Bezug auf den erfolgreichen Zweitspracherwerb eine wesentliche Rolle und stellt das österreichische Bildungssystem vor große Herausforderungen. Von wissenschaftlicher Seite gibt es Forderungen, wie mit Mehrsprachigkeit in Institutionen umgegangen werden soll, um das vorhandene Potential langfristig nützen zu können und den bilingualen Kindern eine erfolgsversprechende (sprachliche) Zukunft zu gewährleisten. Dem Kindergarten als frühester Bildungseinrichtung kommt dabei eine Schlüsselposition zu, innerhalb derer der Grundstein für die weitere bilinguale sprachliche Entwicklung gelegt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen zum Bilingualismus
- 2.1 Was versteht man unter „Mehrsprachigkeit“?
- 2.2 Bilinguale Sprachvermittlungskonzepte
- 2.2.1 Additive Mehrsprachigkeit
- 2.2.2 Subtraktive Mehrsprachigkeit
- 2.2.3 Doppelspracherwerb
- 2.2.4 Zweitspracherwerb
- 2.3 Theorien zum Erwerb der Zweitsprache
- 2.3.1 Die Identitätshypothese
- 2.3.2 Die Transfer-Hypothese
- 2.3.3 Die Interlanguage-Hypothese
- 2.3.4 Die Monitor-Hypothese
- 2.3.5 Die Pidgin-Hypothese
- 2.4 Typen der Bilingualität
- 2.4.1 Eine Person - Eine Sprache
- 2.4.2 Nicht Umgebungssprache zu Hause
- 2.4.3 Die eine Sprache zu Hause – die andere Sprache aus der Umgebung
- 2.4.4 Zwei Sprachen zu Hause – eine andere Sprache aus der Umgebung
- 2.4.5 Nicht muttersprachliche Eltern
- 2.4.6 Gemischte Sprachen
- 2.5 Bedingungen für den Zweitspracherwerb
- 2.5.1 Prestige der Muttersprache
- 2.5.2 Gleichwertigkeit von Erst- und Zweitsprache
- 2.5.3 Individuelle familiäre Situation
- 2.6 Wichtigkeit der Muttersprache in Bezug auf den Zweitspracherwerb
- 2.6.1 Entwicklung von Selbstvertrauen
- 2.6.2 Sprache der Gefühle/des Erziehens
- 2.6.3 Aufbau von Weltwissen
- 2.6.4 Zurückgreifen auf bekannte Strukturen/sprachliche Ressourcen
- 2.6.5 Kognitive Entwicklung
- Die Bedeutung der Muttersprache für den erfolgreichen Zweitspracherwerb
- Verschiedene Konzepte zur Vermittlung von Mehrsprachigkeit
- Theorien zum Erwerb der Zweitsprache und ihre Relevanz für die Praxis
- Die Rolle des Kindergartens als frühster Bildungseinrichtung
- Die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit im österreichischen Bildungssystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frühförderung der Muttersprache von Migrantenkindern und den Herausforderungen, die sie für das österreichische Bildungssystem darstellen. Sie beleuchtet wissenschaftliche Forderungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit in Institutionen, um das Potential von bilingualen Kindern zu nutzen und ihnen eine erfolgreiche sprachliche Zukunft zu ermöglichen. Die Arbeit betrachtet den Kindergarten als Schlüsselposition in der frühen Bildung, der den Grundstein für die weitere bilinguale Entwicklung legt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Frühförderung der Muttersprache von Migrantenkindern ein und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Mehrsprachigkeit in Bildungseinrichtungen verbunden sind. Kapitel zwei befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Bilingualismus. Es werden verschiedene Konzepte zur Sprachvermittlung, Theorien zum Erwerb der Zweitsprache und Typen der Bilingualität vorgestellt. Die Bedeutung der Muttersprache für den Zweitspracherwerb und die dafür notwendigen Bedingungen werden im Detail erörtert.
Schlüsselwörter
Bilingualismus, Frühförderung, Zweitspracherwerb, Mehrsprachigkeit, Kindergarten, Bildungssystem, Migranten, Sprachvermittlung, Sprachentwicklung, Theorien, Konzepte.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Förderung der Muttersprache für Migrantenkinder wichtig?
Eine starke Erstsprache bildet das Fundament für den erfolgreichen Erwerb der Zweitsprache und fördert das kognitive Weltwissen sowie das Selbstvertrauen.
Was ist der Unterschied zwischen additiver und subtraktiver Mehrsprachigkeit?
Additive Mehrsprachigkeit bedeutet, dass die Zweitsprache als Bereicherung zur Erstsprache hinzukommt, während bei der subtraktiven Form die Erstsprache verdrängt wird.
Welche Rolle spielt der Kindergarten beim Spracherwerb?
Der Kindergarten ist die früheste Bildungseinrichtung und legt den Grundstein für die bilinguale Entwicklung durch gezielte Sprachvermittlungskonzepte.
Was besagt die „Transfer-Hypothese“?
Sie besagt, dass Strukturen und Wissen aus der Muttersprache auf die Zweitsprache übertragen werden können, was den Lernprozess erleichtert.
Welche Bedingungen begünstigen den Zweitspracherwerb?
Wichtig sind das Prestige der Muttersprache, die Gleichwertigkeit beider Sprachen in der Gesellschaft und eine unterstützende familiäre Situation.
- Citar trabajo
- Sophie Winkler (Autor), 2010, Frühförderung der Muttersprache von Migrantenkindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163480