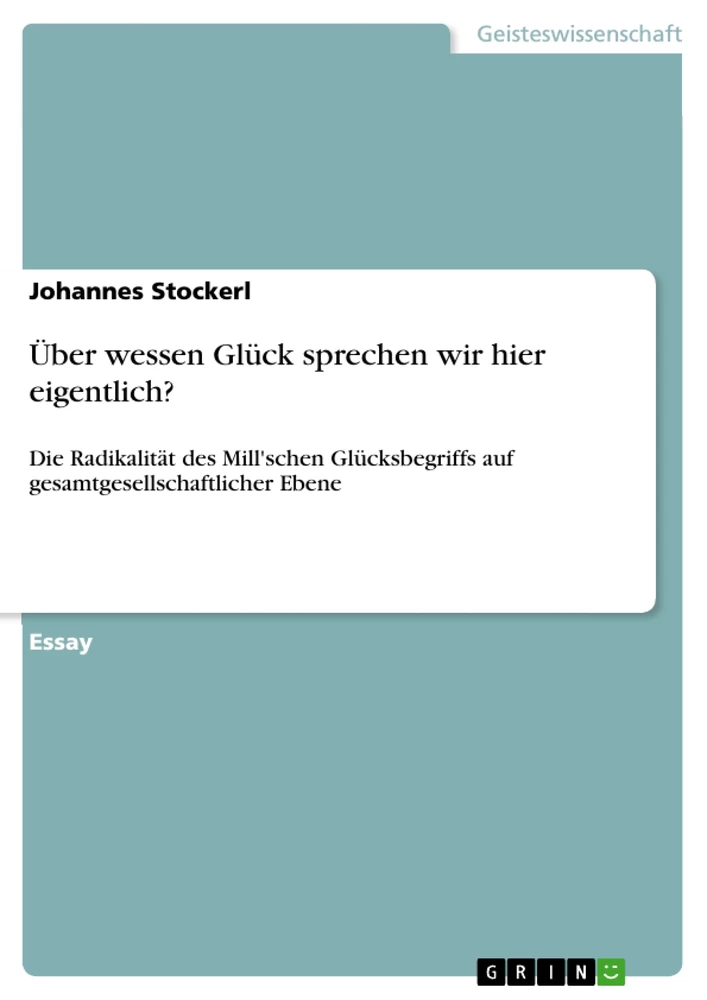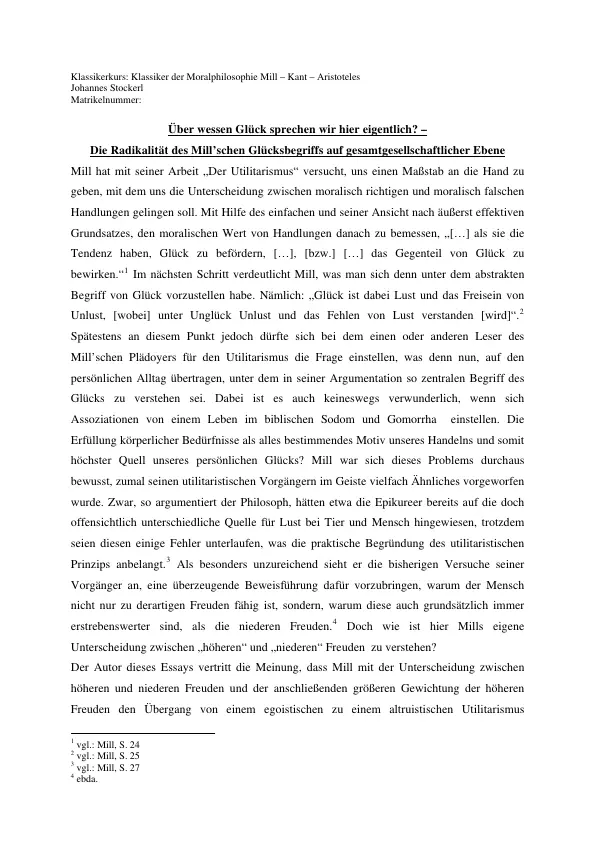Mill hat mit seiner Arbeit „Der Utilitarismus“ versucht, uns einen Maßstab an die Hand zu geben, mit dem uns die Unterscheidung zwischen moralisch richtigen und moralisch falschen Handlungen gelingen soll. Mit Hilfe des einfachen und seiner Ansicht nach äußerst effektiven Grundsatzes, den moralischen Wert von Handlungen danach zu bemessen, „[…] als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, […], [bzw.] […] das Gegenteil von Glück zu bewirken.“ Im nächsten Schritt verdeutlicht Mill, was man sich denn unter dem abstrakten Begriff von Glück vorzustellen habe. Nämlich: „Glück ist dabei Lust und das Freisein von Unlust, [wobei] unter Unglück Unlust und das Fehlen von Lust verstanden [wird]“. Spätestens an diesem Punkt jedoch dürfte sich bei dem einen oder anderen Leser des Mill’schen Plädoyers für den Utilitarismus die Frage einstellen, was denn nun, auf den persönlichen Alltag übertragen, unter dem in seiner Argumentation so zentralen Begriff des Glücks zu verstehen sei. Dabei ist es auch keineswegs verwunderlich, wenn sich Assoziationen von einem Leben im biblischen Sodom und Gomorrha einstellen. Die Erfüllung körperlicher Bedürfnisse als alles bestimmendes Motiv unseres Handelns und somit höchster Quell unseres persönlichen Glücks? Mill war sich dieses Problems durchaus bewusst, zumal seinen utilitaristischen Vorgängern im Geiste vielfach Ähnliches vorgeworfen wurde. Zwar, so argumentiert der Philosoph, hätten etwa die Epikureer bereits auf die doch offensichtlich unterschiedliche Quelle für Lust bei Tier und Mensch hingewiesen, trotzdem seien diesen einige Fehler unterlaufen, was die praktische Begründung des utilitaristischen Prinzips anbelangt. Als besonders unzureichend sieht er die bisherigen Versuche seiner Vorgänger an, eine überzeugende Beweisführung dafür vorzubringen, warum der Mensch nicht nur zu derartigen Freuden fähig ist, sondern, warum diese auch grundsätzlich immer erstrebenswerter sind, als die niederen Freuden. Doch wie ist hier Mills eigene Unterscheidung zwischen „höheren“ und „niederen“ Freuden zu verstehen?
Inhaltsverzeichnis
- Über wessen Glück sprechen wir hier eigentlich? – Die Radikalität des Mill'schen Glücksbegriffs auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
- Die Unterscheidung zwischen höheren und niederen Freuden
- Wie kommen wir zu einer unterschiedlichen Gewichtung von höheren und niederen Freuden?
- Der Entscheidungsprozess zwischen höheren und niederen Freuden auf der persönlichen Ebene
- Die Etablierung der höheren Freuden auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert Mills Utilitarismus in „Der Utilitarismus“ und beleuchtet die Radikalität seines Glücksbegriffs auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Mill argumentiert, dass der moralische Wert von Handlungen daran gemessen werden soll, ob sie Glück befördern oder Unlust verursachen. Er definiert Glück als Lust und das Fehlen von Unlust.
- Die Unterscheidung zwischen höheren und niederen Freuden
- Die Gewichtung der höheren Freuden durch den Utilitarismus
- Die Etablierung der höheren Freuden in der Gesellschaft
- Das Problem der Glücksdiktatur im Mill'schen Utilitarismus
- Die Auswirkungen der Unterscheidung zwischen höheren und niederen Freuden auf das größtmögliche Glück der größten Zahl
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit der Vorstellung von Mills Utilitarismus und seiner Definition von Glück als Lust und dem Fehlen von Unlust. Er stellt die Frage, wie sich diese Definition auf den persönlichen Alltag übertragen lässt und wie Mill die Unterscheidung zwischen höheren und niederen Freuden vornimmt.
- Das zweite Kapitel beschreibt Mills Argumentation für die Gewichtung der höheren Freuden. Er stellt die Frage, warum Menschen trotz negativer Erfahrungen mit höheren Freuden diese nicht gegen niedere Freuden eintauschen möchten. Mill argumentiert, dass höhere Freuden nicht nur von Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit und Unaufwendigkeit geprägt sind, sondern auch von einem Gefühl der Würde.
- Im dritten Kapitel wird der Mechanismus des Entscheidungsprozesses zwischen höheren und niederen Freuden auf der persönlichen Ebene analysiert. Mill argumentiert, dass wir durch Stolz, Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit, Liebe zur Macht und Gefühl der Würde zu höheren Freuden hingezogen werden. Er stellt jedoch auch fest, dass nicht alle Menschen in gleichem Maße über diese Fähigkeiten verfügen.
- Das vierte Kapitel behandelt die Etablierung der höheren Freuden auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Mill argumentiert, dass ein Mehrheitsvotum derer, die mit beiden Freuden vertraut sind, als Maßstab für jede Handlung dienen muss. Er will verhindern, dass niedere Freuden eine dominante Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Mehrheitsvotum nicht zu einer Glücksdiktatur der Wenigen über die Mehrheit führen kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Essays sind Utilitarismus, Glück, höhere Freuden, niedere Freuden, Glücksdiktatur, Mehrheitsvotum, gesellschaftliches Wohl, Moral, Entscheidungsprozess, Charakterstärke, soziale Stellung, Egoismus, Altruismus.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert John Stuart Mill "Glück"?
Mill definiert Glück als Lust und das Freisein von Unlust. Der moralische Wert einer Handlung bemisst sich daran, ob sie die Tendenz hat, Glück zu befördern.
Was ist der Unterschied zwischen höheren und niederen Freuden?
Höhere Freuden entspringen dem Geist und Verstand (z.B. Bildung, Kunst), während niedere Freuden rein körperlicher Natur sind. Höhere Freuden gelten als qualitativ wertvoller.
Warum bevorzugen Menschen laut Mill höhere Freuden?
Mill argumentiert, dass dies an einem Gefühl der Würde liegt. Ein Wesen mit höheren Fähigkeiten würde niemals in einen Zustand niedrigerer Existenz zurückfallen wollen.
Was ist das Problem der "Glücksdiktatur" im Utilitarismus?
Es stellt sich die Frage, ob ein Mehrheitsvotum derer, die beide Freuden kennen, dazu führen kann, dass eine Elite der Mehrheit vorschreibt, was als erstrebenswertes Glück zu gelten hat.
Was bedeutet das Prinzip des "größtmöglichen Glücks"?
Es ist der utilitaristische Maßstab, wonach diejenige Handlung moralisch richtig ist, die das Gesamtheil bzw. das Glück der größtmöglichen Zahl von Menschen vermehrt.
- Arbeit zitieren
- Johannes Stockerl (Autor:in), 2010, Über wessen Glück sprechen wir hier eigentlich?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163607