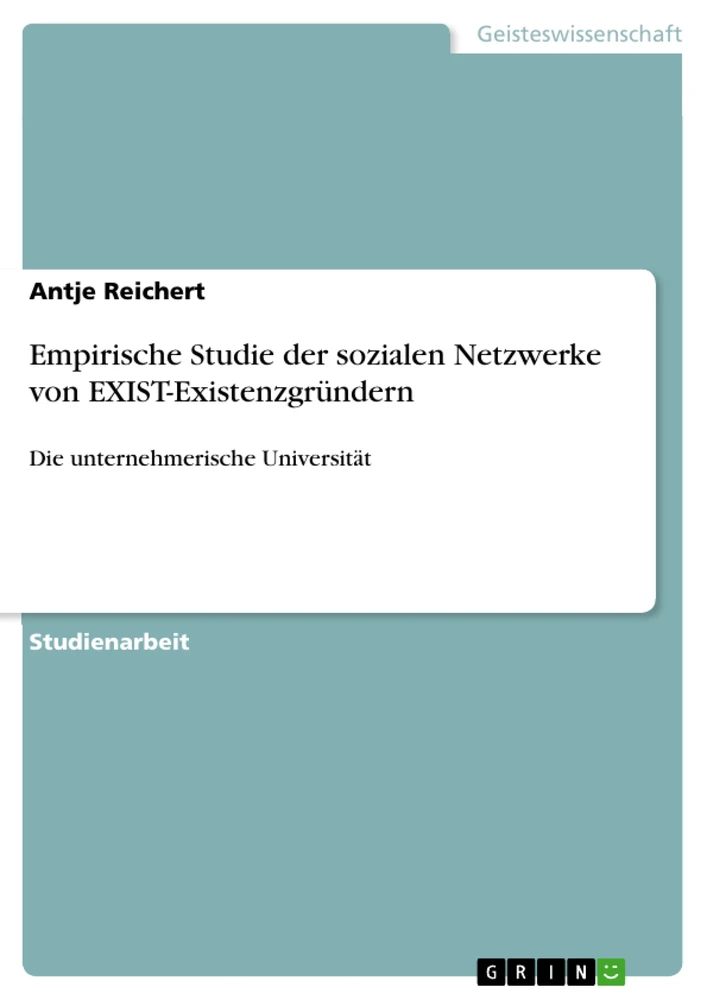Die Kommerzialisierung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus dem akademischen Kontext ist Bestandteil des neuen Bildes der unternehmerischen Hochschule. Um diese Wertschöpfung nachhaltig zu ermöglichen, ist es wichtig, Existenzgründer mit dem nötigen sozialen Kapital auszustatten. Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, wie die Akteure selbst ihre Beziehungen zu den relevanten
Partnern bewerten. Mit Hilfe eines Online-Fragebogens konnte ermittelt werden, dass die wesentlichen Schlüsselpersonen ganz unterschiedlichen Gruppierungen angehören. Durch die Visualisierung der sozialen Netzwerke wird letztlich deutlich, dass der
Zusammenhang der Sozialstruktur mit dem Erfolg von Existenzgründungen auf kollektiver und individueller Ebene auf der Vielfalt sozialer Interaktionen basiert. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit werden schließlich Handlungsempfehlungen abgeleitet für eine aussagekräftige Fortsetzung der Studie.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Ausgangslage und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Zum Stand der Forschung
- 3 Methodische Vorgehensweise
- 3.1 Formulierung der Hypothesen
- 3.2 Aufbau des Fragebogens
- 3.3 Pretest und Datenerhebung
- 3.4 Datenauswertung
- 4 Darstellung der wichtigsten Ergebnisse
- 4.1 Univariate Beschreibung
- 4.2 Auswertung der Zusammenhänge
- 4.3 Korrespondenzanalyse und Überprüfung der Hypothesen
- 5 Schlussfolgerungen
- 6 Anhang
- 6.1 Quellenverzeichnis
- 6.1.1 Literatur
- 6.1.2 Fachzeitschriften, Journals, Zeitungen
- 6.1.3 Internet
- 6.2 Diverse Unterlagen
- 6.2.1 Fragebogen
- 6.2.2 Variablen-Übersicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die sozialen Netzwerke von Existenzgründern, die aus dem akademischen Kontext heraus entstehen. Das Hauptziel ist es, die Bedeutung sozialer Beziehungen für den Erfolg dieser Unternehmen zu untersuchen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie die Akteure selbst ihre Beziehungen zu relevanten Partnern bewerten und welche Gruppierungen dabei eine wichtige Rolle spielen.
- Die Bedeutung sozialer Netzwerke für den Erfolg von Existenzgründungen
- Die Bewertung von Beziehungen zu relevanten Partnern durch die Akteure
- Die Rolle von verschiedenen Gruppierungen innerhalb der Netzwerke
- Die Auswirkungen der sozialen Struktur auf den Erfolg von Existenzgründungen
- Handlungsempfehlungen für die weitere Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ausgangslage und die Zielsetzung der Arbeit. Es wird der Zusammenhang zwischen der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen und dem Erfolg von Existenzgründungen beleuchtet, wobei die Bedeutung von sozialen Netzwerken betont wird. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema und zeigt die Bedeutung des sozialen Kapitals auf. Im dritten Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der Studie beschrieben, einschließlich der Formulierung von Hypothesen, des Aufbaus des Fragebogens und der Datenerhebung und -auswertung. Das vierte Kapitel präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Studie, die sich auf die Analyse der sozialen Netzwerke der Existenzgründer beziehen. Dieses Kapitel beinhaltet auch eine univariate Beschreibung der Daten sowie die Auswertung der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Variablen und die Überprüfung der Hypothesen.
Schlüsselwörter
Existenzgründung, Spin-off, Soziales Netzwerk, Soziale Beziehungen, Unternehmerische Universität, Kommerzialisierung, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, Sozialkapital, Netzwerkanalyse, empirische Studie, Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind soziale Netzwerke für Existenzgründer so wichtig?
Soziale Netzwerke stellen wertvolles Sozialkapital dar, das Gründern Zugang zu Informationen, Ressourcen und relevanten Partnern ermöglicht, was entscheidend für den Unternehmenserfolg ist.
Was untersucht die empirische Studie der EXIST-Gründer?
Die Studie untersucht, wie akademische Existenzgründer ihre Beziehungen zu Partnern bewerten und wie die Sozialstruktur mit dem Erfolg der Gründung zusammenhängt.
Welche Rolle spielt die unternehmerische Hochschule?
Die unternehmerische Hochschule fördert die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen durch Spin-offs und stattet Gründer mit dem nötigen Netzwerk aus.
Wer sind die wichtigsten Schlüsselpersonen in Gründernetzwerken?
Schlüsselpersonen gehören verschiedenen Gruppierungen an, darunter Mentoren, wissenschaftliche Partner, Investoren und andere Unternehmer.
Wie wurde die Datenerhebung in dieser Studie durchgeführt?
Die Daten wurden mithilfe eines Online-Fragebogens erhoben, gefolgt von einer statistischen Auswertung der Zusammenhänge und einer Visualisierung der Netzwerke.
Was ist das Ziel der Netzwerkanalyse in diesem Kontext?
Ziel ist es, die Vielfalt sozialer Interaktionen auf kollektiver und individueller Ebene sichtbar zu machen und Handlungsempfehlungen für die Gründungsförderung abzuleiten.
- Citar trabajo
- Antje Reichert (Autor), 2010, Empirische Studie der sozialen Netzwerke von EXIST-Existenzgründern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163623