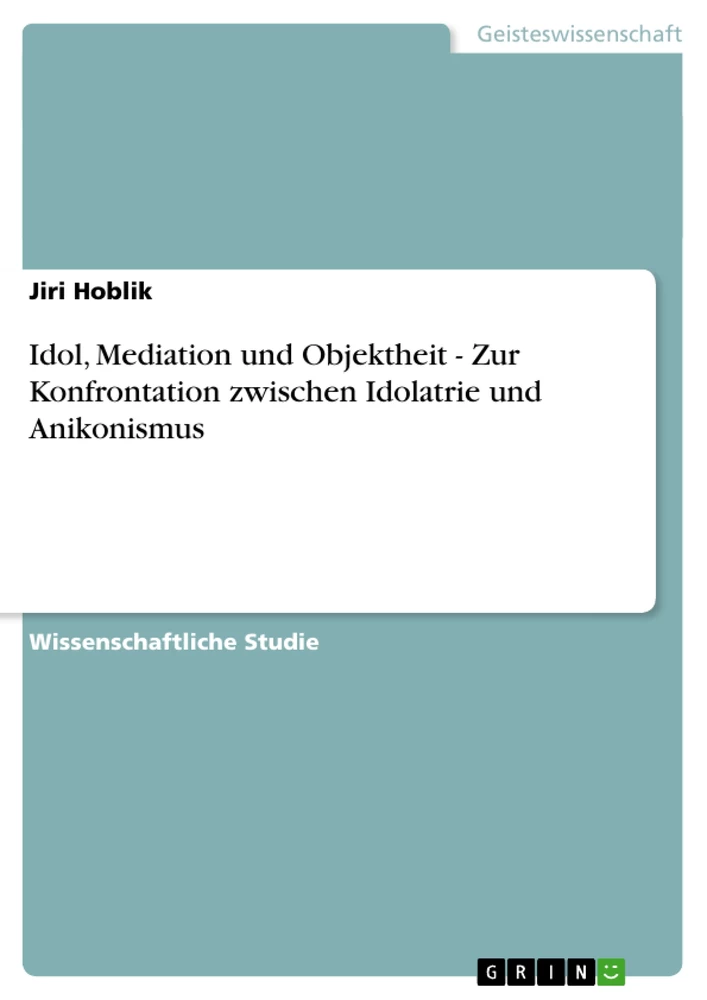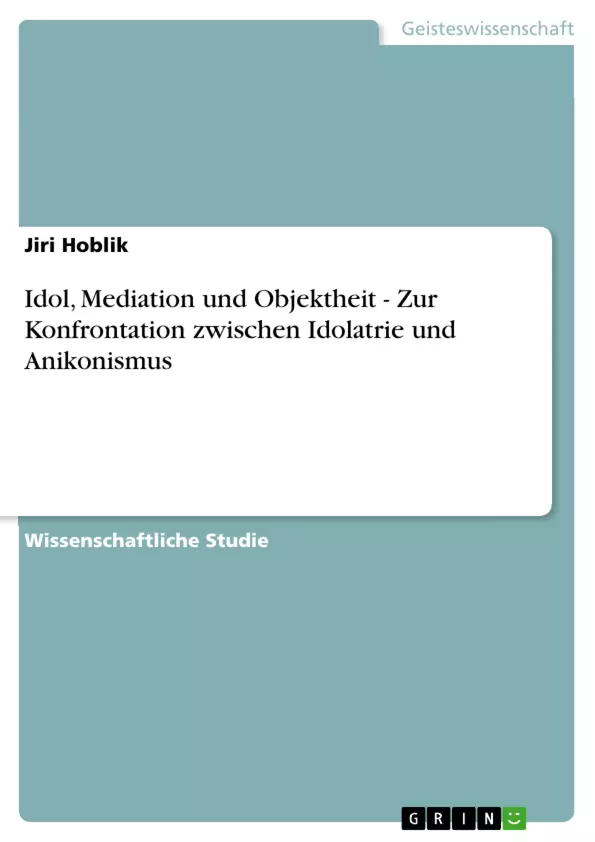Unsere Frage der Rehabilitierung des Gedanken-Objekts im Akt einer Vorstellung stellt sinen Versuch seiner Identifizierung als eines Geschehnisses vor. Und zwar am Beispiel der Idolatrie und des sie charakterisierenden Inventars.
Idol, Mediation und Objektheit
Zur Konfrontation zwischen Idolatrie und Anikonismus
Gilt es berechtigterweise bur das Objekt, dass es ein Gefangnis dessen ist, was lebendig bleiben mochte, ein Gefangnis im Sinne eines Eisschlosses? 1st es wirklich unumganglich, dass es selbst erstarren muss?
Nichts desto weniger durfen wir ohne weiteres das Paradoxon dort umgehen, wo das heutige Denken auf die Verantwortung angesichts der Wahrheit und fur die eigene Wahrhaftigkeit verzichtet, dagegen die sogenannte Objektivitat[1] dessen, was der Denkende selbst ausgesprochen hat, beansprucht und hervorhebt, als sei die Objektivitat nicht an deren Trager gebunden.[2]
Unsere Andeutung der Frage der Rehabilitierung des Objekts will nichts mehr als ein Versuch seiner Identifizierung als eines Geschehnisses sein.[3] Und zwar am Beispiel der Idolatrie und des sie charakterisierenden Inventars.[4]
Schon von der prahistorischen Zeit an erzeugte der Mensch Idole, d.h. dem Sehen sich gebende Bild-Werke, die geistige Wesen reprasentieren sollten, damit diese unter den Menschen verweilen und damit ihre unsichtbare Macht in die menschliche Erfahrungssphare eindringen kann. (Unter Representation wird also nicht eine Art von Stellvertretung verstanden, sondern ein Medium der wiederholten, eigene Manifestation anstrebenden und expandierenden Prasenz.) Und es standen nicht nur materielle Artefakte fur diese Wesen zur Verfugung - Medien der Gottheiten, sondern es kam auch zur Objektwerdung als Art und Weise der menschlichen Be-Gegnung mit ihnen und dadurch mit den Gottheiten. Das Idol initiierte die Objektwerdung - als Schaubild der Bedeutungen hat es seine Mitteilungen angeboten, die vom Menschen „gelesen“ wurden. Es stellte auch eine Macht dar, wodurch der Mensch angeregt wurde - und umgekehrt wurde auch es selbst durch die Objektwerdung gepragt.
So interessiert uns dieses kultische Requisit als ein Element eines Geschehens, woran sich der Mensch beteiligt. Und dadurch zeigt sich unter anderem, wie injenem Geschehen eine Einheit von Verschiedenheiten geschieht. Es werden nicht nur Anwesenheit, Handlungen oder Gedanken des Menschen irgendwie erganzt, sondern er selbst wird in das Geschehen involviert. Deshalb kann nicht die Frage nach dem Idol durch blofie Messen und Beschreiben seiner Merkmale beantwortet werden. Das Idol spielt seine Rolle in einer Geschehenssequenz, deren Extension von einer Gottheit zum religiosen Bewusstsein und dessen Konsequenzen verfolgt werden will und die sich auch als eine Reihe der verschiedenen anschliefienden Mediationen abstrahieren lasst, wobei dieses Idol sein spezifisches zur-Mediation-geeignet- sein[5] erweist. Es lasst sich gerade an den Mediationen bemerken, wie sie das Beobachten weitgehend uberschreiten.
Und weiter: weil der menschliche Teilnehmer in das Geschehen verwickelt wird, steht er im Widerspruch zur Vorstellungen uber ein von Distanzen umgebenes Individuum. Darin gehort dem Idol ein Objekt zu - als das mediative Objektwerden, wo die Mediation die Begegnung des Menschen mit der Gottheit verwirklichen soll. Dazwischen gibt es kein Fernstehen und auch keine Berechtigung fur irgendwelches Objektheit-Gefangnis. Wie auch immer man die Beziehung zwischen Idol und Objekt beschreiben kann,[6] wir konnen sehen, dass die Mediation diese Beziehung in einem Geschehen aufkommen lasst. Das Geschehen kann man als eine Sequenz von Mediationen beschreiben, wobei sich die Frage aufdrangt, inwiefern ein isolierendes Beschreiben dem Denken selbst angemessen ist.
Man darf aus einer solchen Beschreibung schliefien, dass das Idol eine Meinung des Nichtvisuellen auf visuelle Weise bei einer Person oder bei mehreren Personen initiiert, worin sich die Untrennbarkeit des Visuellen und Nichtvisuellen zeigt. Dazu konnen wir ein Beispiel auswerten, das aus dem koniglichen Archiv des Stadtstaates Mari am oberen Eufrat (-18. /-17. Jahrhundert) stammt:
,,In meinem Traum waren ich und der Mann mit mir auf dem Wege aus dem Gebiet von Sagaratum im oberen Bezirk nach Mari. Unterwegs (?) trat ich in Terqa [7] an, und als ich dort eintrat, ging ich in den Dagan-Tempel hinein und vor Dagan warf ich mich nieder. Als ich ihm zu Fufien lag, offnete Dagan seinen Mund und sprach zu mir: ,,Haben die Konige der Jaminiten [8] und ihre Leute mit den Leuten Zimrlilims, [9] die heraufgezogen sind, Frieden gemacht?“ Ich antwortete: ,,Sie haben nicht Frieden gemacht!“ Gerade als ich herausgehen wollte, sagte er mir (weiter): ,, Warum befinden sich nicht standig Boten Zimrilims vor mir, und warum halt er mich nicht immer auf dem laufenden? Sonst hatte ich schon seit langerem die Konige der Jaminiten in die Hand Zimrilims gegeben! Jetzt geh, ich habe dich gesandt! Zu Zimrlilim sollst dufolgendermafien sprechen, dies (sollst) du (sagen): Sende deine Bote zu
[...]
[1] M.E. besteht hier der unuberwindbare Punkt der Kontroverse, und zwar darin, dass adequatio ad rem von dem intellectus selbst kontrolliert werden muss, weil er nie zum unvoreingenommenen Richter werden kann. Doch das betreffende mittelalterliche Anliegen stutzt sich auf das Vertrauen in die Dinge als geschaffene Dinge. Ein Sinn fur die Objektivitat konnte das personlich-private verdrangen, wie daruber J. Hirschberger schreibt, s. Geschichte der Philosophie, I. Altertum und Mittelalter, 3. Ausg., Freiburg i. Br. 1980, S. 320. Bei dieser Stellungnahme braucht man sich nicht hinter der Objektivitat zu verbergen. Entsprechend besteht W. Weischedel darauf, dass Aquinus von sich selbst zur Sache selbst absieht, Die philosophische Hintertreppe : 34 grofie Philosophen in Alltag und Denken. 3. Ausg. Munchen : Nymphenburger Verlagshandlung 1973, S. 76. Im Kontrast zum mittelalterlichen Anspruch der Objektivitat kann man zumindest demonstrieren, wie sich in der neueren Zeit der solipsistische Subjektivismus selbst als Mafistab in Anspruch nimmt.
[2] E. Levinas pladiert fur die Verbindung zwischen dem Phanomen und der Bedeutung und deshalb kritisiert er das Einsetzen des Phanomens in die Zweckmafiigkeit unseres praktischen Verhaltens, womit die Objektivitat des Gegenstandes unterschatzt bleibt, Totalita a nekonecno [Totalitat und Unendlichkeit]. Prag : OIKOUYMENH 1997, S. 78. Das die Bedeutung gebende Bewusstsein entspringtja nicht der Zweckmafiigkeit.
[3] Es geht also um keine psychische Aktivitat. Wir sind hier allerdings auch von keiner erkenntnistheoretischen Fragestellung geleitet, sondern wir wollen nur zur Frage des religiosen Bewusstseins etwas beitragen, die nicht nur religionswissenschaflich, sondern auch religionsphilosophisch gestellt werden darf.
[4] Fur die Auswertung des griechischen EIDOLON ist die Septuaginta verantwortlich, die dem Wort eine religiose und zugleich eine pejorative Bedeutung verlieh. Das Wort EIDOLATRIA hat das Neue Testament eingefuhrt. Zur Definition der Idolatrie siehe Ries, J. Idolatry. In: Jones, L. et. al. (ed.). The Encyclopedia of Religion. Sv. 6. 2. vyd. Detroit usw. Macmillan 2005, (S. 4356-4365) 4363: ,,...idolatry is the worship of a divinity represented by a substitute for a divine, called an idol“. Und weiter dazu ibid., S. 4364: “The idol represents a hierophany in which humans perceive a manifestation of the sacred that clothes object in a new dimension... Through consecration, the image or object now belongs to the divinity and can no longer serve a secular use.” Diese Definition ist insofern berechtigt, als sie die Hierophanie neben der Konsekration berucksichtigt. Doch eine Schwache besteht darin, dass das a priori der Heiligkeit der religiosen Symbole verkennt. Weiter zur Sache Ratschow, C. H. Bilder und Bilderverehrung. I. Religionsgeschichtlich. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart : Handworterbuch fur Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft mit Hans Freiherr von Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knut E. Logstrup herausgegeben von Kurt Galling. 2. el. Ausgabe der 3. Ausgabe. Tubingen 2000, S. 4277-4284.
[5] In einem besonderen Sinne des Gesondertseins, also der Heiligkeit.
[6] Die differenzierende Abstraktion bleibt immer auf den Geschehnischarakter angewiesen. Dadurch kann man der Illusion der Wahrheit als einer richtigen Nachahmung der Wirklichkeit erwehren. Was ist hier eigentlich die Ad-aequatio? Das Gleichwerden des Anderen? Vielmehr einen kommunikativen Austausch ermoglichendes Zur- einen-Ebene-Bringen.
[7] Bedeutsamer Kultort am Eufrat, westlich von Mari, vgl. Dietrich, M. Prophetenbriefe aus Mari. In: Kaiser, O. (ed.). Texte aus der Umwelt des Alten Testaments II. Orakel, Rituale, Bau- und Votivinschriften, Lieder und Gebete. Gutersloh : Gutersloher Verlagshaus 1991, (S. 83-101) S. 88.
[8] Dietrich, M. Prophetenbriefe aus Mari, S.91: »Nomadenstamm in der Steppe sudwestlich von Mari«.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Idol, Mediation und Objektheit"?
"Idol, Mediation und Objektheit" untersucht die Konfrontation zwischen Idolatrie und Anikonismus, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von Objekten, Idolen und Mediation im religiösen Kontext. Der Text argumentiert, dass das Idol nicht nur als ein Objekt betrachtet werden sollte, sondern als ein Element in einem Geschehen, an dem der Mensch beteiligt ist und in dem eine Einheit von Verschiedenheiten entsteht. Es wird betont, dass das Idol als ein Medium der Begegnung mit dem Göttlichen fungiert und eine Form der Objektwerdung initiiert, die über bloße Darstellung hinausgeht.
Was bedeutet die Rehabilitierung des Objekts in diesem Kontext?
Die Rehabilitierung des Objekts zielt darauf ab, es als ein Geschehnis zu identifizieren, insbesondere am Beispiel der Idolatrie. Es geht darum, das Objekt nicht als ein statisches, isoliertes Ding zu betrachten, sondern als einen aktiven Teilnehmer in einem dynamischen Prozess, der die Beziehung zwischen Mensch und Göttlichem vermittelt.
Wie wird Idolatrie im Text definiert?
Idolatrie wird im Kontext des Textes nicht einfach als Götzendienst verstanden, sondern als die Verehrung einer Gottheit, die durch ein Idol repräsentiert wird. Das Idol wird als ein Medium betrachtet, durch das sich das Heilige manifestiert und eine neue Dimension für das Objekt schafft. Durch die Konsekration gehört das Bild oder Objekt der Gottheit und kann nicht mehr für profane Zwecke verwendet werden.
Welche Rolle spielt die Mediation im Bezug auf Idole?
Die Mediation spielt eine zentrale Rolle, da sie die Begegnung des Menschen mit der Gottheit verwirklicht. Das Idol erweist sich als spezifisch zur-Mediation-geeignet, und diese Mediationen überschreiten das bloße Beobachten. Die Mediation lässt eine Beziehung zwischen Idol und Objekt entstehen in einem Geschehen, das als eine Sequenz von Mediationen beschrieben werden kann.
Was bedeutet die Untrennbarkeit des Visuellen und Nichtvisuellen in Bezug auf Idole?
Das Idol initiiert eine Meinung des Nichtvisuellen auf visuelle Weise, wodurch die Untrennbarkeit von Visuellem und Nichtvisuellem deutlich wird. Ein Beispiel aus dem königlichen Archiv des Stadtstaates Mari veranschaulicht dies, indem es einen Traum beschreibt, in dem eine Person mit einem Gott kommuniziert, was die Vermittlung einer unsichtbaren Botschaft durch ein sichtbares Medium zeigt.
Welche Kritik wird an der Objektivität geübt?
Der Text kritisiert die Vorstellung von Objektivität als etwas, das unabhängig vom Denkenden existiert. Es wird argumentiert, dass "adequatio ad rem" (Übereinstimmung mit der Sache) vom Intellekt selbst kontrolliert werden muss, da dieser nie zu einem unvoreingenommenen Richter werden kann. Die Objektivität kann somit nicht von ihrem Träger getrennt betrachtet werden.
- Citation du texte
- Jiri Hoblik (Auteur), 2007, Idol, Mediation und Objektheit - Zur Konfrontation zwischen Idolatrie und Anikonismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163684