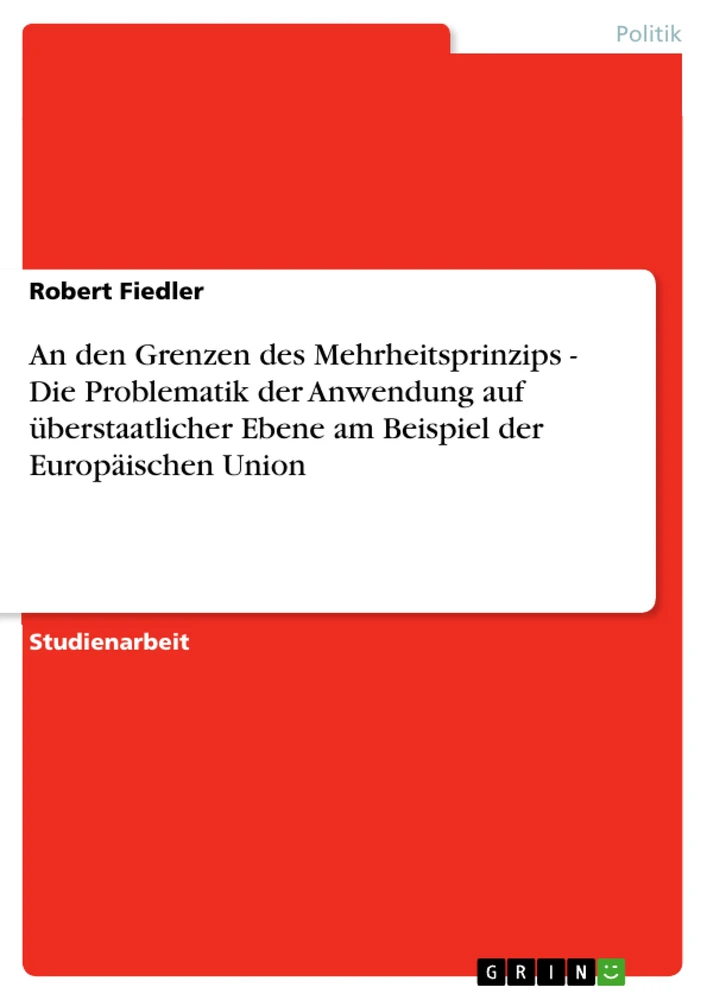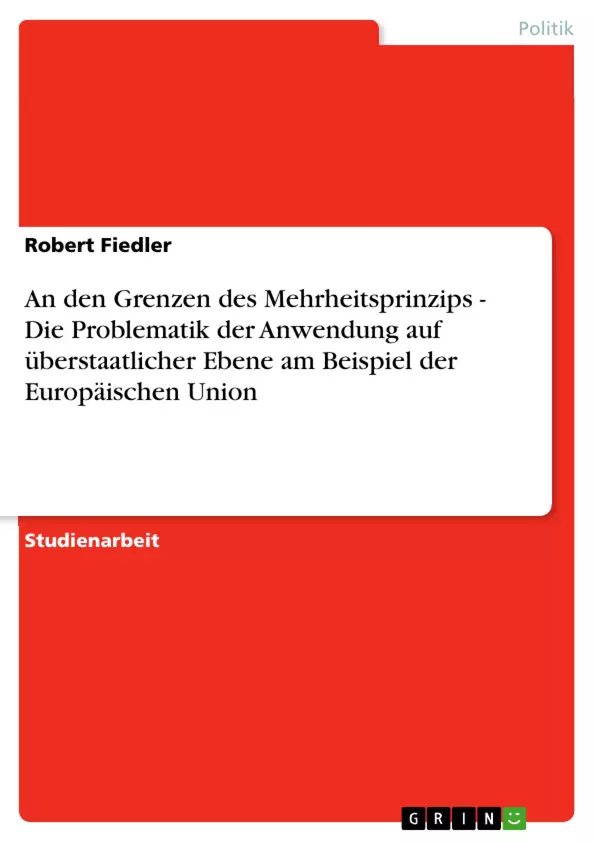„Der Begriff Mehrheitsprinzip bezeichnet ein demokratisches Prinzip, nach dem sich bei Abstimmungen bzw. Wahlen der Wille der Mehrheit gegenüber der Minderheit durchsetzt und der Wille der Mehrheit für alle Verbindlichkeit erlangt. In diesem Sinne ist das Mehrheitsprinzip auch ein Rechtsgrundsatz, nach dem die Minderheit sich einer Mehrheit unterzuordnen hat.“1
In der heutigen Gesellschaft sind die Begriffe Demokratie und Mehrheitsentscheidung nahezu untrennbar miteinander verbunden. Wie sonst könnten in demokratischen Systemen Regierungen gebildet und für alle verbindlichen Entscheidungen gerechtfertigt werden? Darüber hinaus stellt sich die Frage, wieso das Mehrheitsprinzip allgemein anerkannt wird und das sogar von dadurch benachteiligten Minderheiten? Allerdings sind dem Mehrheitsprinzip auch Grenzen gesetzt, die angesichts der Entwicklung der Europäischen Union deutlich gemacht werden. In dieser Hausarbeit wird von einer Notwendigkeit von Mehrheitsentscheidungen in modernen demokratischen Gesellschaftssystemen ausgegangen und die Grundlagen und Voraussetzungen des Mehrheitsprinzips analysiert. In einem zweiten Teil er Arbeit wird auf mögliche Probleme der Anwendung des Mehrheitsprinzips auf der Ebene der Europäischen Union eingegangen. Dabei wird argumentiert, dass es aufgrund einer nur schwachen Identifikation mit der Europäischen Union und aufgrund fehlender Routinen nur schwer möglich ist, das Mehrheitsprinzip in diesem Rahmen anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Das Mehrheitsprinzip – Grundlagen, Voraussetzungen
- Notwendigkeit zur Entscheidung
- Lösungsmöglichkeiten
- Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie
- Die Grenzen des Mehrheitsprinzips am Beispiel der Europäischen Union
- Fehlende Identitäten
- Fehlende Routinen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Mehrheitsprinzips in modernen demokratischen Gesellschaftssystemen und analysiert dessen Anwendung im Kontext der Europäischen Union. Der Fokus liegt auf der Erörterung der Grundlagen und Voraussetzungen des Mehrheitsprinzips sowie auf der Analyse möglicher Probleme bei seiner Anwendung auf überstaatlicher Ebene.
- Notwendigkeit von Mehrheitsentscheidungen in demokratischen Systemen
- Grundlagen und Voraussetzungen des Mehrheitsprinzips
- Anwendung des Mehrheitsprinzips auf der Ebene der Europäischen Union
- Identifikation und Routinen im Kontext der EU
- Grenzen des Mehrheitsprinzips in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des Mehrheitsprinzips in der Demokratie und analysiert dessen Anwendung in modernen Gesellschaften, insbesondere im Kontext der Europäischen Union. Sie argumentiert, dass das Mehrheitsprinzip zwar ein zentrales Element demokratischer Entscheidungsfindung darstellt, aber auch mit spezifischen Herausforderungen verbunden ist, die in der EU besonders deutlich werden.
Das Mehrheitsprinzip – Grundlagen, Voraussetzungen
Notwendigkeit zur Entscheidung
Der Text erklärt, dass die Notwendigkeit von Mehrheitsentscheidungen in komplexen Gesellschaften mit vielen unterschiedlichen Interessen und Zielen entsteht. Die Notwendigkeit von Entscheidungsprozeduren, die Ergebnisse mit Legitimation und Akzeptanz gewährleisten, wird betont.
Lösungsmöglichkeiten
Verschiedene Ansätze zur Entscheidungsfindung werden vorgestellt, darunter Aufschub der Entscheidung, Ausgrenzung bestimmter Interessen, Reduktion von Alternativen und der echte Konsens. Der Text argumentiert, dass ein echter Konsens zwar die ideale Lösung darstellt, in der Praxis aber kaum realisierbar ist. Daher stellt das Mehrheitsprinzip die größtmögliche Annäherung an Freiheit und Gleichheit dar.
Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie
Das Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Mehrheitsprinzips und dessen Bedeutung in westlichen Demokratien. Es wird diskutiert, dass das Mehrheitsprinzip zwar keine normative Rechtfertigung hat, sich aber als praktikables Mittel zur Entscheidungsfindung durchgesetzt hat. Die Notwendigkeit von Mehrheitsentscheidungen wird dabei aus der Sicht der Funktionalität des politischen Systems begründet.
Die Grenzen des Mehrheitsprinzips am Beispiel der Europäischen Union
Fehlende Identitäten
Der Text analysiert die Probleme der Anwendung des Mehrheitsprinzips in der EU und argumentiert, dass die mangelnde Identifikation der Bürger mit der EU eine große Herausforderung darstellt. Die Schwäche der europäischen Identität erschwert die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen.
Fehlende Routinen
Der Text betont, dass fehlende Routinen und Prozesse im politischen System der EU die Anwendung des Mehrheitsprinzips erschweren. Die mangelnde politische Kultur und Erfahrung in der europäischen Integration führt zu Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen und Konzepte wie Demokratie, Mehrheitsprinzip, Legitimation, Akzeptanz, Entscheidungsfindung, Identifikation, Routinen, europäische Integration und politische Kultur. Der Fokus liegt auf der Analyse der Grenzen des Mehrheitsprinzips in der Europäischen Union und der Herausforderungen, die sich aus der mangelnden Identifikation und den fehlenden Routinen ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Mehrheitsprinzip in der Demokratie?
Es ist ein Rechtsgrundsatz, nach dem sich der Wille der Mehrheit gegenüber der Minderheit durchsetzt und für alle Beteiligten verbindlich wird.
Warum stößt das Mehrheitsprinzip in der EU an Grenzen?
In der EU fehlen oft eine starke gemeinsame Identität und etablierte politische Routinen, was die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen über nationale Grenzen hinweg erschwert.
Ist ein Konsens immer besser als eine Mehrheitsentscheidung?
Ein echter Konsens ist ideal, aber in komplexen Gesellschaften oft unrealisierbar. Das Mehrheitsprinzip dient daher als praktikable Annäherung an Freiheit und Gleichheit.
Welche Rolle spielt die Identifikation für demokratische Entscheidungen?
Nur wenn sich die Minderheit als Teil derselben Gemeinschaft fühlt wie die Mehrheit, ist sie bereit, Entscheidungen zu akzeptieren, die gegen ihre eigenen Interessen laufen.
Wie werden Entscheidungen gerechtfertigt, wenn kein Konsens möglich ist?
Durch demokratisch legitimierte Verfahren wie Wahlen und Abstimmungen, die sicherstellen, dass die Mehrheit für alle verbindlich entscheiden darf.
- Quote paper
- MSc. M.A. Robert Fiedler (Author), 2005, An den Grenzen des Mehrheitsprinzips - Die Problematik der Anwendung auf überstaatlicher Ebene am Beispiel der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163697