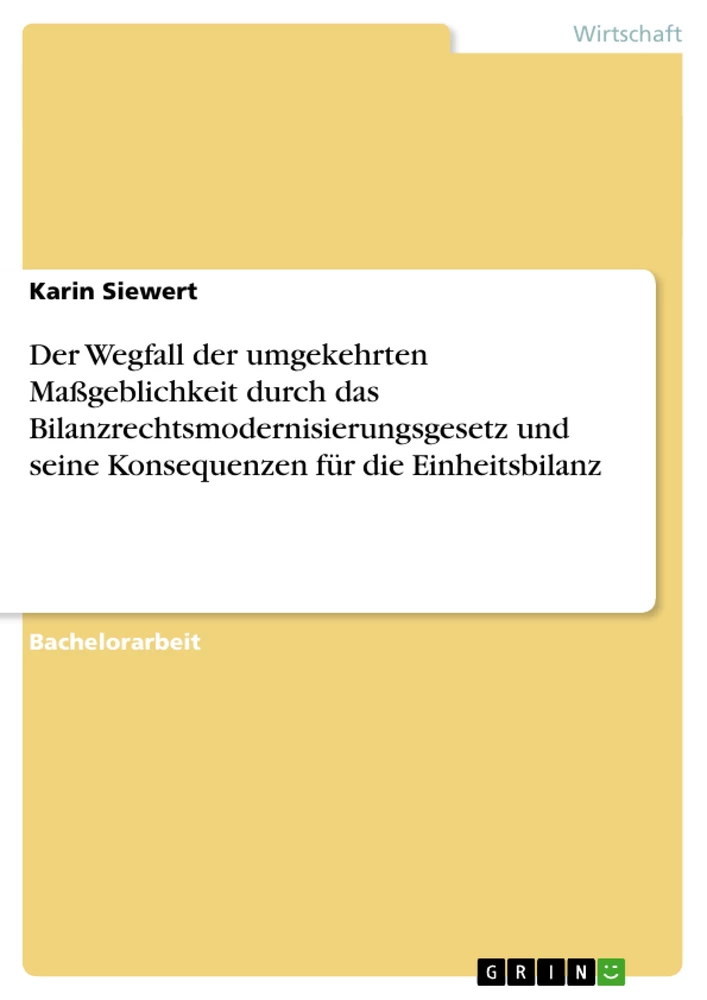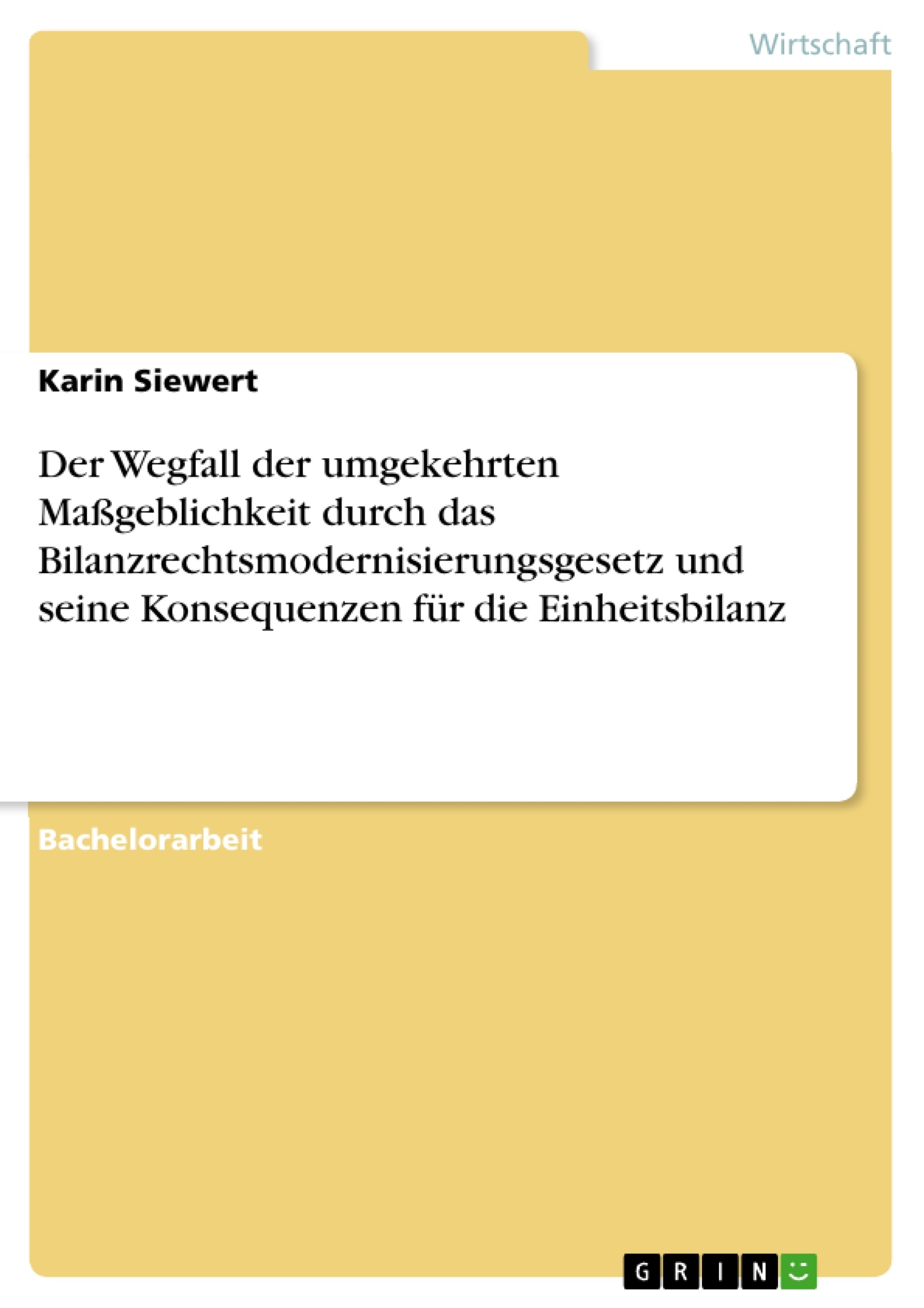„Man kann sich nur wundern, wie eine Regelung, die aus steuerrechtlicher Sicht ohne Sinn ist und auf der anderen Seite die Handelsbilanz deformiert und was den Sonderposten mit Rücklageanteil anbetrifft, gemeinschaftsrechtlich nicht zulässig ist, hat Gesetz werden können; es haben wohl geheime Mächte gewirkt.“
So schrieb Brigitte Knobbe-Keuk, ihre Ausführungen zum Maßgeblichkeitsgrundsatz abschließend, über die umgekehrte Maßgeblichkeit (1991: 28). Tatsächlich war die umgekehrte Maßgeblichkeit Zeit ihrer Existenz höchst umstritten, „so gut wie einhellig“ wurde ihre Abschaffung bis zuletzt gefordert (Endriss, BBK 2010: 413). Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25.05.2009 wurde diese Abschaffung - die Kritiker mögen sagen „endlich“ - durchgeführt.
Allerdings hat auch die Neuregelung der Inanspruchnahme von steuerlichen Wahlrechten zu großen Diskussionen in der Fachwelt geführt. Gerade durch die neuen Vorschriften werde die Knüpfung des Steuerrechts an das Handelsrecht weiter gelockert, vielfach sei eine Einheitsbilanz dadurch kaum noch möglich. Eine weitere Entwicklung in diese Richtung würde das Ende der Einheitsbilanz und eine Abkehr vom Maßgeblichkeitsprinzip bedeuten.
Zu Beginn dieser Arbeit werden die Grundlagen der steuerlichen Gewinnermittlung vor der Bilanzrechtsreform sowie die Idee der Einheitsbilanz erläutert. Danach werden die Grundideen des BilMoG beschrieben und die Änderungen für den Grundsatz der Maßgeblichkeit durch das BilMoG aufgeführt. Abschließend wird analysiert, inwieweit die Erstellung einer Einheitsbilanz nach der Reform noch möglich ist und welchen Einfluss der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit und die Neuregelung der steuerlichen Wahlrechte auf die „neue“ Einheitsbilanz haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der einkommensteuerlichen Gewinnermittlung
- Prinzipien der Gewinnermittlung nach § 5 EStG vor dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- Der Maßgeblichkeitsgrundsatz
- Die materielle Maßgeblichkeit
- Durchbrechungen der Maßgeblichkeit
- Die formelle und die umgekehrte Maßgeblichkeit
- Begriffsdefinition
- Entstehung und Entwicklung
- Mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung konforme steuerliche Wahlrechte
- Mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung nicht vereinbare steuerliche Wahlrechte
- Kritik an der umgekehrten Maßgeblichkeit
- Die Einheitsbilanz
- Die Idee der Einheitsbilanz
- Die totale Einheitsbilanz
- Die partielle Einheitsbilanz
- Voraussetzungen und Beurteilung der Einheitsbilanz
- Praktische Bedeutung der Einheitsbilanz
- Die Idee der Einheitsbilanz
- Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- Ziele der Bilanzrechtsreform
- Entstehung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- Überblick über die Neuregelungen
- Die Änderungen in den Grundlagen der Gewinnermittlung nach § 5 EStG durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- Der Maßgeblichkeitsgrundsatz
- Der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit und die Neuregelung der Ausübung steuerlicher Wahlrechte
- Lediglich steuerrechtlich bestehende Wahlrechte
- Handels- und steuerrechtliche Wahlrechte
- Aufzeichnungspflichten
- Anwendungsregelung
- Auswirkungen der Bilanzrechtsreform auf die Einheitsbilanz
- Folgen der Änderungen von wesentlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften
- Konsequenzen aus dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
- Die Möglichkeit der Aufstellung einer Einheitsbilanz
- Die Zukunft der Einheitsbilanz
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und dessen Auswirkungen auf die Einheitsbilanz. Sie analysiert die Hintergründe der Reform, die damit verbundenen Änderungen in der Gewinnermittlung nach § 5 EStG und deren Folgen für die Praxis der Einheitsbilanz.
- Die Entwicklung und Funktionsweise der umgekehrten Maßgeblichkeit
- Die Ziele und Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- Die Neuregelung der Ausübung steuerlicher Wahlrechte nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
- Die Auswirkungen des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit auf die Einheitsbilanz
- Die Zukunft der Einheitsbilanz im Kontext der Bilanzrechtsreform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Untersuchung und die Forschungsfrage erläutert. Kapitel 2 stellt die Grundlagen der einkommensteuerlichen Gewinnermittlung dar. Kapitel 3 behandelt die Prinzipien der Gewinnermittlung nach § 5 EStG vor dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, mit besonderem Fokus auf die umgekehrte Maßgeblichkeit. Kapitel 4 widmet sich der Einheitsbilanz und ihren verschiedenen Formen, Voraussetzungen und der praktischen Bedeutung. Kapitel 5 beleuchtet das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, seine Entstehungsgeschichte und die zentralen Änderungen. In Kapitel 6 werden die Auswirkungen der Bilanzrechtsreform auf die Grundlagen der Gewinnermittlung nach § 5 EStG detailliert analysiert. Kapitel 7 schließlich untersucht die Folgen der Bilanzrechtsreform für die Einheitsbilanz, einschließlich der Konsequenzen aus dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit, welches die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst und die zukünftige Entwicklung der Einheitsbilanz im Kontext der Bilanzrechtsreform beleuchtet.
Schlüsselwörter
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, Einheitsbilanz, umgekehrte Maßgeblichkeit, Gewinnermittlung, § 5 EStG, steuerliche Wahlrechte, Ansatz- und Bewertungsvorschriften, Bilanzrechtsreform, handelsrechtliche Vorschriften, steuerrechtliche Vorschriften
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit?
Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) von 2009 wurde die umgekehrte Maßgeblichkeit abgeschafft. Das bedeutet, dass steuerrechtliche Wahlrechte nicht mehr zwingend in der Handelsbilanz ausgeübt werden müssen, um steuerlich anerkannt zu werden.
Was ist das Hauptziel des BilMoG?
Das BilMoG zielte darauf ab, das deutsche Bilanzrecht zu modernisieren, die Aussagekraft der Handelsbilanz zu erhöhen und die Verknüpfung zwischen Handels- und Steuerrecht zu lockern.
Was ist eine Einheitsbilanz?
Eine Einheitsbilanz ist eine Bilanz, die sowohl den handelsrechtlichen als auch den steuerrechtlichen Vorschriften genügt, sodass nur ein einziger Abschluss für beide Zwecke erstellt werden muss.
Ist die Einheitsbilanz nach dem BilMoG noch praktikabel?
Durch die Auseinanderentwicklung von Handels- und Steuerrecht wird die Erstellung einer Einheitsbilanz schwieriger. Die Arbeit analysiert, inwieweit sie unter den neuen Rahmenbedingungen noch möglich ist.
Was besagt der Maßgeblichkeitsgrundsatz nach § 5 EStG?
Er besagt, dass für die steuerliche Gewinnermittlung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung der Handelsbilanz maßgebend sind, sofern keine spezifischen steuerlichen Vorschriften entgegenstehen.
- Citation du texte
- Karin Siewert (Auteur), 2010, Der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz und seine Konsequenzen für die Einheitsbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163731