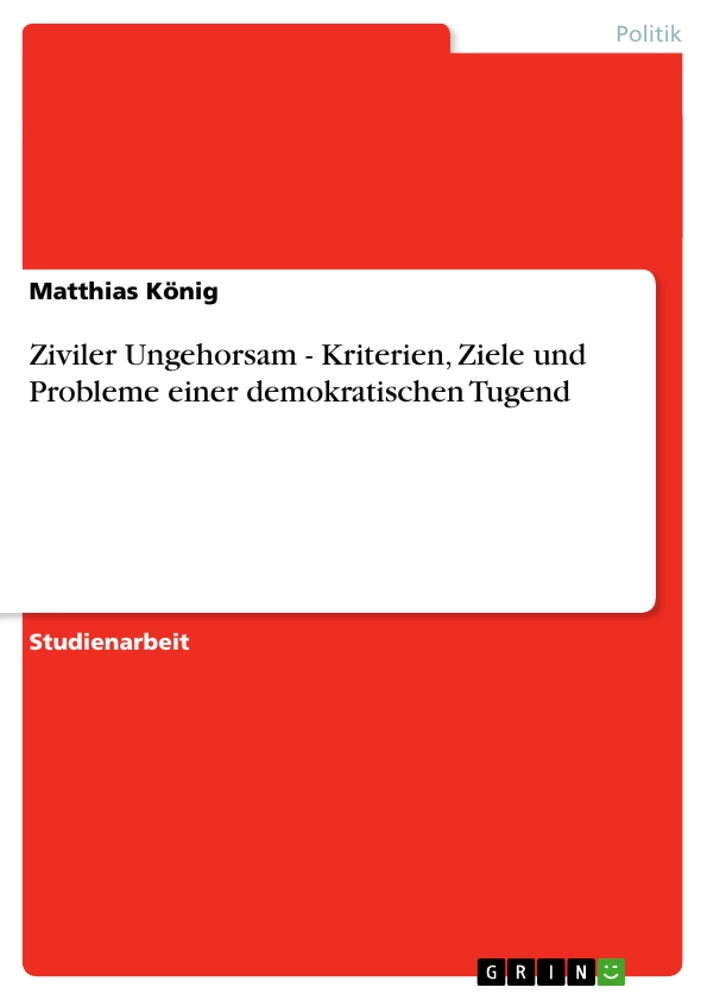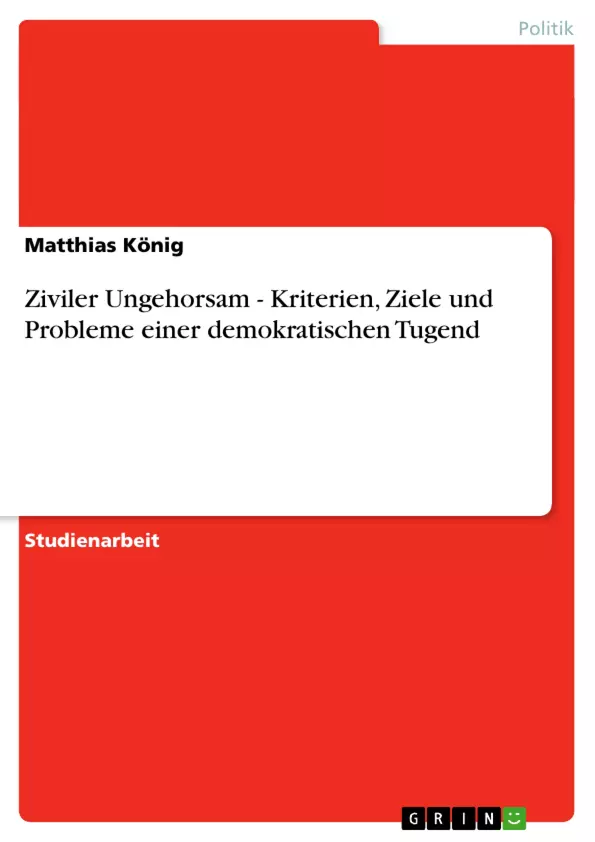Seit Anfang der 1960er Jahre, lässt sich in Deutschland das Phänomen des zivilen
Ungehorsams beobachten, welches – damals noch häufig unter der Bezeichnung
„passive Gewalt“ – erstmals im Rahmen der Abrüstungskampagne und später am
Rande des studentischen Protests vereinzelt in Erscheinung trat. Durch die neue
Friedensbewegung und die Anti-AKW-Bewegung der 1970er Jahre wurde die Praxis
des zivilen Ungehorsam als politische Losung und Handlungskonzept eingebürgert
und tritt seither des öfteren in Form von Sitzblockaden, Platzbesetzungen und Boykotts
in Erscheinung.1
Der zivile Ungehorsam folgt bestimmten „Spielregeln“, die ihn als solchen auszeichnen
und dadurch von anderen Formen des Widerstands abgrenzen. Im Verlauf dieser
Arbeit werden jene Kriterien aufgeführt und deren Bedeutung erläutert. Des weiteren
wird es darum gehen, die demokratietheoretische Bedeutung des zivilen Ungehorsams
herauszuarbeiten, zu untersuchen, wie er entsteht, was er bewirkt und was seine
Ziele sind. Bei der Analyse der mit dem zivilen Ungehorsam einhergehenden Probleme,
werden die von Rawls aufgezeigte Pflichtenkollision der Bürger, die Unvereinbarkeit
des gezielten Gesetzesbruchs mit dem Rechtssystem sowie die Nähe zwischen
zivilem Ungehorsam und Gewalt thematisiert. Im Anschluss daran wird näher
auf Bedingungen eingegangen, die den zivilen Ungehorsam nach Ansicht von John
Rawls rechtfertigen, abschließend wird Hannah Arendts Forderung nach der politischen
Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams näher erläutert.
1 vgl. Rödel/Frankenberg/Dubiel (1989), S. 22
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kriterien des zivilen Ungehorsams
- 2.1. Öffentlichkeit
- 2.2. Gewaltlosigkeit
- 2.3. Gesetzwidrigkeit
- 2.4. Gewissensbestimmtheit
- 3. Wie entsteht ziviler Ungehorsam?
- 4. Zweck und Ziele des zivilen Ungehorsams
- 5. Probleme des zivilen Ungehorsams
- 5.1. Der Pflichtenkonflikt der Bürger
- 5.2. Ziviler Ungehorsam und das deutsche Rechtssystem
- 5.3. Ziviler Ungehorsam und Gewalt
- 6. Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
- 7. Die politische Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams
- 8. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des zivilen Ungehorsams in Deutschland, insbesondere seine Kriterien, Ziele und Probleme im Kontext der Demokratie. Die Arbeit analysiert die demokratietheoretische Bedeutung und beleuchtet die Entstehung, die Wirkung und die Ziele dieser Form des politischen Widerstands.
- Kriterien des zivilen Ungehorsams (Öffentlichkeit, Gewaltlosigkeit, Gesetzwidrigkeit, Gewissensbestimmtheit)
- Entstehung und Ziele des zivilen Ungehorsams
- Probleme des zivilen Ungehorsams (Pflichtenkonflikt, Rechtssystemkonflikt, Gewaltpotential)
- Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams
- Politische Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des zivilen Ungehorsams ein und skizziert dessen historische Entwicklung in Deutschland seit den 1960er Jahren im Kontext von Abrüstungskampagnen, Studentenprotesten, Friedensbewegungen und Anti-AKW-Bewegungen. Sie beschreibt den zivilen Ungehorsam als ein politisches Handlungskonzept, das sich durch spezifische Kriterien von anderen Widerstandsformen abgrenzt und kündigt die weiteren Kapitelthemen an: Kriterien, Entstehung, Ziele, Probleme und Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams sowie dessen mögliche politische Institutionalisierung.
2. Kriterien des zivilen Ungehorsams: Dieses Kapitel definiert zivilen Ungehorsam als bewusste und gezielte Verletzung von Rechtsnormen, die auf öffentliche Meinungs- und Willensbildung abzielt. Es werden die zentralen Kriterien nach Rawls erläutert: Öffentlichkeit (als Appell an die Öffentlichkeit und öffentlicher Handlungsort), Gewaltlosigkeit (als Ausdruck des Appells und Abgrenzung zu anderen Widerstandsformen), Gesetzwidrigkeit (mit Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Ungehorsam) und Gewissensbestimmtheit (als Ausdruck innerer Überzeugung). Die Kapitel analysiert die Bedeutung jedes Kriteriums und seine Rolle in der Abgrenzung zu anderen Formen des Widerstands. Es verweist auf die Ansichten von Arendt und Rawls, um die Bedeutung der Öffentlichkeit und Gewaltlosigkeit zu unterstreichen.
3. Wie entsteht ziviler Ungehorsam?: (Leider fehlt im bereitgestellten Text der Inhalt für Kapitel 3. Daher kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.)
4. Zweck und Ziele des zivilen Ungehorsams: (Leider fehlt im bereitgestellten Text der Inhalt für Kapitel 4. Daher kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.)
5. Probleme des zivilen Ungehorsams: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Konflikte, die mit zivilem Ungehorsam verbunden sind. Es thematisiert den Pflichtenkonflikt der Bürger (nach Rawls), die potenzielle Unvereinbarkeit mit dem deutschen Rechtssystem und die Gefahr der Eskalation zu Gewalt. Es wird diskutiert, wie der gezielte Gesetzesbruch mit der Rechtsordnung im Einklang stehen kann und welche Grenzen der zivile Ungehorsam beachten sollte, um nicht zu gewaltsamen Konflikten zu führen.
6. Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams: (Leider fehlt im bereitgestellten Text der Inhalt für Kapitel 6. Daher kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.)
7. Die politische Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams: (Leider fehlt im bereitgestellten Text der Inhalt für Kapitel 7. Daher kann hier keine Zusammenfassung erfolgen.)
Schlüsselwörter
Ziviler Ungehorsam, Gewaltlosigkeit, Öffentlichkeit, Gesetzwidrigkeit, Gewissensbestimmtheit, Demokratie, Rechtssystem, Pflichtenkonflikt, politische Institutionalisierung, Rawls, Arendt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ziviler Ungehorsam in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des zivilen Ungehorsams in Deutschland. Sie analysiert dessen Kriterien, Ziele und Probleme im Kontext der Demokratie, beleuchtet die demokratietheoretische Bedeutung und untersucht Entstehung, Wirkung und Ziele dieser Form des politischen Widerstands.
Welche Kriterien des zivilen Ungehorsams werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die zentralen Kriterien des zivilen Ungehorsams nach Rawls: Öffentlichkeit (öffentlicher Handlungsort und Appell an die Öffentlichkeit), Gewaltlosigkeit (als Ausdruck des Appells und Abgrenzung zu anderen Widerstandsformen), Gesetzwidrigkeit (mit Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Ungehorsam) und Gewissensbestimmtheit (als Ausdruck innerer Überzeugung). Die Bedeutung jedes Kriteriums und seine Rolle in der Abgrenzung zu anderen Widerstandsformen wird analysiert.
Wie wird der zivile Ungehorsam in dieser Arbeit definiert?
Ziviler Ungehorsam wird definiert als bewusste und gezielte Verletzung von Rechtsnormen, die auf öffentliche Meinungs- und Willensbildung abzielt.
Welche Probleme des zivilen Ungehorsams werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet den Pflichtenkonflikt der Bürger (nach Rawls), die potenzielle Unvereinbarkeit mit dem deutschen Rechtssystem und die Gefahr der Eskalation zu Gewalt. Es wird diskutiert, wie der gezielte Gesetzesbruch mit der Rechtsordnung im Einklang stehen kann und welche Grenzen der zivile Ungehorsam beachten sollte, um nicht zu gewaltsamen Konflikten zu führen.
Welche Rolle spielen Rawls und Arendt in der Arbeit?
Die Ansichten von Arendt und Rawls werden herangezogen, um die Bedeutung der Öffentlichkeit und Gewaltlosigkeit im Kontext des zivilen Ungehorsams zu unterstreichen. Rawls' Konzept des Pflichtenkonflikts spielt eine zentrale Rolle in der Analyse der Probleme des zivilen Ungehorsams.
Welche historischen Beispiele für zivilen Ungehorsam in Deutschland werden erwähnt?
Die Einleitung erwähnt den zivilen Ungehorsam in Deutschland seit den 1960er Jahren im Kontext von Abrüstungskampagnen, Studentenprotesten, Friedensbewegungen und Anti-AKW-Bewegungen.
Welche Kapitel fehlen im bereitgestellten Text?
Die Kapitel 3 ("Wie entsteht ziviler Ungehorsam?"), 4 ("Zweck und Ziele des zivilen Ungehorsams"), 6 ("Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams") und 7 ("Die politische Institutionalisierung des zivilen Ungehorsams") sind im bereitgestellten Text nicht vollständig enthalten und können daher nicht zusammengefasst werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ziviler Ungehorsam, Gewaltlosigkeit, Öffentlichkeit, Gesetzwidrigkeit, Gewissensbestimmtheit, Demokratie, Rechtssystem, Pflichtenkonflikt, politische Institutionalisierung, Rawls, Arendt.
- Citation du texte
- Matthias König (Auteur), 2003, Ziviler Ungehorsam - Kriterien, Ziele und Probleme einer demokratischen Tugend, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16375