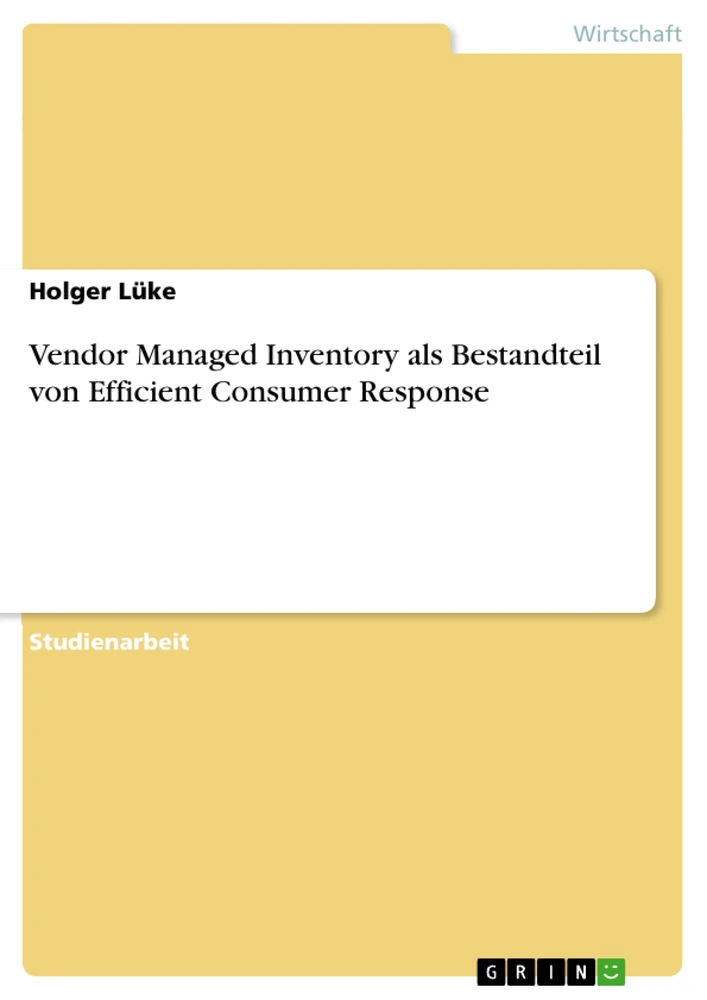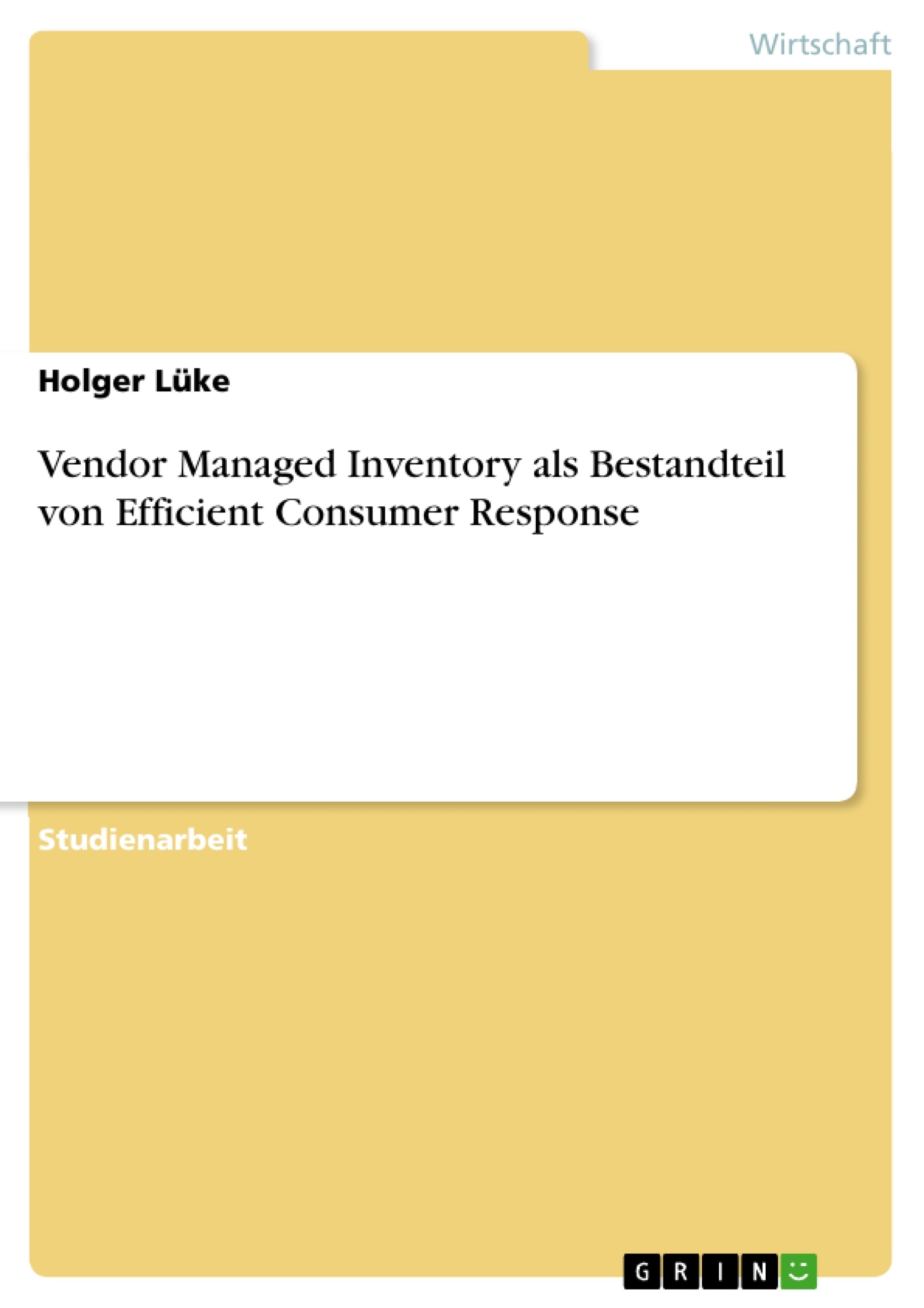Unter dem Überbegriff der Betriebswirtschaftslehre ist der Teilbereich Efficient Consumer Response (ECR) zum einen im Supply Chain Management (SCM) als Supply Side, zum anderen im Marketing als Demand Side, zu finden. Im Supply Chain Management stellt das Konzept Vendor Managed Inventory (VMI) eine Strategie des Efficient Replenishment (ER) dar. Neben einer steigenden Präsenz von Efficient Consumer Response und Vendor Managed Inventory in wissenschaftlicher Literatur lässt sich auch eine stärkere Frequentierung dieser Begriffe auf Internet-Suchmaschinen feststellen. Eine Analyse der direkten Suchanfragen in Deutschland an Google, ausgewertet in Google Trends, lässt seit einiger Zeit einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen „ECR“ und „VMI“ erkennen. In jüngerer Literatur wird Vendor Managed Inventory mittlerweile als Kernelement von ECR bewertet. Thematisch wird es überwiegend als Kooperationskonzept zwischen Industrie und (Einzel-)Handel betrachtet, hier werden durch die Anwendung vor allem Einsparpotentiale, etwa durch verringerte Bestände, sowie ein verbesserter Servicegrad erwartet, wodurch dem Abwärtstrend der sinkenden Rentabilität durch ruinöse Preiskämpfe in dieser Branche entgegengewirkt werden soll. Durch eine Verbesserung des Servicegrades sowie eine Verbesserung des Category Management auf der Demand Side soll eine positive Abhebung vom Wettbewerb erzielt werden. Dieses ist in der Literatur jedoch umstritten, erlangte Einsparungen werden beispielsweise unterschiedlich bewertet, sowie nicht unmittelbar auf den Einsatz von Vendor Managed Inventory zurückgeführt. Es lassen sich auch Bespiele für weitergehende Einsatzmöglichkeiten als Kooperationskonzept in der Literatur finden. Ein Beispiel ist die Abwandlung zum Supplier Managed Inventory, bei dem der Lieferant eines Industriebetriebes dessen Lager bewirtschaftet. Umstritten sind neben den Chancen auch mögliche Risiken. Durch den Austausch von sensiblen Daten sowie die enge Zusammenarbeit kann möglicherweise eine Abhängigkeit zwischen den Kooperationspartnern entstehen. Durch die tiefere Analyse der gegenseitig zur Verfügung gestellten Daten kann das Vertrauen der Partner beeinflusst werden. Mit dem Einsatz von Vendor Managed Inventory im Handel gibt dieser seine Kernkompetenz der eigenverantwortlichen Regalbewirtschaftung auf. Wichtig ist auch eine Betrachtung aus der Sicht des Endverbrauchers.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Efficient Consumer Response
- 2.1 Entstehung von Efficient Consumer Response
- 2.2 Aufbau von Efficient Consumer Response
- 2.3 Der Teilaspekt Efficient Replenishment in Efficient Consumer Response
- 3 Vendor Managed Inventory in Efficient Replenishment
- 3.1 Entstehung von Vendor Managed Inventory
- 3.2 Funktionsweise von Vendor Managed Inventory
- 3.3 Vorteile durch Vendor Managed Inventory
- 3.3.1 Vorteile für die Industrie
- 3.3.2 Vorteile für den Handel
- 3.4 Nachteile durch Vendor Managed Inventory
- 3.5 Operative Prozesse bei Vendor Managed Inventory
- 3.6 Anwendungsgebiete für Vendor Managed Inventory
- 3.6.1 Grundsätzliche Anwendungsgebiete
- 3.6.2 Praxisbeispiel Twentieth Century Fox
- 3.6.3 Praxisbeispiel dm-Drogeriemärkte
- 3.6.4 Praxisbeispiel BASF
- 4 Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Vendor Managed Inventory (VMI) als Bestandteil von Efficient Consumer Response (ECR) im Kontext des Supply Chain Managements. Ziel ist es, die Funktionsweise, Vorteile, Nachteile und Anwendungsgebiete von VMI zu untersuchen und dessen Bedeutung für Industrie und Handel zu bewerten.
- Definition und Einordnung von ECR und VMI
- Funktionsweise und operative Prozesse von VMI
- Vorteile und Nachteile von VMI für Industrie und Handel
- Anwendungsbeispiele von VMI in der Praxis
- Bewertung der Bedeutung von VMI im Kontext von ECR
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik von Efficient Consumer Response (ECR) und Vendor Managed Inventory (VMI) ein und ordnet diese im Kontext des Supply Chain Managements und Marketings ein. Sie hebt die steigende Bedeutung beider Konzepte in der wissenschaftlichen Literatur und im Internet hervor und benennt zentrale Forschungsfragen. Die Einleitung skizziert die umstrittene Bewertung der Einsparungen durch VMI und die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Supplier Managed Inventory. Sie weist auf mögliche Risiken wie Abhängigkeiten zwischen Kooperationspartnern und den Einfluss auf das gegenseitige Vertrauen hin und betont die Bedeutung der Betrachtung aus Sicht des Endverbrauchers. Schließlich umreißt sie den Aufbau der Arbeit, der sich auf die Definition von ECR, die detaillierte Analyse von VMI inklusive Vor- und Nachteile sowie Praxisbeispiele konzentriert.
2 Efficient Consumer Response: Dieses Kapitel definiert Efficient Consumer Response (ECR) und ordnet es im Supply Chain Management ein. Es beschreibt den Aufbau von ECR und die einzelnen Teilkonzepte, die darin zusammengefasst sind, einschließlich des wichtigen Aspekts "Efficient Replenishment", in dem VMI eine zentrale Rolle spielt. Der Fokus liegt auf der Strukturierung und der Darstellung des Gesamtkonzepts ECR und seiner verschiedenen Bausteine, die für ein umfassendes Verständnis von VMI als integriertem Element unerlässlich sind. Die Beschreibung der Entstehung und Entwicklung von ECR bildet den Kontext für die spätere detaillierte Analyse von VMI.
3 Vendor Managed Inventory in Efficient Replenishment: Das Kernkapitel befasst sich umfassend mit Vendor Managed Inventory (VMI). Es beleuchtet die historische Entwicklung und Funktionsweise von VMI, analysiert detailliert die Vor- und Nachteile sowohl für die Industrie als auch für den Handel und präsentiert mehrere Praxisbeispiele (Twentieth Century Fox, dm-Drogeriemärkte, BASF), um die Anwendung von VMI in verschiedenen Branchen zu veranschaulichen. Die Kapitel untersuchen die operativen Prozesse im Detail und bieten eine fundierte Bewertung der Implementierung und des Nutzens von VMI. Die verschiedenen Beispiele sollen die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten und die spezifischen Herausforderungen in unterschiedlichen Kontexten aufzeigen.
Schlüsselwörter
Efficient Consumer Response (ECR), Vendor Managed Inventory (VMI), Supply Chain Management (SCM), Efficient Replenishment (ER), Kooperation, Industrie, Handel, Bestandsoptimierung, Servicegrad, Vorteile, Nachteile, Praxisbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vendor Managed Inventory (VMI) im Kontext von Efficient Consumer Response (ECR)
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Vendor Managed Inventory (VMI) als Teil von Efficient Consumer Response (ECR) im Supply Chain Management. Sie untersucht die Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie Anwendungsgebiete von VMI und bewertet dessen Bedeutung für Industrie und Handel. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu ECR und VMI, eine abschließende Betrachtung und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Was ist Efficient Consumer Response (ECR)?
ECR ist ein ganzheitliches Konzept im Supply Chain Management, das darauf abzielt, die Effizienz der gesamten Lieferkette zu verbessern und den Konsumenten besser zu bedienen. Die Arbeit beschreibt den Aufbau von ECR und seine Teilkonzepte, insbesondere "Efficient Replenishment", in dem VMI eine zentrale Rolle spielt.
Was ist Vendor Managed Inventory (VMI)?
VMI ist ein Bestandteil von Efficient Replenishment innerhalb von ECR. Dabei verwaltet der Lieferant (Vendor) den Lagerbestand seines Kunden. Die Arbeit beschreibt detailliert die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile für Industrie und Handel, operative Prozesse und Anwendungsgebiete von VMI.
Welche Vorteile bietet VMI?
VMI bietet Vorteile sowohl für die Industrie (z.B. verbesserte Absatzplanung, reduzierte Lagerhaltungskosten) als auch für den Handel (z.B. verbesserte Lieferfähigkeit, reduzierter Verwaltungsaufwand). Die Arbeit analysiert diese Vorteile im Detail.
Welche Nachteile bringt VMI mit sich?
VMI birgt auch Risiken, z.B. erhöhte Abhängigkeit zwischen Kooperationspartnern, Einfluss auf das gegenseitige Vertrauen und mögliche Informationsasymmetrien. Die Arbeit beleuchtet diese Nachteile.
Welche Praxisbeispiele werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Praxisbeispiele von VMI bei Twentieth Century Fox, dm-Drogeriemärkte und BASF, um die Anwendung in verschiedenen Branchen zu veranschaulichen und die spezifischen Herausforderungen in unterschiedlichen Kontexten aufzuzeigen.
Welche operativen Prozesse sind bei VMI relevant?
Die Arbeit beschreibt die operativen Prozesse bei VMI detailliert, um ein umfassendes Verständnis der Implementierung und des Nutzens von VMI zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Efficient Consumer Response (ECR), Vendor Managed Inventory (VMI), Supply Chain Management (SCM), Efficient Replenishment (ER), Kooperation, Industrie, Handel, Bestandsoptimierung, Servicegrad, Vorteile, Nachteile, Praxisbeispiele.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu ECR, ein Kernkapitel zu VMI mit detaillierter Analyse von Funktionsweise, Vor- und Nachteilen sowie Praxisbeispielen, und eine abschließende Betrachtung. Der Aufbau ist im Inhaltsverzeichnis detailliert dargestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, VMI als Bestandteil von ECR zu analysieren, die Funktionsweise, Vor- und Nachteile zu untersuchen und die Bedeutung von VMI für Industrie und Handel zu bewerten.
- Quote paper
- Holger Lüke (Author), 2010, Vendor Managed Inventory als Bestandteil von Efficient Consumer Response, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163803