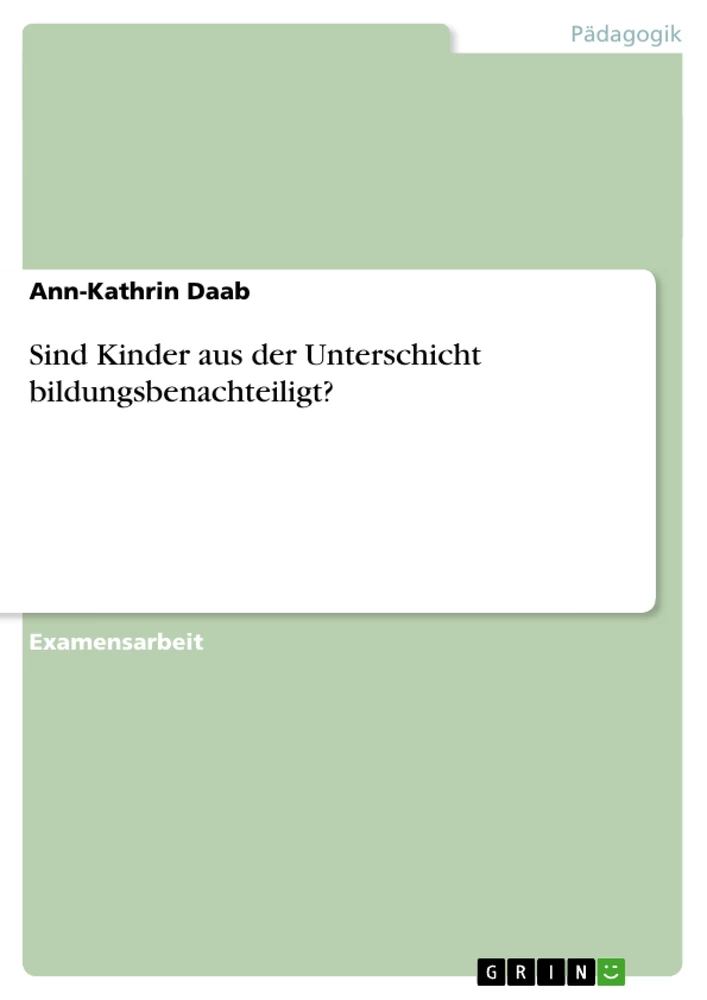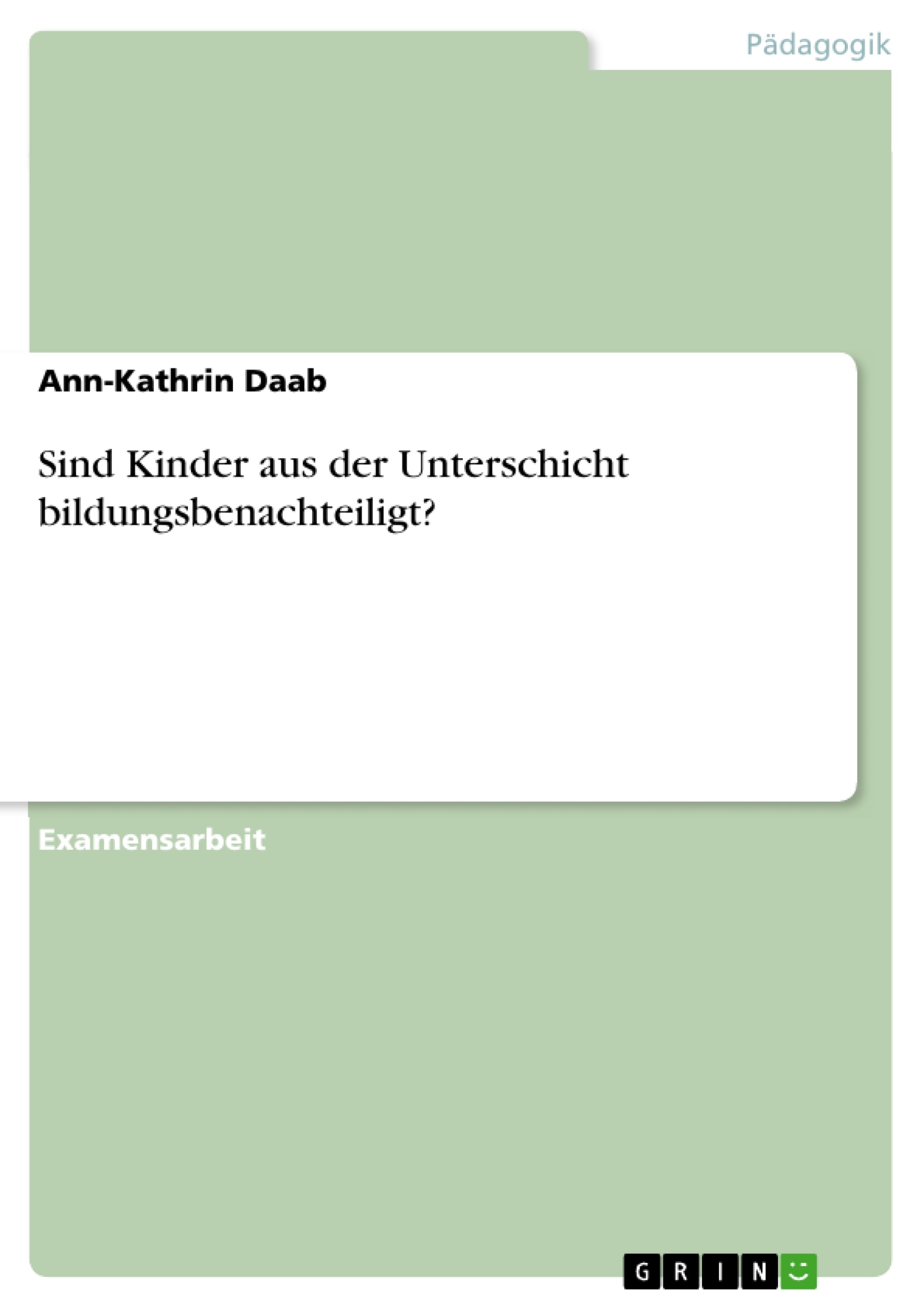Diese Examensarbeit geht der Frage nach, ob die Unterschicht gegenwärtig bildungsbenachteiligt ist. Daraus ergeben sich weitere Unterfragen: Sollte die Unterschicht tatsächlich bildungsbenachteiligt sein, inwiefern könnte dann die soziale Herkunft neben den kognitiven Fähigkeiten die Schullaufbahn beeinflussen? Wie müsste Schule gestaltet sein, um Chancengleichheit herzustellen?
Zu Beginn der Examensarbeit werden vier aktuelle Studien vorgestellt. Diese Studien werden gezielt danach analysiert, ob sie auf schichtspezifische Chancenungleichheiten bezüglich des Schulerfolges hinweisen. Damit soll überprüft werden, ob Kinder der unteren Sozialschicht noch immer benachteiligt in ihrer Bildungslaufbahn sind (Kap. 2).
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Frage, wie etwaige Bildungsbenachteiligungen erklärt werden könnten.
Als Grundlage wird zunächst ein Erklärungsansatz von Pierre Bourdieu dargelegt. Hier wird erläutert, welche sozialen Gruppen Bourdieu unterscheidet. Es wird beschrieben, welche kulturellen, sozialen und ökonomischen Ressourcen Bourdieu den jeweiligen Schichten zuschreibt. Ebenso wird aufgezeigt, welche Vor- bzw. Nachteile aus der schichtspezifischen Ressourcenverteilung hinsichtlich des Schulerfolgs entstehen.
Anschließend werden weitere Erklärungsansätze dargestellt, welche aktuell in Forschungsliteratur diskutiert werden. Eingangs wird untersucht, wie sich die familiäre Sozialisation zwischen den Schichten bezüglich schulrelevanter Denk- und Verhaltensweisen unterscheidet. Daraufhin werden jene vermittelten Dispositionen mit den Leistungs- und Verhaltensanforderungen verglichen, welche die Schule an ihre Schüler stellt. Vor diesem Hintergrund werde ich ableiten können, wie sich die familiäre Sozialisation auf den Bildungserfolg auswirkt.
Anknüpfend werden der kulturökologische Ansatz von John Ogbu und die Kulturforschung Hofstedes mit zur Klärung der Chancenungleichheit herangezogen. Auch die Rational-Choice Theorie wird vorgestellt, welche hauptsächlich Aufschluss über schichtspezifische Bildungsentscheidungen seitens der Eltern geben soll.
Danach wird verglichen, inwieweit diese aktuellen Ergebnisse mit den Thesen Bourdieus vereinbar sind (Kapitel 3.3).
In der Schlussbetrachtung werden zentrale Ergebnisse zusammengefasst wie auch Antworten auf die eingangs gestellten Fragen formuliert.
Kapitel 4.2 zeigt Handlungsmöglichkeiten auf, welche potenzielle Bildungsnachteile der Unterschicht aufheben oder kompensieren könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktueller Forschungsstand
- 2.1 „Bildungschancen und Lernbedingungen an Wiesbadener Grundschulen am Übergang zur Sekundarstufe I“
- 2.2 Kinder in Deutschland 2010
- 2.3 „TIMSS 2007“
- 2.4 „IGLU-E 2006“
- 2.5 Auswertung der Studien
- 3. Erklärungsansätze
- 3.1 Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu
- 3.2 Aktuell diskutierte Erklärungsansätze
- 3.3 Vergleich der Habitustheorie von Bourdieu mit aktuelleren Erklärungsansätzen
- 4. Schlussbetrachtung
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Implikationen
- 4.3 Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit untersucht die Frage der Bildungsbenachteiligung von Kindern aus der Unterschicht. Die Arbeit analysiert, inwieweit die soziale Herkunft neben kognitiven Fähigkeiten die Schullaufbahn beeinflusst und welche Schulgestaltung Chancengleichheit fördern könnte. Die Studie basiert auf der Analyse aktueller Studien und theoretischer Erklärungsansätze.
- Analyse aktueller Studien zur Bildungsbenachteiligung
- Bewertung der Relevanz der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu
- Diskussion weiterer aktueller Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten
- Entwicklung von Implikationen für die Gestaltung chancengerechter Schulen
- Reflexion des persönlichen Nutzens für die zukünftige Lehrtätigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Bildungsbenachteiligung von Kindern der Unterschicht und die daraus abgeleiteten Unterfragen. Sie verweist auf die Unterrepräsentanz von Jugendlichen aus unteren Gesellschaftsschichten in höheren Bildungswegen, basierend auf Ergebnissen der PISA-Studie 2000, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung verdeutlicht die Relevanz der Fragestellung für die zukünftige Lehrtätigkeit der Verfasserin.
2. Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert vier Studien (Wiesbadener Vollerhebung 2007, World Vision Kinderstudie 2010, TIMSS 2007, IGLU-E 2006), die sich mit Grundschulkindern und deren Übergang in die Sekundarstufe befassen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung schichtspezifischer Chancenungleichheiten im Hinblick auf den Schulerfolg und der Frage, ob Kinder aus unteren Sozialschichten in ihrer Bildungslaufbahn benachteiligt sind. Die Auswahl der Studien wird durch die Relevanz für die Fragestellung und den Fokus auf den Übergang in die Sekundarstufe begründet. Die geringe Durchlässigkeit des Bildungssystems nach dem Übergang von der Grundschule wird als wichtiger Kontext hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Bildungsbenachteiligung, Unterschicht, soziale Herkunft, Schullaufbahn, Chancengleichheit, Habitus (Bourdieu), familiäre Sozialisation, PISA-Studie, IGLU-Studie, TIMSS-Studie, sozioökonomischer Hintergrund, Schulformwahl, Bildungsaspirationen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Examensarbeit: Bildungsbenachteiligung von Kindern aus der Unterschicht
Was ist das Thema der Examensarbeit?
Die Examensarbeit untersucht die Bildungsbenachteiligung von Kindern aus der Unterschicht. Sie analysiert den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Schullaufbahn und sucht nach Möglichkeiten zur Förderung von Chancengleichheit im Schulsystem.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert vier Studien: „Bildungschancen und Lernbedingungen an Wiesbadener Grundschulen am Übergang zur Sekundarstufe I“, „Kinder in Deutschland 2010“, „TIMSS 2007“ und „IGLU-E 2006“. Diese Studien befassen sich mit Grundschulkindern und ihrem Übergang in die Sekundarstufe, mit dem Schwerpunkt auf schichtspezifischen Chancenungleichheiten.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich vor allem auf die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu und diskutiert zusätzlich weitere aktuelle Erklärungsansätze für Bildungsungleichheiten. Ein Vergleich der Habitustheorie mit diesen neueren Ansätzen wird ebenfalls vorgenommen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit die soziale Herkunft neben kognitiven Fähigkeiten die Schullaufbahn beeinflusst. Weitere Unterfragen befassen sich mit der Analyse aktueller Studien zur Bildungsbenachteiligung, der Relevanz der Habitus-Theorie und der Entwicklung von Implikationen für die Gestaltung chancengerechter Schulen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Aktueller Forschungsstand, Erklärungsansätze, Schlussbetrachtung (inklusive Zusammenfassung, Implikationen und Fazit) und Literaturverzeichnis sowie ein Abbildungsverzeichnis.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Kapitel „Schlussbetrachtung“ präsentiert und beinhaltet eine Zusammenfassung der Ergebnisse, deren Implikationen für die Praxis und ein abschließendes Fazit. Die genauen Ergebnisse sind im Volltext der Arbeit nachzulesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Bildungsbenachteiligung, Unterschicht, soziale Herkunft, Schullaufbahn, Chancengleichheit, Habitus (Bourdieu), familiäre Sozialisation, PISA-Studie, IGLU-Studie, TIMSS-Studie, sozioökonomischer Hintergrund, Schulformwahl und Bildungsaspirationen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist relevant für alle, die sich mit Bildungsbenachteiligung, sozialer Ungleichheit und Chancengleichheit im Bildungssystem auseinandersetzen, insbesondere für Lehrende und pädagogische Fachkräfte.
Wo finde ich den vollständigen Text der Arbeit?
Der vollständige Text der Arbeit ist nicht hier verfügbar. Diese HTML-Datei bietet lediglich eine umfassende Vorschau mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung, Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörtern.
- Quote paper
- Ann-Kathrin Daab (Author), 2010, Sind Kinder aus der Unterschicht bildungsbenachteiligt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163808