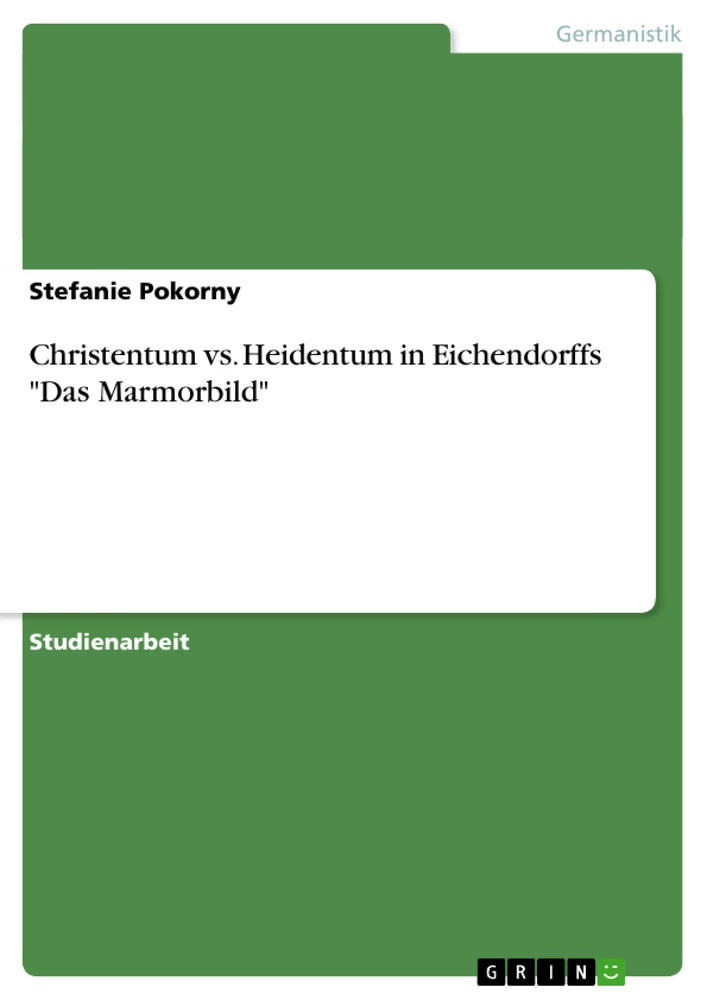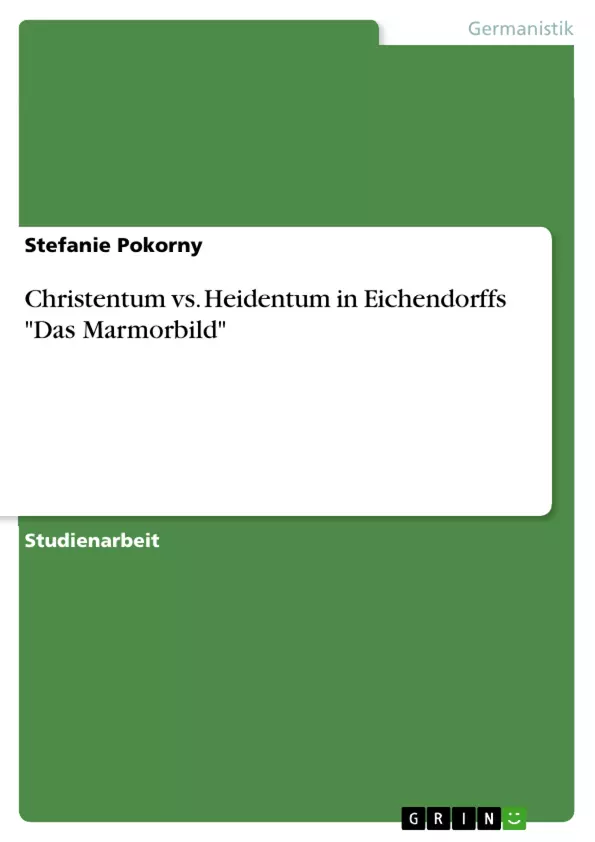Eichendorffs Novelle "Das Marmorbild" entstand vermutlich zwischen dem Sommer 1816 und dem Frühjahr 1817 und erschien in Foqués "Frauentaschenbuch für das Jahr 1819". Auf die Entstehungsgeschichte wird hier nicht weiter eingegangen, doch es sei darauf hingewiesen, dass die Venus-Thematik, die Eichendorff in diesem Werk verarbeitet, in der Romantik ein zentrales Motiv war.
Kurz gefasst handelt die Novelle von dem jungen Dichter Florio, der sich am Scheideweg seines Lebens für eine von zwei antagonistischen Lebensweisen entscheiden muss: Wollust und Heidentum oder Frömmigkeit und Christentum. Als Begleiter auf seinem Weg fungieren Fortunatu und Bianka als Vertreter des Christentums und gegensätzlich dazu Donati und Venus als Vertreter des Heidentums. "Eichendorff zufolge war das antike Weltgefühl geprägt durch eine Bejahung und Verherrlichung des Sinnlichen." Diese irdischen Gelüste werden in der Figur der Venus verkörpert, die versucht, Florio auf die dunkle Seite zu locken. Wenn dieser sich zwischen den beiden Seiten entscheiden muss, "so geht es nicht nur um den Gegensatz von Gesittung und Ausschweifung, sondern auch um den übergreifenden Konrast von Christen- und Heidentum." Es ist ein "Kampf der Mächte des Lichts und der Finsternis um die menschliche Seele, welche sich schließlich dem Guten zuwendet".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken zur religiösen Thematik
- Verkörperungen des Christentums
- Fortunato, der Retter
- Bianka, der Inbegriff der Mutter Gottes
- Verkörperungen des Heidentums
- Donati, der teuflische Vermittler
- Venus, die heidnische Verführerin
- Raumkonzeption
- Paradiesgarten
- Venusgarten
- Florios Prozess des Erwachsenwerdens
- Bewertung des Schlussszene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die religiöse Thematik in Eichendorffs Novelle „Das Marmorbild“ und analysiert die gegensätzlichen Lebensweisen, die Florio vor Augen geführt werden. Die Novelle stellt die Konfrontation mit dem Heidentum und dem Christentum dar und zeigt Florios Weg des Erwachsenwerdens und der Erkenntnis.
- Die Darstellung des Christentums durch die Figuren Fortunato und Bianka
- Die Verkörperung des Heidentums durch die Figuren Donati und Venus
- Die Raumkonzeption als Symbol für die beiden Welten
- Florios Entwicklung und die Entscheidung zwischen den beiden Lebensweisen
- Die Bedeutung der Schlussszene
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die religiöse Thematik der Novelle und stellt den Kontext der Entstehung im Rahmen der Romantik dar. Es wird auf den zentralen Konflikt zwischen Wollust und Heidentum sowie Frömmigkeit und Christentum eingegangen, der Florios Lebensweg prägt.
Das zweite Kapitel analysiert die Figuren Fortunato und Bianka als Vertreter des Christentums. Fortunatos Lied und seine Warnungen an Florio vor der verlockenden Welt des Heidentums werden besonders hervorgehoben.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Figuren Donati und Venus, die das Heidentum verkörpern. Es wird gezeigt, wie Venus Florio in ihren Bann zieht und ihn in die dunkle Seite lockt.
Das vierte Kapitel untersucht die Raumkonzeption der Novelle, die in den beiden Gegensätzen von Paradiesgarten und Venusgarten zum Ausdruck kommt.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit Florios Entwicklung und seinem Prozess des Erwachsenwerdens, der durch seine Konfrontation mit den beiden Welten geprägt wird.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Christentum, Heidentum, Romantik, Eichendorff, „Das Marmorbild“, Florio, Fortunato, Bianka, Donati, Venus, Raumkonzeption, Erwachsenwerden, Erkenntnis.
- Citation du texte
- Stefanie Pokorny (Auteur), 2009, Christentum vs. Heidentum in Eichendorffs "Das Marmorbild", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163849