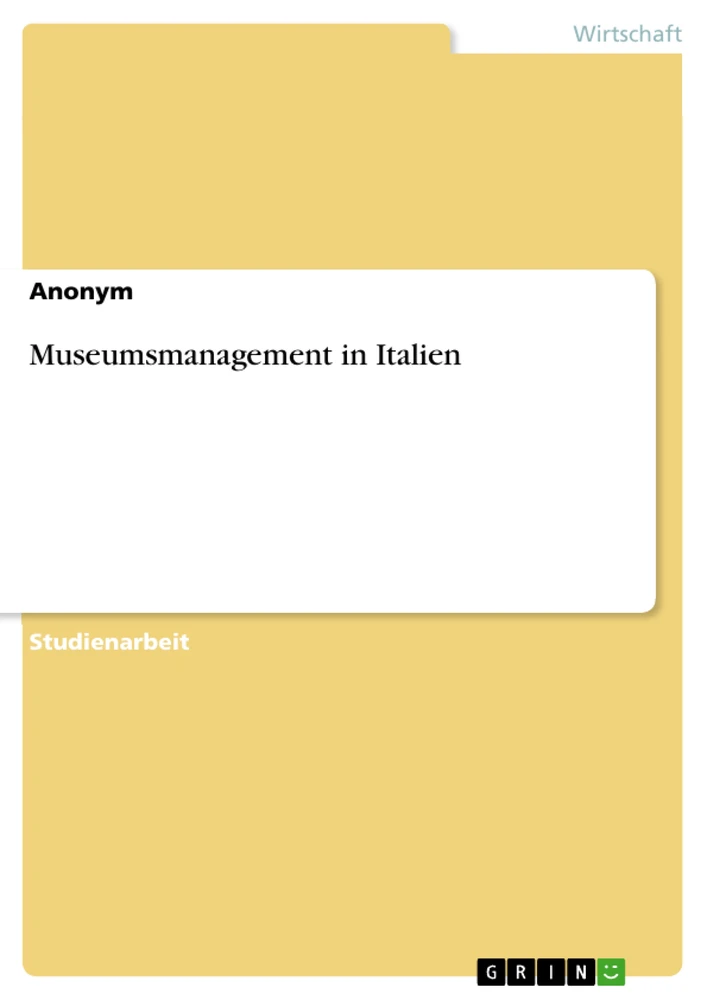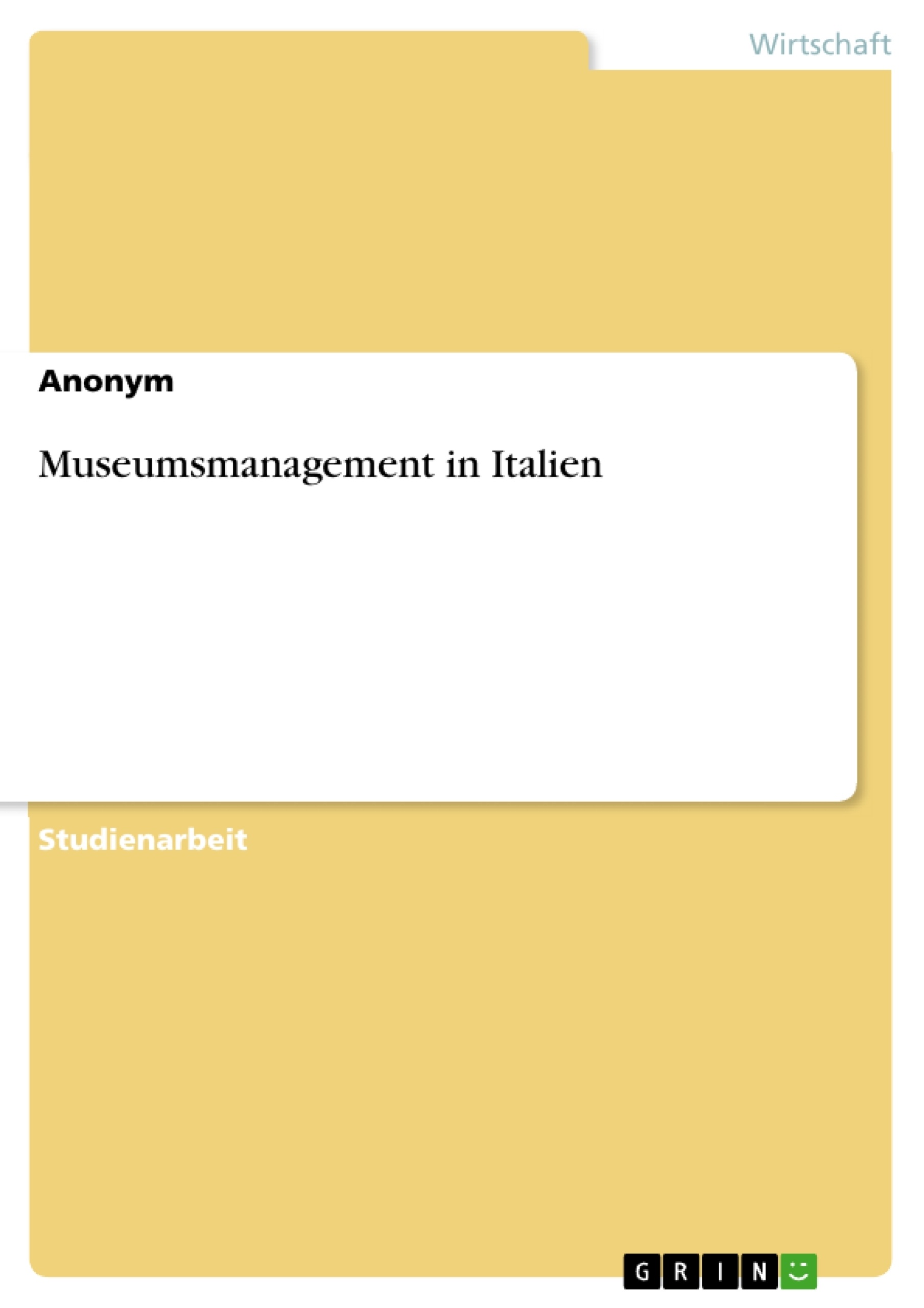Die Kunst ist die wahrscheinlich authentischste Ressource auf italienischem Boden. Wären alle daraus ableitbaren Implikationen ebenso offenkundig und dem praktischen Handeln zugrunde gelegt, könnte man von der Betonung dieser doch recht allgemein bekannten Tatsache absehen. In der Tat hat das Land, dessen Besuch in den vergangenen Jahrhunderten als fester Bestandteil des Bildungskanons galt, seine unumstrittene Monopolstellung eingebüßt. Diese Entwicklung ist durchaus erfreulich, weil sie nicht allein der gestiegenen Mobilität zu verdanken ist, sondern veranschaulicht, wie erfolgreich das Bestreben im restlichen Europa war, kulturelle Zentren aufzuwerten. Als nicht schuldlos erweist sich allerdings auch das Unvermögen, das vorhandene kulturelle Erbe in Italien genügend geschützt, in den Mittelpunkt gestellt und ausgeschöpft sowie neue Attraktionen in ausreichender Menge geschaffen zu haben. Auch wenn die Denkmalpflege einen immensen künstlerischen, technischen und vor allem finanziellen Aufwand in sich birgt, reicht sie nicht mehr aus, um die Bedeutung und das Potenzial des Kulturstandorts im vollen Umfang zu nutzen. Um nach wie vor stilbildend zu wirken, müssen Einrichtungen, wie etwa die Museen, neue Spielräume schaffen, damit über die Präsentation altbewährter Objekte hinaus auch neuere Werke ausgestellt und aufstrebende Künstler gefördert werden können.
Einigung herrscht bei der Forderung nach Erhalt und steigender Wertschöpfung kultureller Hervorbringungen. Differenzen zeigen sich dagegen sofort bei der Frage nach der Umsetzung der Ziele. Nicht selten wird die Unversehrtheit des kulturellen Reichtums missachtet, weil Einzelinteressen überwiegen.
Eine in diesem Zusammenhang vieldiskutierte Methode ist die des strategischen Managements, die als Gelegenheit betrachtet wird, die Abhängigkeit von einer kontinuierlich schrumpfenden staatlichen Unterstützung zu verringern. Mit ihr werden u.a. die Erschließung finanzieller Mittel, Beschäftigung geeigneter Mitarbeiter, der Einsatz neuer Technologien und ein gutes Reaktionsvermögen im Hinblick auf aktuelle Markterfordernisse assoziiert. Ziel der vorliegenden Arbeit ist, nach Nennung grundlegender Informationen und Voraussetzungen zum italienischen Museumswesen, die Darstellung eines effizienten Marketings. Mithilfe der italienischen Literatur zum Kulturmanagement soll schließlich geklärt werden, inwieweit es sich durchgesetzt hat und die mit ihm verbundenen Erwartungen erfüllt werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kulturpolitik
- Denkmalpflege
- Kulturförderung und Kulturfinanzierung
- Kulturmanagement
- Die italienische Museenlandschaft
- Managementpraktiken
- Angebote
- Strategisches Management
- Finanzierung
- Kommunikation und Qualifikation
- Schlussbetrachtung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem italienischen Museumswesen und hat das Ziel, ein effizientes Marketing im Bereich des italienischen Kulturmanagements zu beschreiben. Unter Verwendung der italienischen Fachliteratur wird untersucht, inwieweit sich die Prinzipien des strategischen Managements im Kulturmanagement durchgesetzt haben und die damit verbundenen Erwartungen erfüllen konnten.
- Das italienische Museumswesen im Kontext der Kulturpolitik
- Die Bedeutung von Denkmalpflege und Kulturförderung in Italien
- Die Herausforderungen und Chancen des Kulturmanagements in Italien
- Die Anwendung von strategischem Management im italienischen Museumswesen
- Die Rolle des Marketings im Kontext des Kulturmanagements in Italien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Bedeutung des italienischen Kulturerbes als Ressource heraus und beleuchtet den aktuellen Zustand des Museumswesens in Italien. Sie beleuchtet den Wandel der Monopolstellung des Landes im kulturellen Bereich und die Notwendigkeit, das kulturelle Erbe zu schützen und zu nutzen, um seine Bedeutung zu erhalten.
Kulturpolitik: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung der Denkmalpflege in Italien, beginnend mit dem Gesetz von 1909. Die Bedeutung der Verfassung von 1948, die die Denkmalpflege als eine zentrale Aufgabe des Staates festschreibt, wird hervorgehoben. Die Etablierung des Ministero per i Beni Ambientali e Culturali im Jahr 1974 markiert einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der kulturellen Angelegenheiten in der italienischen Politik.
Kulturförderung und Kulturfinanzierung: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ebenen der Kulturförderung in Italien (Staat, Regionen, Provinzen, Kommunen) betrachtet. Die Finanzierung des kulturellen Bereichs durch den Staat, insbesondere durch den Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), und die Bedeutung der Gesetzgebung von 1993 (legge Ronchey) für die Institutionalisierung von zusätzlichen Dienstleistungen in Museen werden beleuchtet.
Die italienische Museenlandschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit der spezifischen Situation des italienischen Museumswesens und stellt die Besonderheiten des kulturellen Erbes des Landes heraus.
Managementpraktiken: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Managementpraktiken, die im italienischen Museumswesen Anwendung finden, einschließlich Angebote, strategisches Management, Finanzierung und Kommunikation. Die Bedeutung der Qualifikation des Personals und die Herausforderungen der Finanzierung des Museumswesens werden ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Italien, Museumswesen, Kulturmanagement, Denkmalpflege, Kulturförderung, Kulturfinanzierung, strategisches Management, Marketing, italienische Museenlandschaft, Kulturerbe, Kunst, Kunstwerke, Kulturgüter, Denkmalpflege, Museo per i Beni Ambientali e Culturali, Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), legge Ronchey, servizi aggiuntivi.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit über das italienische Museumswesen?
Ziel ist die Darstellung eines effizienten Marketings und die Untersuchung, inwieweit strategisches Management im italienischen Kultursektor erfolgreich umgesetzt wurde.
Welche Rolle spielt die Denkmalpflege in Italien?
Die Denkmalpflege ist seit der Verfassung von 1948 eine zentrale Staatsaufgabe. Sie erfordert jedoch immensen finanziellen und technischen Aufwand, der allein oft nicht mehr ausreicht.
Was besagt die „legge Ronchey“ von 1993?
Dieses Gesetz ermöglichte die Institutionalisierung von zusätzlichen Dienstleistungen (servizi aggiuntivi) in Museen, um die Einnahmen zu steigern und den Service für Besucher zu verbessern.
Wie wird Kultur in Italien staatlich gefördert?
Ein wichtiges Instrument ist der Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), über den der Staat Mittel für verschiedene kulturelle Bereiche verteilt.
Was sind die größten Herausforderungen für italienische Museen?
Dazu gehören schrumpfende staatliche Unterstützung, die Notwendigkeit zur Erschließung neuer Finanzquellen, der Einsatz moderner Technologien und der Fachkräftemangel.
Warum ist strategisches Management für Museen wichtig geworden?
Es hilft Museen, unabhängiger vom Staat zu agieren, auf Markterfordernisse zu reagieren und das Potenzial des italienischen Kulturerbes besser auszuschöpfen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2009, Museumsmanagement in Italien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163903