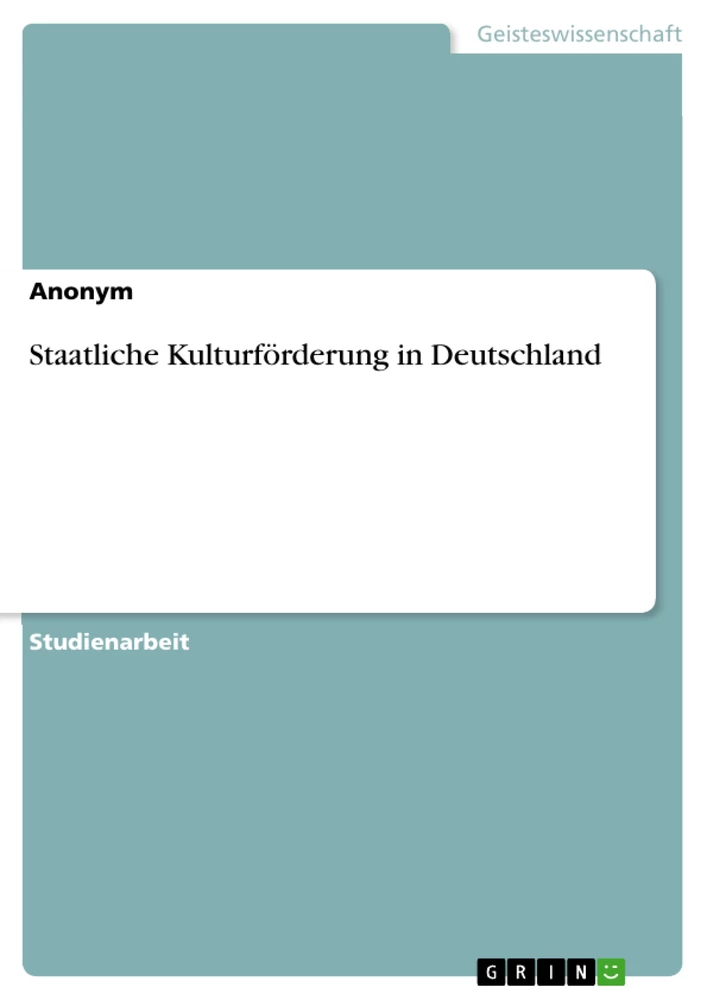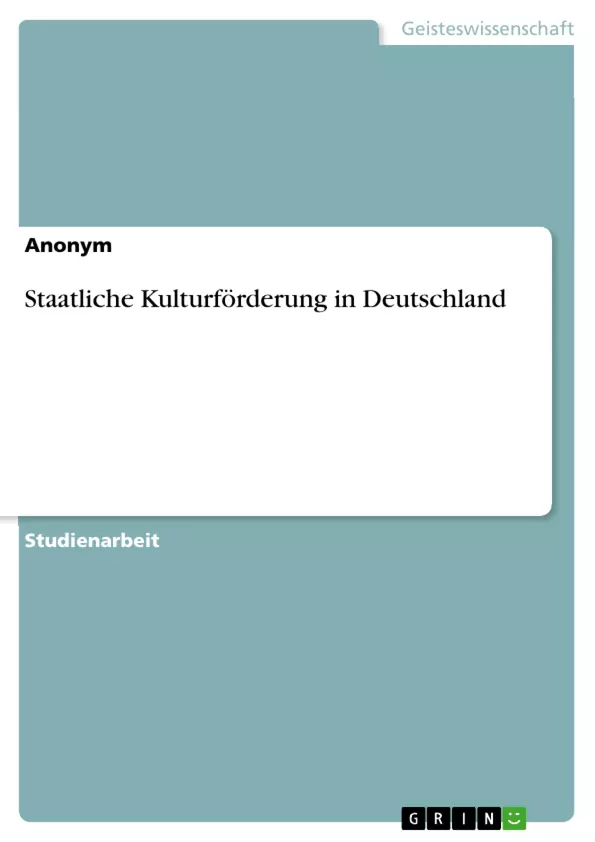Friedrich der Große musste, um die Popularität der Kartoffel zu begründen, erst den Widerstand der Bauern brechen. Dem Fortschritt den Rücken zugekehrt, äußerten sich hingegen manche Entscheidungsträger vorindustrieller Zeiten über die Eisenbahn und ihrer dem gesunden Geist vermeintlich schädlichen Wirkung.
Die grundsätzliche Frage, wie sich die Bevormundung – oder weniger stark ausgedrückt und unseren Zwecken angepasst – die Bevorzugung gewisser Aspekte und Positionen durch den Staat auswirkt, kann auf den Kulturbereich bezogen und in die Gegenwart transferiert werden. Dabei sei nicht die Wertung künstlerischer Inhalte angesprochen, die bei der notwendigen Auswahl der „förderungswürdigen“ Kunst zwangsläufig stattfinden muss, sondern die Frage, welche Art der staatlichen Kulturförderung sinnvoll ist. Diese, die durch eine direkte finanzielle Unterstützung ein bestimmtes Kulturprojekt ermöglicht, oder jene, die in besonderem Maße das Handeln der Personen aktiviert und möglicherweise eine Entwicklung in Gang setzt, sowie die Bürgerinitiative und den Handlungsspielraum bzw. das Wahrnehmen gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen befördert? Die Folgen der zweiten Verfahrensweise lassen sich schwerer abschätzen, aber sind veranlagt, etwas loszutreten, ein Anstoß zu sein.
Das bismarcksche Motto beschreibt das Dilemma, dem sich ein liberaler Staat ausgesetzt sieht, wenn er nicht gänzlich auf Kultur, die dem Geschmack der Massen „widersteht“, verzichten möchte. Dass die Zurückhaltung des Staates bezüglich ihres kulturellen Engagements in Deutschland in den letzten Jahren mehr aus finanziellen Restriktionen und weniger aus kulturpolitischen Erwägungen heraus erfolgt, weiß die Darstellung im folgenden Kapitel zu begründen. Um der Aufgabenstellung der vorliegenden Arbeit weiterhin gerecht zu werden, müssen neben dem Sinn der Förderungsarten auch ihre gesetzliche Verankerung und konkreten Auswirkungen offen gelegt und diskutiert werden.
In diesem Zusammenhang muss die Praxis öffentlicher Kulturförderung in Deutschland beleuchtet werden. Erst am Ende einer Bestandsaufnahme geschichtlicher Entwicklungen und gegenwärtiger kulturpolitischer Rahmenbedingungen sowie Handlungen, kann eine ernsthafte Reflexion einsetzen, die die Chancen und den Sinn beider Wege erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der staatlichen Kulturförderung und Kulturfinanzierung in Deutschland
- Gesetzliche Kompetenzen – Aufgaben und Pflichten
- des Bundes
- der Länder
- der Gemeinden
- Die Praxis – Die ungeschriebene Zuständigkeit „aus der Natur des Sache“
- Indirekte Förderung
- Steuerliche Aspekte: Die Sponsoringerlasse und Gemeinnützigkeit
- Ideelle Förderung, Public Private Partnerships und Rechtsformwechsel
- Desiderata und Perspektiven
- Der amerikanische Weg und seine (Un-)Übertragbarkeit
- Anregungen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der staatlichen Kulturförderung in Deutschland. Sie analysiert die historische Entwicklung der Kulturfinanzierung, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Praxis der öffentlichen Kulturförderung. Dabei werden zwei grundlegende Formen der Förderung verglichen: direkte finanzielle Zuwendungen und die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Kunst und Kultur.
- Die Entwicklung der staatlichen Kulturförderung in Deutschland
- Die rechtlichen Grundlagen der Kulturförderung auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene
- Die Praxis der Kulturförderung und ihre Auswirkungen
- Direkte und indirekte Formen der Kulturförderung
- Die Bedeutung von Rahmenbedingungen für die Kunst und Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Problematik der staatlichen Kulturförderung in den Kontext der historischen Entwicklung und diskutiert die Notwendigkeit einer aktiven Kulturpolitik. Dabei werden die beiden grundlegenden Förderungsarten – direkte finanzielle Unterstützung und die Schaffung von Rahmenbedingungen – eingeführt.
- Entwicklung der staatlichen Kulturförderung und Kulturfinanzierung in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der staatlichen Kulturförderung von der Zeit des Absolutismus bis zur Gegenwart. Es zeigt die Veränderung der Motivations- und Bedingungsfaktoren für künstlerische Hervorbringungen auf und verdeutlicht die zunehmende Bedeutung des Staates als Förderer der Kultur.
- Gesetzliche Kompetenzen – Aufgaben und Pflichten: Das Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der staatlichen Kulturförderung in Deutschland. Es analysiert die Kompetenzen des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie die wichtigsten Rechtsnormen, die die Kulturförderung regeln.
- Die Praxis – Die ungeschriebene Zuständigkeit „aus der Natur des Sache“: Dieses Kapitel widmet sich der Praxis der öffentlichen Kulturförderung in Deutschland und beleuchtet die verschiedenen Formen der Unterstützung, die über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinausgehen.
- Indirekte Förderung: Das Kapitel befasst sich mit der indirekten Förderung von Kultur durch den Staat, insbesondere mit Steuerlichen Aspekten, Sponsoring und Gemeinnützigkeit, sowie Public Private Partnerships und Rechtsformwechseln.
Schlüsselwörter
Staatliche Kulturförderung, Kulturfinanzierung, Kulturpolitik, Kunstfreiheit, Zensurverbot, direkte Förderung, indirekte Förderung, Rahmenbedingungen, Sponsoring, Gemeinnützigkeit, Public Private Partnerships, Rechtsformwechsel, Kulturhoheit, Bundesebene, Landesebene, Gemeindeebene.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist in Deutschland für die Kulturförderung zuständig?
Aufgrund der Kulturhoheit der Länder liegt die Hauptzuständigkeit bei den Bundesländern und Gemeinden. Der Bund hat jedoch ergänzende Kompetenzen für Aufgaben von nationaler Bedeutung.
Was ist der Unterschied zwischen direkter und indirekter Kulturförderung?
Direkte Förderung erfolgt durch Finanzmittel (Zuschüsse) für Projekte oder Institutionen. Indirekte Förderung schafft Rahmenbedingungen, z. B. durch steuerliche Vorteile bei Sponsoring oder Gemeinnützigkeit.
Warum ist das Sponsoring für den Kulturbereich wichtig geworden?
Aufgrund knapper öffentlicher Kassen suchen Kultureinrichtungen vermehrt die Zusammenarbeit mit Unternehmen, um Projekte durch private Mittel zu finanzieren.
Was bedeutet „Kulturhoheit“ der Länder?
Es ist das Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Bundesländer im deutschen Föderalismus, wonach sie primär für Bildung, Kunst und Kultur verantwortlich sind.
Was ist eine Public Private Partnership (PPP) im Kulturbereich?
Es ist eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Akteuren, um kulturelle Infrastrukturen oder Dienstleistungen gemeinsam zu finanzieren und zu betreiben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2007, Staatliche Kulturförderung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163904