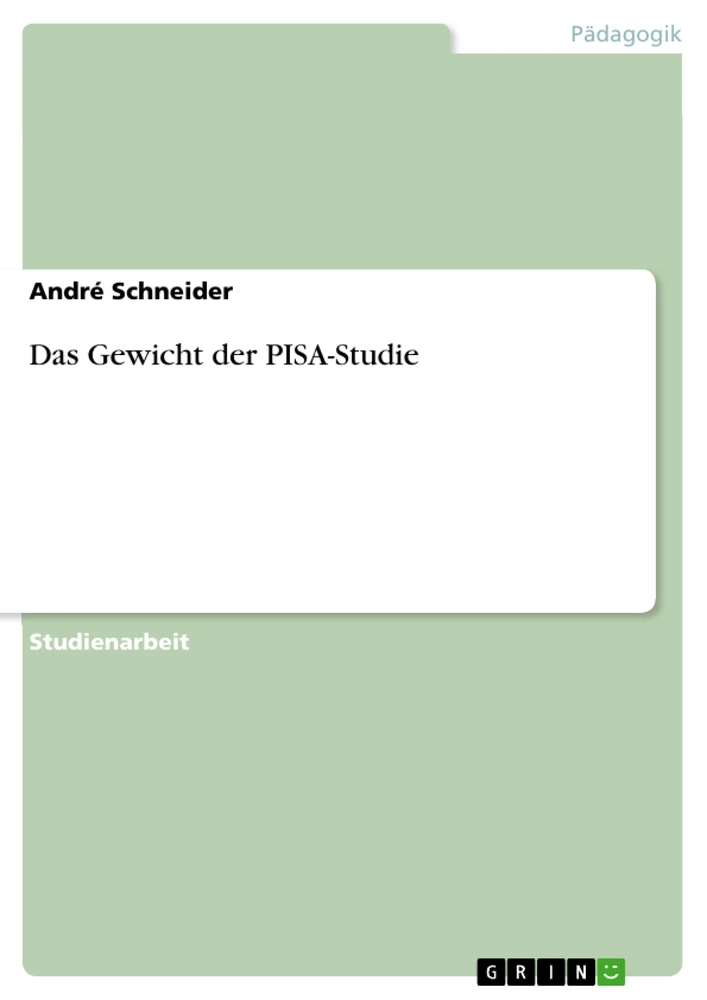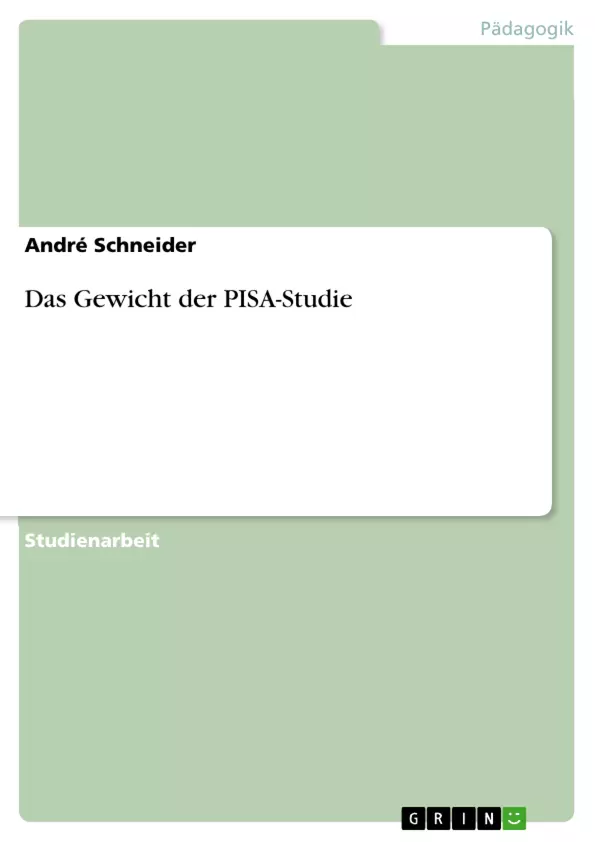Die internationale Vergleichsstudie hat in den teilnehmenden Industrienationen für einen erheblichen Gesprächsbedarf gesorgt; dies vor allem in den Ländern, deren Ergebnisse nicht im Bereich des Erwarteten bzw. Erhofften lagen. Das Interesse an den Resultaten beschränkte sich nicht allein auf die international angelegte PISA-Studie, die im Jahr 2000 begonnen wurde und von diesem Zeitpunkt an im Drei-Jahres-Zyklus insgesamt dreimal durchgeführt werden sollte. Auch die national begleitenden Testverfahren (in Deutschland etwa ‚PISA-E’, in Österreich: ‚PISA Plus’) fanden starke Beachtung, wobei zwischen den Reaktionen der öffentlichen Meinung und denen der Fachwelt zu unterscheiden ist und wiederum in den Ländern mit den schlechteren Ergebnissen die heftigeren Auseinandersetzungen um diese Thematik zu verzeichnen sind.
In der vorliegenden Arbeit soll zunächst einmal auf die Geschichte internationaler Bildungstests geblickt werden, um in Abgrenzung zu früheren Erhebungen einige Besonderheiten der PISA-Studie herauszuheben. Auch die Gemeinsamkeiten sollen unter diesem Aspekt eine Rolle spielen, lässt sich doch eine gewisse ‚Erhebungstradition’ seit den 60-er Jahren ausmachen.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Durchführung und Wirkung der Studie. Zum einen werden ihre technischen Merkmale betrachtet, wobei auch auf die Inhalte und Ziele der Erhebung eingegangen werden soll. Zum anderen geht es um die Reaktionen, die durch die Testergebnisse hervorgerufen wurden. Hierbei soll zwischen den Reaktionen der Öffentlichkeit und denen der Fachwelt unterschieden werden. Es scheint, als ob die ersten Wirkungen in Fachwelt und öffentlicher Wahrnehmung nicht allzu weit auseinander gingen und die Studie selbst oft für ein unhinterfragbares Medium genommen wurde, so dass sich zunächst bezüglich des Stellenwerts der Studie keine kritischen Stimmen geäußert haben. Die in der jüngeren Literatur dann doch auftretende Kritik und die diversen Rechtfertigungsversuche hinsichtlich der Testergebnisse werden auf ihre Berechtigung und Überzeugungskraft hin untersucht.
Weiterhin wird unter literaturdidaktischer Perspektive ein Ausschnitt des Tests exemplarisch analysiert, um ein Bild der differenzierteren Verhandlung des Testverfahrens im Bereich der Lesekompetenz zu ermöglichen.
Das Resümee liefert schließlich eine Einschätzung darüber, welches Gewicht der Studie als Testformat auf nationaler und internationaler Ebene zusammenfassend zuzusprechen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gewicht der PISA-Studie
- Die Vorgeschichte der Studie und die Effekte der Vorgeschichte
- Durchführung und Wirkungen der Studie
- Technische Daten und organisatorische Aspekte der Studie
- Die Reaktionen von Öffentlichkeit und Fachwelt
- Zur Ernsthaftigkeit bei den Getesteten
- Exemplarische Untersuchung: Studieren der Studie im Auszug
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der internationalen Vergleichsstudie PISA und analysiert deren Gewicht und Bedeutung in der deutschen Bildungslandschaft. Sie beleuchtet sowohl die Vorgeschichte der Studie als auch die Durchführung und die Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und die Fachwelt.
- Die historische Einordnung der PISA-Studie im Kontext internationaler Bildungsstudien
- Die Durchführung und die technischen Aspekte der PISA-Studie
- Die Reaktionen auf die PISA-Ergebnisse in der Öffentlichkeit und in der Fachwelt
- Die Untersuchung eines konkreten Beispiels aus der PISA-Studie im Bereich der Lesekompetenz
- Die Bewertung des Gewichts und des Stellenwerts der PISA-Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der PISA-Studie ein und erläutert die Bedeutung internationaler Vergleichsstudien im Kontext des Bildungswesens. Sie hebt die besondere Relevanz der PISA-Studie hervor und betont die unterschiedlichen Reaktionen von Öffentlichkeit und Fachwelt auf die Ergebnisse.
Das Gewicht der PISA-Studie
Die Vorgeschichte der Studie und die Effekte der Vorgeschichte
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Vorgeschichte der PISA-Studie und stellt sie in den Kontext früherer internationaler Bildungsstudien. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt und der Einfluss der Vorgeschichte auf die heutige Bedeutung der PISA-Studie beleuchtet.
Durchführung und Wirkungen der Studie
Das Kapitel behandelt die Durchführung der PISA-Studie und analysiert die technischen Daten und organisatorischen Aspekte. Es beleuchtet die Reaktionen von Öffentlichkeit und Fachwelt auf die Studienergebnisse und untersucht die Kritik an den wesentlichen Merkmalen des Tests.
Exemplarische Untersuchung: Studieren der Studie im Auszug
Dieser Abschnitt widmet sich einer exemplarischen Untersuchung eines Teils der PISA-Studie, die sich mit Lesekompetenz befasst. Unter literaturdidaktischer Perspektive wird ein kleiner Ausschnitt der Aufgabenstellung kritisch beleuchtet, um ein differenziertes Bild des Testverfahrens im Bereich der Lesekompetenz zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Gewicht und der Bedeutung der PISA-Studie. Schlüsselbegriffe sind internationale Vergleichsstudien, Bildungsstandards, Lesekompetenz, Effektivität des Schulsystems, öffentliche Wahrnehmung, Fachkritik und literaturdidaktische Perspektive. Die Arbeit analysiert die Vorgeschichte der Studie, die Durchführung und die Reaktionen auf die Ergebnisse sowie die Relevanz der Studie für die deutsche Bildungslandschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die PISA-Studie?
Eine internationale Schulleistungsstudie der OECD, die seit dem Jahr 2000 alle drei Jahre die Kompetenzen von 15-jährigen Schülern in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften testet.
Was war der „PISA-Schock“ in Deutschland?
Das unerwartet schlechte Abschneiden deutscher Schüler bei der ersten Erhebung im Jahr 2000, was eine heftige Debatte über das nationale Bildungssystem auslöste.
Welche Kritik gibt es an der PISA-Studie?
Kritisiert werden unter anderem die technische Messbarkeit von Kompetenzen, die Vernachlässigung kultureller Unterschiede und der Druck auf Schulen, nur noch für den Test zu lehren („Teaching to the test“).
Wie wird Lesekompetenz bei PISA definiert?
Nicht nur als reines Vorlesen, sondern als die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen.
Gab es vor PISA bereits internationale Bildungstests?
Ja, internationale Vergleiche gibt es bereits seit den 60er Jahren, doch PISA erlangte durch seine mediale Wirkung ein deutlich höheres politisches Gewicht.
- Quote paper
- André Schneider (Author), 2006, Das Gewicht der PISA-Studie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163997