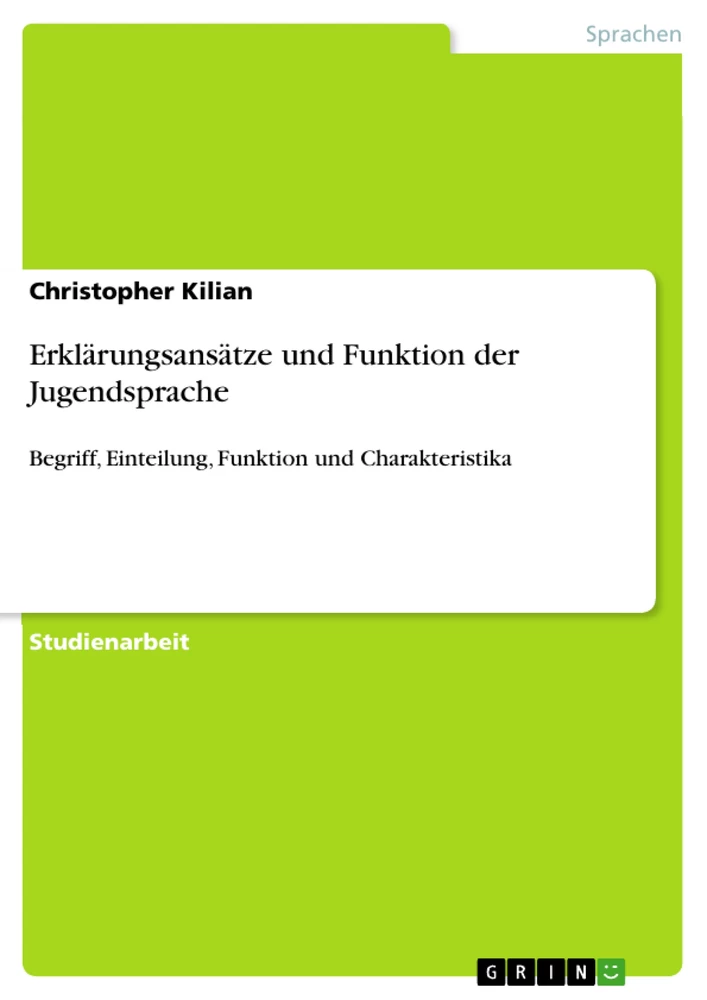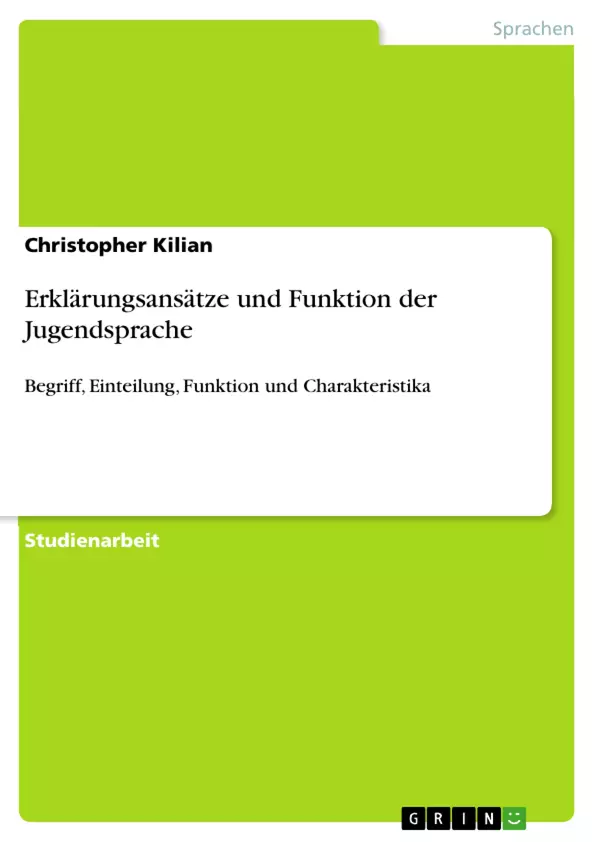Sprechen Jugendliche in einer anderen Sprache? Kann man diese Sprache erlernen? Und spricht jeder Teenager in der gleichen Jugendsprache? Diese und andere Fragen soll die vorliegende Arbeit erklären. Sie soll einen Überblick über die verschiedenen Erklärungsansätze der Jugendsprache verschaffen sowie wichtige Aspekte und charakteristische Züge jener Sprachvarietät beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriff
- 2. Einteilung
- 2.1 nach Susanne Augenstein
- 2.2 nach Helmut Henne
- 2.3 Unterscheidung der Jugendsprache
- 2.4 Einfluss der Bildung
- 3. Funktion
- 4. Charakteristika
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Jugendsprache, deren Entstehung, Charakteristika und Funktion. Sie soll einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Erklärungsansätze und die sprachlichen Besonderheiten der Jugendsprache bieten. Ziel ist es, die jugendliche Sprachentwicklung in ihrer Vielfältigkeit und Dynamik zu beleuchten und gängige Missverständnisse über Jugendsprache als „Sprachverfall“ zu widerlegen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Jugendsprache
- Einteilung und Klassifizierung der Jugendsprache nach unterschiedlichen Kriterien
- Funktion der Jugendsprache als Ausdruck von Identität und Gruppenzugehörigkeit
- Charakteristika der Jugendsprache, wie z.B. Neologismen, Sprachspiele und syntaktische Besonderheiten
- Der Einfluss von Medien und gesellschaftlichen Faktoren auf die Entwicklung der Jugendsprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Begriff
Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition von Jugendsprache. Es wird argumentiert, dass eine einheitliche Definition nicht möglich ist, da Jugendliche verschiedene sprachliche Register je nach Situation anwenden. Das Kapitel geht auf die Problematik des Begriffs „Jugendlicher“ und die Frage ein, ob Jugendsprache als eine Sonderform der Standardsprache betrachtet werden kann.
2. Einteilung
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Ansätze zur Einteilung der Jugendsprache. Susanne Augenstein betrachtet die räumliche Dimension, die soziale Herkunft und die diaphasische Dimension als bestimmende Faktoren für die Sprachvariation. Helmut Henne hingegen fokussiert auf die Funktion, die Struktur, die pragmatische Verwendung und die Sprachkritik als Dimensionen der Jugendsprache. Das Kapitel gibt einen Einblick in die vielfältigen Perspektiven auf die Jugendsprache und zeigt die Komplexität des Themas auf.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Sprachwandel, Sprachvariation, Soziolinguistik, Gruppensprache, Identität, Abgrenzung, Neologismen, Sprachspiele, Jugendkultur, Medien, Gesellschaft, Sprachkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Jugendsprache?
Jugendsprache ist eine Sprachvarietät, die von Jugendlichen genutzt wird, um Identität auszudrücken und sich von der Erwachsenenwelt abzugrenzen.
Ist Jugendsprache ein Zeichen von Sprachverfall?
Nein, die Arbeit beleuchtet Jugendsprache als dynamischen Sprachwandel und Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit, nicht als Defizit.
Welche charakteristischen Züge hat Jugendsprache?
Dazu gehören Neologismen (Wortneuschöpfungen), Sprachspiele, syntaktische Besonderheiten und der Einfluss von Medien.
Welche Funktionen erfüllt die Jugendsprache für Teenager?
Sie dient primär der Identitätsstiftung, der emotionalen Entlastung und der Demonstration von Gruppenzugehörigkeit.
Spricht jeder Jugendliche die gleiche Jugendsprache?
Nein, die Arbeit zeigt, dass die Sprache von Faktoren wie Bildung, sozialer Herkunft und regionalen Einflüssen abhängt.
- Arbeit zitieren
- Christopher Kilian (Autor:in), 2010, Erklärungsansätze und Funktion der Jugendsprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164008