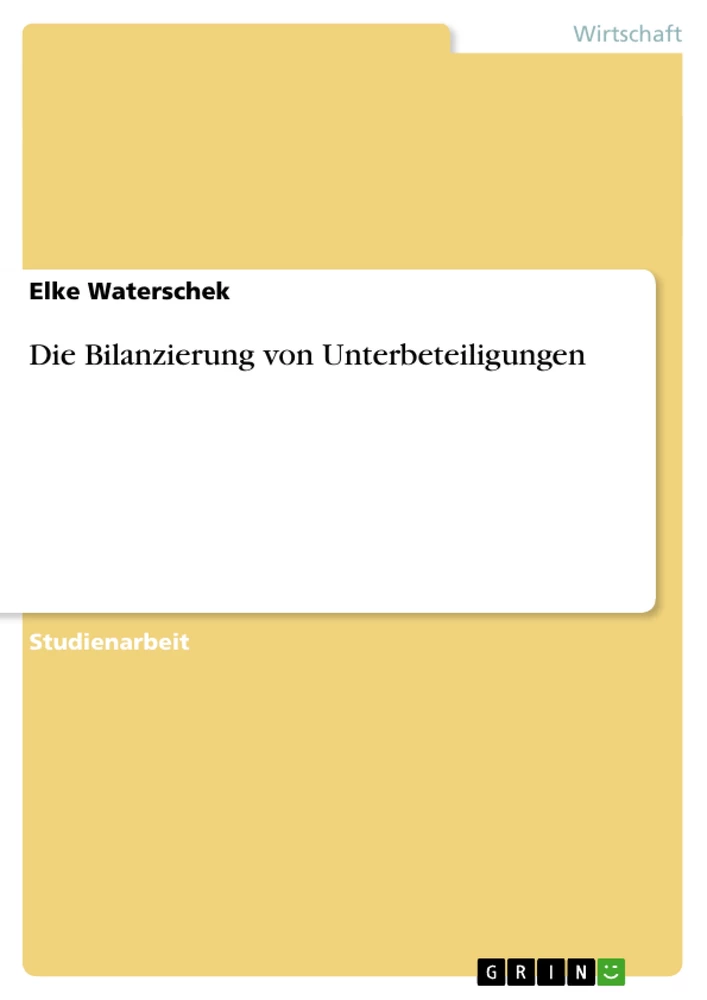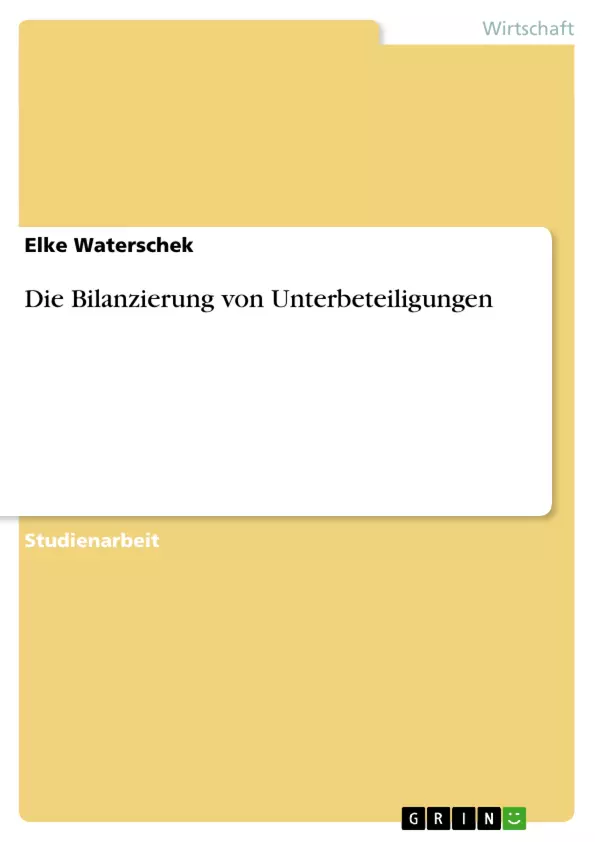Im folgenden soll untersucht werden, inwiefern die Unterbeteiligung bilanziert
wird. Dafür muss zunächst eine zivilrechtliche Charakterisierung der Unterbeteiligung
erfolgen. Da eine handelsrechtliche Bilanzierungspflicht für die Unterbeteiligungsgesellschaft
als solche nicht besteht, muss dementsprechend auf die steuerliche
Bilanzierung Bezug genommen werden. Steuerrechtssubjekte sind die Akteure
und nicht die Gesellschaft an sich. Die Bilanzierung der Unterbeteiligung
muss also differenziert nach Unterbeteiligtem und Hauptbeteiligtem vorgenommen
werden. Die mitunternehmerische Unterbeteiligung muss entsprechend dem Steueränderungsgesetz von 1992 in ihrem Verhältnis zur Hauptgesellschaft diskutiert
werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Die Unterbeteiligungsgesellschaft im Zivilrecht
- Die Abgrenzung der Unterbeteiligung zu anderen Rechtsinstituten
- Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
- Die Bilanzierung der Unterbeteiligung im Einkommensteuerrecht
- Die typische Unterbeteiligung
- Die steuerliche Bilanzierung beim Unterbeteiligten
- Das Zuflussprinzip
- Die steuerliche Bilanzierung beim Hauptbeteiligten
- Exkurs: Die Pflicht zum Kapitalertragsteuerabzug
- Die atypische Unterbeteiligung
- Die Kriterien der Mitunternehmerschaft
- Der Unterbeteiligte als Mitunternehmer der Hauptgesellschaft
- Die steuerliche Bilanzierung bei Mitunternehmerschaft
- Die Gewinnfeststellung der Hauptgesellschaft
- Exkurs: Die doppelte gewerbesteuerliche Erfassung
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Bilanzierung von Unterbeteiligungen. Ziel ist es, die steuerliche Behandlung dieser Beteiligungsform sowohl aus der Sicht des Unterbeteiligten als auch des Hauptbeteiligten zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Unterschiede zwischen typischen und atypischen Unterbeteiligungen, insbesondere die mögliche Mitunternehmerschaft des Unterbeteiligten und die damit verbundenen steuerlichen Folgen.
- Zivilrechtliche Grundlagen der Unterbeteiligungsgesellschaft
- Steuerliche Bilanzierung der Unterbeteiligung
- Unterscheidung zwischen typischer und atypischer Unterbeteiligung
- Mitunternehmerschaft des Unterbeteiligten
- Steuernrechtliche Folgen der Unterbeteiligung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Unterbeteiligungsgesellschaft ein und erläutert die Relevanz dieser Beteiligungsform sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus steuerrechtlicher Perspektive.
Das zweite Kapitel beleuchtet die zivilrechtlichen Grundlagen der Unterbeteiligungsgesellschaft. Es werden die Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten und die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen einer solchen Gesellschaft diskutiert.
Im Hauptteil der Arbeit wird die steuerliche Bilanzierung der Unterbeteiligung umfassend analysiert. Sowohl die Bilanzierung bei Gewinn und Verlust als auch die steuerliche Behandlung der Einräumung und Veräußerung einer Unterbeteiligung werden aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Dabei wird die Unterbeteiligung in typische und atypische Formen untergliedert, und es werden die steuerlichen Folgen der möglichen Mitunternehmerschaft des Unterbeteiligten beleuchtet.
Neben dem Einkommensteuerrecht werden auch die körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Behandlung von Unterbeteiligungen kurz erläutert.
Schlüsselwörter
Unterbeteiligung, Gesellschaftsrecht, Bilanzierung, Einkommensteuerrecht, Körperschaftsteuerrecht, Gewerbesteuerrecht, Mitunternehmerschaft, typische Unterbeteiligung, atypische Unterbeteiligung, Hauptbeteiligter, Unterbeteiligter.
- Citar trabajo
- Elke Waterschek (Autor), 2001, Die Bilanzierung von Unterbeteiligungen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16401