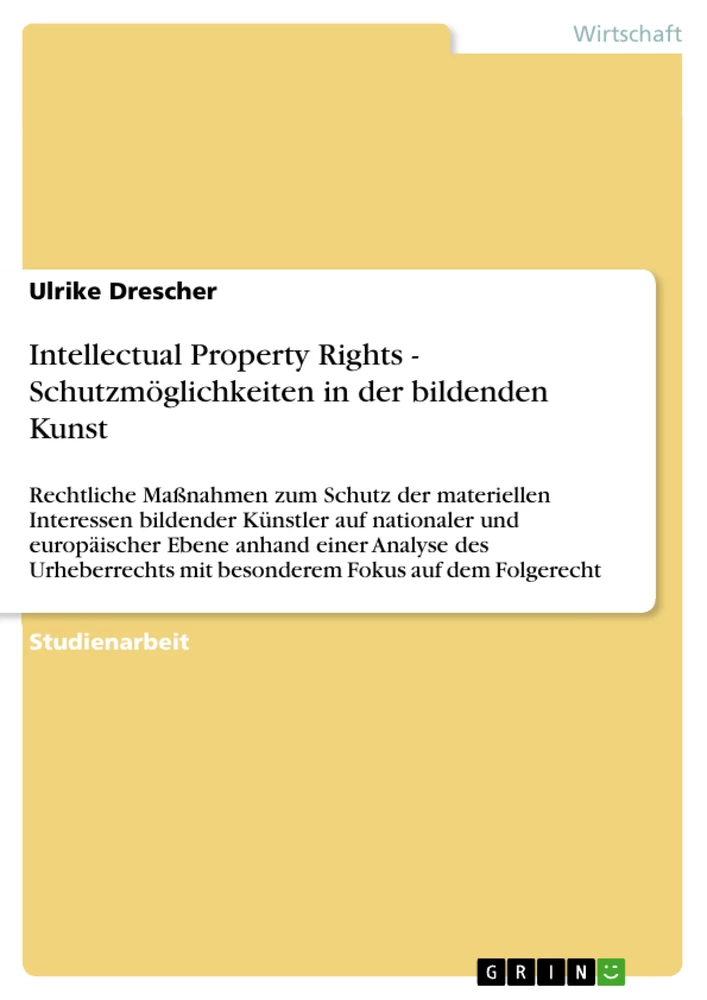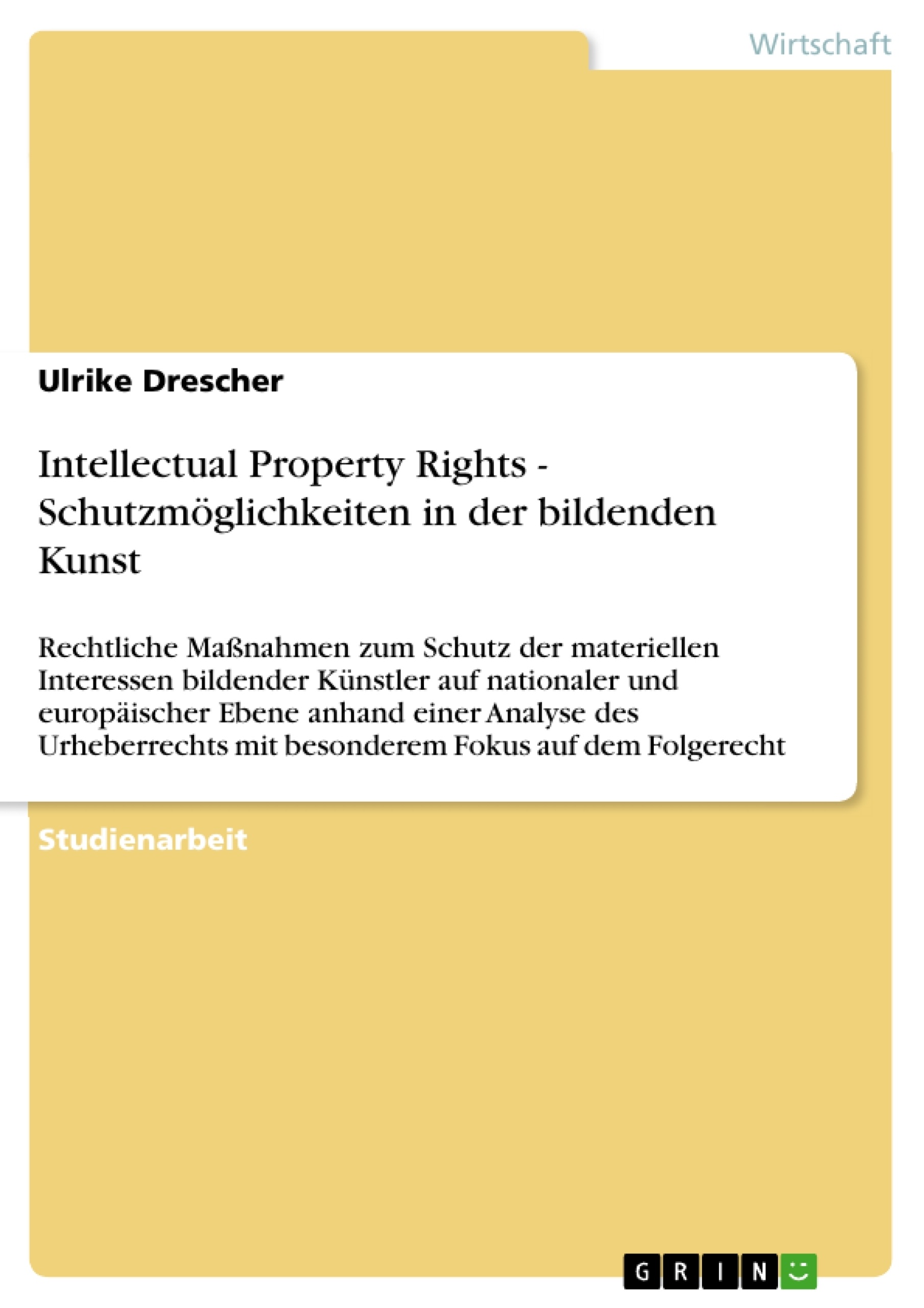In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, inwiefern ein Künstler seinen wirtschaftlichen Interessen im deutschen sowie europäischen Raum nachgehen und diese schützen kann. Dazu werden im Kapitel 2 die Eigenschaften des Gutes Kunst betrachtet, wobei Kunst ausschließlich als privates Gut definiert wird, was somit die Ansprüche der Öffentlichkeit auf Kunst ausschließt (Kunst als öffentliches Gut). Im Kapitel 3 wird die Funktionsweise des Kunstmarktes beschrieben und das Verhältnis vom Künstler zum Galeristen genauer beleuchtet. Eine institutionenökonomische Untersuchung folgt im Kapitel 4.
Das Ziel ist, auftretende Probleme darzulegen und die damit einhergehende Bedeutung von Schutzmöglichkeiten zur Lösung der
Problematik aufzuzeigen. Daher wird die Analyse möglicher Schutzmaßnahmen im Kapitel 5 anhand des Urheberrechts, insbesondere des Folgerechts, welches im Urheberrecht verankert ist, erfolgen. Als Teil des Rechts des „geistigen Eigentums“ (Immaterialgüterrecht) schützt das Urheberrecht nach § 1 Urheberrechtsgesetz(UrhG) Werke der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Zur bildenden Kunst gehören
Werke der Malerei, Bildhauerei und Graphik, obwohl heutzutage eine klare Unterscheidung in Gattungen fast unmöglich ist (vgl. Schoenebeck, 2003, S.28 u. S.36f.). Die Arbeit beschränkt sich auf die Malerei. Im Zuge der Globalisierung wird auch der Kunsthandel internationalisiert, daher ist es wichtig,
das Urheberrecht auch auf internationaler Ebene zu beurteilen und damit verbundene Probleme darzustellen. Die Betrachtung wird sich hierbei auf Europa konzentrieren(Kapitel 5). Das 6. Kapitel soll abschließend eine kurze Zusammenfassung sowie weitere relevante Faktoren aufzeigen. Neben den rechtlichen könnten auch
technische Schutzmöglichkeiten für bildende Künstler als Grundlage der Analyse herangezogen werden, welche jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kunstwerke als wirtschaftliche Güter
- Nutzen von Kunstwerken
- Knappheit
- Kunst als privates Gut
- Dauerhaftigkeit
- Der Markt für bildende Kunst
- Einteilung des Marktes und seine Akteure
- Die bedeutende Rolle des Galeristen auf dem Kunstmarkt
- Institutionenökonomische Betrachtung des Kunstmarktes
- Beschreibung der Neuen Institutionenökonomik
- Anwendung auf den Kunstmarkt
- Intellectual Property Rights - Urheberrecht
- Grundlagen des Deutschen Urheberrechts
- Schutz wirtschaftlicher Interessen
- Anspruch des Urheberrechts und Folgerechts auf internationaler Ebene
- Bewertung der EU-Richtlinie zum Folgerecht
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen von Künstlern im Bereich der bildenden Kunst, insbesondere im deutschen und europäischen Kontext. Die Analyse konzentriert sich auf die Eigenschaften von Kunstwerken als wirtschaftliche Güter, die Funktionsweise des Kunstmarktes und die Bedeutung von "Intellectual Property Rights", insbesondere des Urheberrechts und des Folgerechts.
- Definition von Kunstwerken als wirtschaftliche Güter
- Analyse des Kunstmarktes und seiner Akteure
- Bedeutung von Institutionenökonomik für den Kunstmarkt
- Schutz von Urheberrechten im deutschen und europäischen Raum
- Bewertung des Folgerechts im Kontext des Urheberrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema "Intellectual Property Rights" im Bereich der bildenden Kunst ein und erläutert die Relevanz des Schutzes wirtschaftlicher Interessen von Künstlern. Das zweite Kapitel beleuchtet die Eigenschaften von Kunstwerken als wirtschaftliche Güter, wie z.B. Knappheit und Nutzen, wobei der Fokus auf der Definition von Kunst als privates Gut liegt. Im dritten Kapitel wird der Kunstmarkt und seine Akteure analysiert, mit besonderem Augenmerk auf die Rolle des Galeristen. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der institutionenökonomischen Betrachtung des Kunstmarktes, um die Bedeutung von Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen. Im fünften Kapitel wird das Urheberrecht, insbesondere das Folgerecht, als Schutzmaßnahme für Künstler analysiert und bewertet.
Schlüsselwörter
Bildende Kunst, Urheberrecht, Folgerecht, Kunstmarkt, Galerist, wirtschaftliche Interessen, Intellectual Property Rights, institutionenökonomische Betrachtung, Schutzmöglichkeiten, geistiges Eigentum, Malerei.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Künstler ihre wirtschaftlichen Interessen schützen?
Künstler nutzen primär das Urheberrecht und das darin verankerte Folgerecht, um ihre geistigen Eigentumsrechte und finanziellen Ansprüche abzusichern.
Was ist das Folgerecht (Droit de Suite)?
Das Folgerecht sichert dem Urheber eines Werkes der bildenden Kunst eine prozentuale Beteiligung am Verkaufserlös zu, wenn das Werk auf dem Kunstmarkt weiterverkauft wird.
Wird Kunst in dieser Arbeit als privates oder öffentliches Gut definiert?
Die Arbeit definiert Kunst ausschließlich als privates Gut, um die wirtschaftlichen Schutzansprüche des Künstlers gegenüber der Öffentlichkeit zu begründen.
Welche Rolle spielt der Galerist auf dem Kunstmarkt?
Der Galerist fungiert als zentraler Mittler zwischen Künstler und Markt und übernimmt wichtige Aufgaben bei der Vermarktung und Preisbildung.
Gilt das Urheberrecht auch auf internationaler Ebene?
Ja, die Arbeit untersucht insbesondere die europäische Ebene und die EU-Richtlinie zum Folgerecht im Kontext der Globalisierung des Kunsthandels.
Welche Kunstgattung steht im Fokus dieser Analyse?
Obwohl eine Abgrenzung heute schwierig ist, beschränkt sich die vorliegende Analyse primär auf den Bereich der Malerei.
- Citar trabajo
- Ulrike Drescher (Autor), 2009, Intellectual Property Rights - Schutzmöglichkeiten in der bildenden Kunst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164082