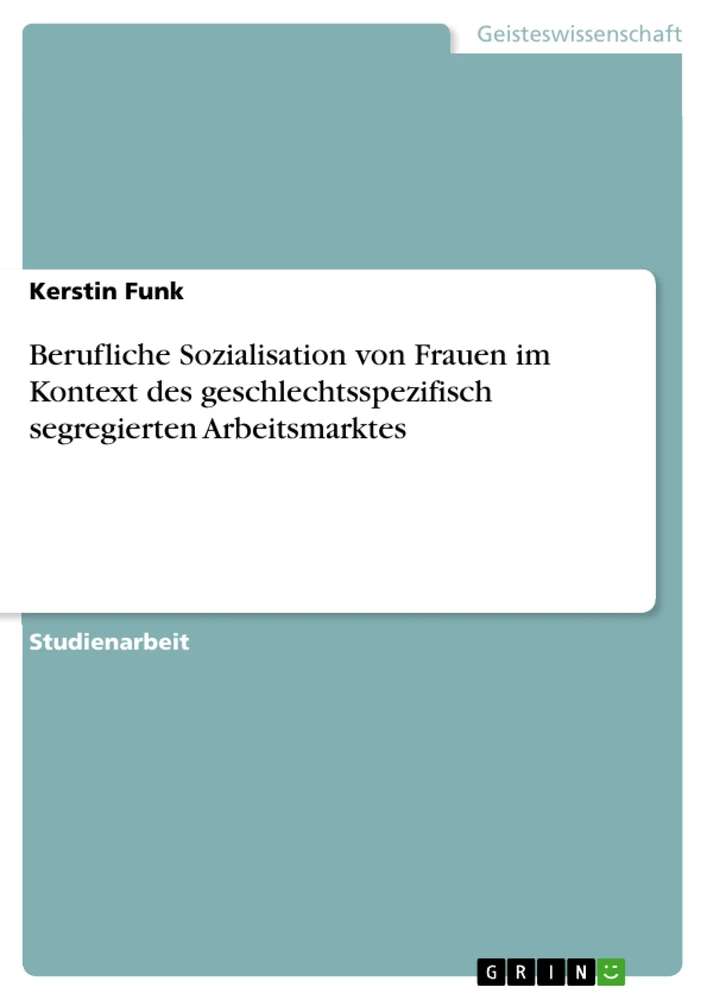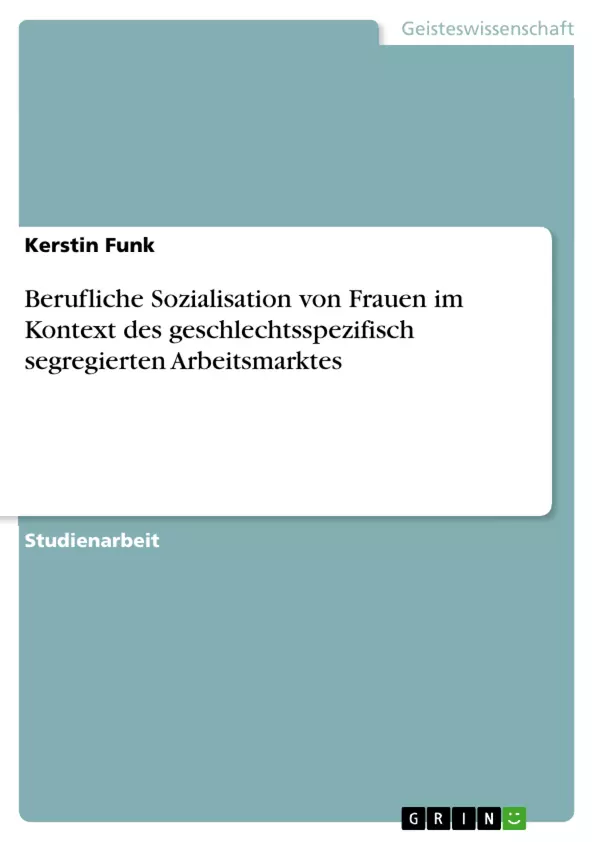[...] Mädchen haben Jungen gegenüber mittlerweile einen Bildungsvorsprung erzielen können. Das verstärkte Bildungsinteresse der Frauen sowie ihre verbesserten Qualifikationen haben zwar zur Emanzipation der Frauen insgesamt beigetragen, es besteht jedoch noch immer ein Ungleichgewicht. Ihre beruflichen Chancen unterscheiden sich in ihrer Reichweite für Lebenskonzept und Selbstdefinition von denen der Männer (Heinz 1995). Beim Zugang zu einigen Berufsgruppen sowie bei der Karriereplanung sind geschlechtsspezifische Unterschiede auf dem Arbeits-und Ausbildungsmarkt vorhanden. Bereits auf dem Ausbildungsmarkt findet sich das Muster typischer Männer-und Frauenberufe trotz gleicher Ausbildungsvoraussetzungen.
Hochdotierte Positionen und Leitungsaufgaben werden zumeist von Männern besetzt, Frauen über eher soziale und in der Hierarchie unten angesiedelte Berufe aus und sind daher eher von Arbeitsplatzverlust betroffen. Zudem sind sie häufiger im dienstleistenden Gewerbe tätig, wohingegen Männer bevorzugt technische Berufe ergreifen.
Die angestrebte Unabhängigkeit und Eigenständigkeit von Frauen kann nur begrenzt umgesetzt werden: Frauen werden häufig in Berufen ausgebildet, die ihnen eine eigenständige ökonomische Existenz verwehren (Nissen et al 2003).
Trotz Erosion des Ernährermodells setzt sich die Familie nicht aus ökonomisch unabhängigen, autonomen Individuen zusammen, da Frauen neben der Erwerbstätigkeit den Hauptteil der unentgeltlichen familiären Betreuungsarbeit leisten (Lewis 2003).
Der demographische Wandel erfordert aufgrund des Bevölkerungs-und Erwerbspotentialrückganges in den kommenden Jahrzehnten vermehrt gut qualifizierte Fachkräfte und eine noch stärker werdende Erwerbsbeteiligung der Frauen und lässt den Berufsfindungsprozessen junger Frauen einen erheblichen Stellenwert zukommen (Süssmuth 2007).
Die in jungen Jahren getroffene Berufswahl hat weitreichende Konsequenzen für die weibliche Biographie. Es soll im folgenden Berufsfindung als ein multifaktorieller Prozess analysiert werden. Die Komplexität des Prozesses wird anhand struktureller und gesellschaftlicher Ansätze vertieft erörtert. Anschließend werden Ansätze diskutiert, die eine Veränderung bestehender Strukturen bewirken können. Da für die sich anschließenden Ausführungen ein einheitliches Begriffsverständnis vonnöten ist, erfolgt zunächst eine kurze Definition wesentlicher Arbeitsbegriffe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff Sozialisation
- Begriff Sozialisation
- Begriff Berufliche Sozialisation
- Beschäftigungsstrukturen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
- Schulische Qualifikation
- Der Ausbildungsmarkt
- Frauenerwerbstätigkeit
- Strukturelle Erklärungsansätze
- Arbeitsmarktsegmentation und-segregation
- Statistische Diskriminierung
- Sozialisationsbedingte Ansätze
- Das weibliche Arbeitsvermögen
- Das Konzept der doppelten Vergesellschaftung
- Das gendering-Konzept
- Ansatzpunkte für Veränderung in verschiedenen Kontexten
- Schule
- Berufsberatung
- Berufsbezeichnungen
- Elternhaus
- Übergreifende politische Konzepte
- Gender mainstreaming
- Das diversity-management
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der beruflichen Sozialisation von Frauen im Kontext des geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarktes. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen, denen Frauen im Berufsfindungsprozess begegnen, und analysiert die Ursachen für die bestehende Ungleichheit.
- Berufliche Sozialisation von Frauen
- Geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeitsmarkt
- Strukturelle und sozialisationsbedingte Einflussfaktoren
- Ansatzpunkte zur Veränderung bestehender Strukturen
- Gender mainstreaming und diversity-management
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Erwerbstätigkeit von Frauen und die weiterhin bestehende Ungleichheit im Hinblick auf Berufschancen und Karrierewege. Die Arbeit fokussiert auf den Berufsfindungsprozess von jungen Frauen und stellt die Komplexität des Prozesses heraus.
- Begriff Sozialisation: Die Kapitel erläutern die Bedeutung des Begriffs "Sozialisation" im Allgemeinen und vertiefen anschließend den Begriff der "beruflichen Sozialisation".
- Beschäftigungsstrukturen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt: Dieses Kapitel analysiert bestehende Strukturen in der schulischen Qualifikation und dem Ausbildungsmarkt. Dabei werden die Herausforderungen für Frauen in Bezug auf die Wahl von Ausbildungsberufen und die Ungleichheit im Zugang zu bestimmten Berufsfeldern beleuchtet.
- Strukturelle Erklärungsansätze: Hier werden strukturelle Erklärungsansätze für die geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeitsmarkt diskutiert, wie z.B. Arbeitsmarktsegmentation und statistische Diskriminierung.
- Sozialisationsbedingte Ansätze: Das Kapitel untersucht sozialisationsbedingte Ansätze, die die Berufswahl von Frauen beeinflussen. Dazu gehören Konzepte wie das weibliche Arbeitsvermögen, die doppelte Vergesellschaftung und das "gendering-Konzept".
- Ansatzpunkte für Veränderung in verschiedenen Kontexten: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansatzpunkte für Veränderung in unterschiedlichen Kontexten wie Schule, Berufsberatung, Berufsbezeichnungen und dem Elternhaus. Darüber hinaus werden übergreifende politische Konzepte wie Gender mainstreaming und diversity-management vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe der beruflichen Sozialisation, der geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt, den Einfluss von Bildung und Ausbildung auf die Berufswahl, strukturelle Erklärungsansätze, gendering-Konzept, diversity-management und Gender mainstreaming.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Frauen trotz besserer Bildung auf dem Arbeitsmarkt oft benachteiligt?
Ursachen sind unter anderem die geschlechtsspezifische Segregation, statistische Diskriminierung und traditionelle Rollenbilder in der Berufswahl.
Was versteht man unter geschlechtsspezifischer Segregation?
Die Konzentration von Frauen und Männern auf unterschiedliche Berufsfelder (horizontal) und Hierarchieebenen (vertikal).
Was besagt das Konzept der doppelten Vergesellschaftung?
Es beschreibt die Herausforderung für Frauen, sowohl in der Erwerbswelt als auch in der unbezahlten Familienarbeit verankert zu sein.
Welche Rolle spielt die Schule bei der Berufswahl von Mädchen?
Schulen können durch Berufsberatung und das Aufbrechen von Stereotypen dazu beitragen, das Berufswahlspektrum von Mädchen zu erweitern.
Was ist Gender Mainstreaming?
Ein politisches Konzept, das die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern bei allen gesellschaftlichen Vorhaben systematisch berücksichtigt.
- Quote paper
- Kerstin Funk (Author), 2010, Berufliche Sozialisation von Frauen im Kontext des geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarktes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164103