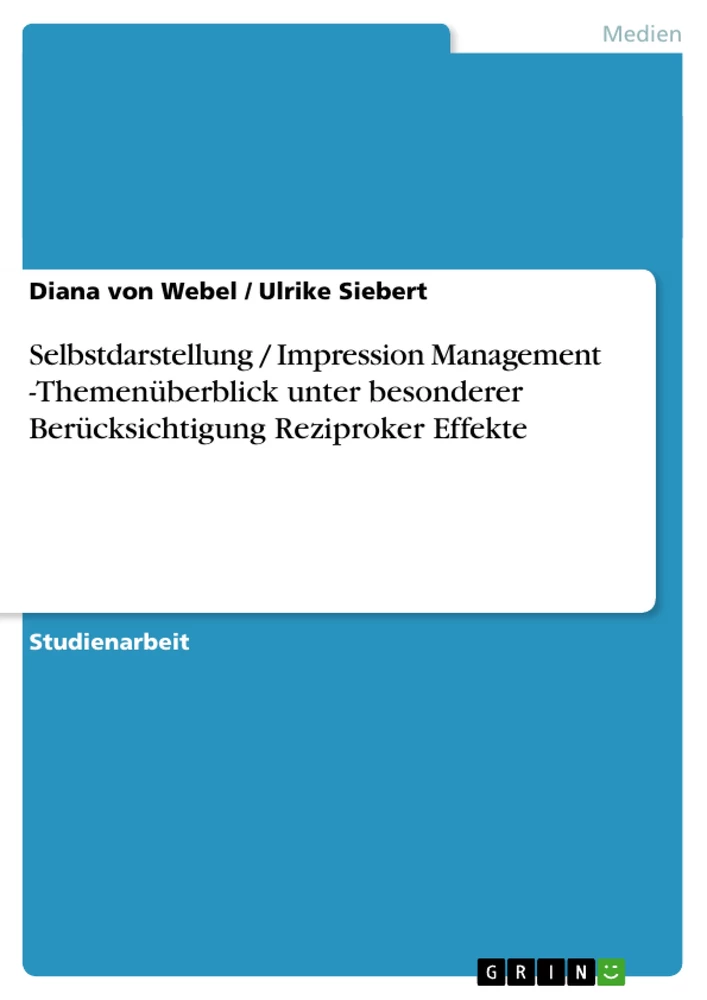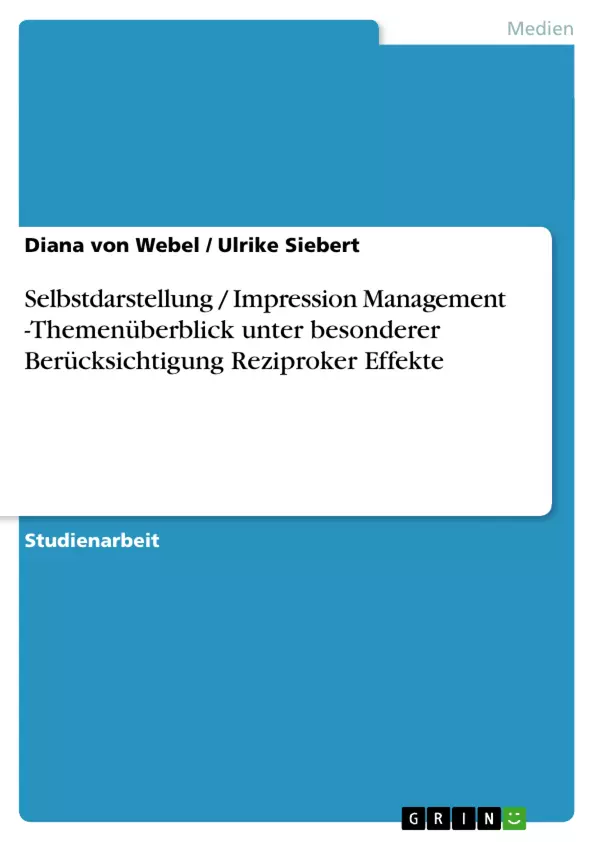Am 7. Juni 2000 erschien in der Allgemeinen Zeitung Mainz in der Kolumne
„Guten Morgen, Mainz“ folgender Artikel:
„Durch die Blume
Die Zeiten, da dem Anrufer ein harsches "Bittäää?" am Telefon
entgegenschallte, sind vorbei. Stattdessen eine Flötstimme:
"Meinnameistmurmelmurmelwaskannichfürsietun?" Überhaupt: Info-Schalter,
Kundenbetreuer, Service-Telefone: Mit blumigen Worten wird überall
Dienstbeflissenheit gepriesen. Doch die Servicewüste lebt. So etwa, dem
sprießenden Grün zum Trotz, in einem Blumenladen im Münchfeld. Dort
wollte ein Leser eine Viertelstunde vor Ladenschluss einen Strauß erstehen als
kleines Trostpflaster für seine Partnerin, die an dem Tag beim Arzt gewesen
war. Doch statt rasch ein paar Blumen sprechen zu lassen, reagierte der
Verkäufer recht unwirsch: Er mache jetzt Feierabend, ließ er unverblümt
wissen und war auch durch sanftes Zureden nicht zu erweichen. In einer
Gonsenheimer Gärtnerei, in der das Geschäft bis zum Feierabend blüht, wurde
der Unbestraußte schließlich doch noch fündig. Eine blütenreine Leistung,
meint MOGUNTINUS“
Leider hat der Autor nicht gewusst, dass es im Mainzer Münchfeld nur einen
einzigen Blumenladen gibt. Der unfreundliche Verkäufer und sein Geschäft waren
also eindeutig identifizierbar gewesen. Welche Wirkung hatte der Artikel auf den
Floristen? Offenbar eine gewaltige, denn er schaltete einen Anwalt ein. Eine Woche
später (AZ vom 14. Juni 2000) sahen sich die verantwortlichen Redakteure
gezwungen, unten stehende Gegendarstellung zu der Glosse an der gleichen Stelle im
Lokalteil abzudrucken.
„Gegendarstellung
red. Zur Glosse ‚Moguntinus’ vom 7. Juni erreichte uns folgende
Gegendarstellung: ‚Im Mainzer Anzeiger / Allgemeine Zeitung vom 7. 6. 2000
ist auf Seite 9 ein Beitrag unter der Überschrift ‚Durch die Blume’ enthalten,
der unrichtige Behauptungen enthält, die ich wie folgt richtig stelle: a) Es wird
behauptet, dass in einem Blumenladen im Münchfeld die Servicewüste lebe.
Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, dass in einem Blumenladen im
Münchfeld Service geboten wird. b) Es wird behauptet, in einem Blumenladen
im Münchfeld habe der Verkäufer unwirsch reagiert und erklärt, jetzt
Feierabend zu machen. Diese Behauptung ist unwahr. Richtig ist, dass der
Verkäufer weder unwirsch war, noch erklärt habe, jetzt Feierabend zu
machen.’ Wiesbaden, den 9. 6. 2000 Hendrik Hejral, Art Floristic“
Versuchen wir nachzuvollziehen, was dem Verkäufer nach Lektüre der Glosse
durch den Kopf ging: [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Selbst und die Darstellung
- Begriffe: Selbst und Selbstkonzept
- Begriffe: Selbstdarstellung und Impression Management
- Das Selbst und die Anderen
- Symbolischer Interaktionismus
- Interaktionsmodelle mit und ohne Medienberichterstattung
- Impression Management-Theorie
- Theoretische und experimentelle Wurzeln
- Soziale Normen für die Selbstdarstellung
- Selbstdarstellung – Warum?
- Taxonomie des Selbstdarstellungs-Verhaltens
- Sich beliebt machen, Einschmeicheln (Ingratiation)
- Eigenwerbung betreiben (Self-Promotion)
- Sich als Vorbild darstellen (Exemplification), Andere einschüchtern, bedrohen (Intimidation) und Hilfsbedürftig erscheinen (Supplication)
- Entschuldigen (excuses), Rechtfertigen (justifications), Prophylaktisch auf Schwierigkeiten hinweisen (disclaimers) und Self-handicapping
- Ressourcen für erfolgreiches Impression Management: Bestimmte Eigenschaften betonen
- Indirektes Impression Management
- Reziproke Effekte
- Reziproke Effekte im Modell
- Medienberichterstattung als Predicament: Coping-Strategien
- Vorhersagbarkeit von Selbstdarstellungs-Verhalten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Thema Selbstdarstellung und Impression Management auseinander, insbesondere mit den reziproken Effekten, die durch Medienberichterstattung entstehen. Sie untersucht, wie Menschen ihr Image in der Öffentlichkeit beeinflussen und wie diese Strategien von der Berichterstattung selbst beeinflusst werden.
- Das Selbst und die Konstruktion von Identität
- Die Rolle des Impression Managements in der Interaktion
- Die Auswirkungen der Medienberichterstattung auf das Selbstdarstellungs-Verhalten
- Reziproke Effekte als Herausforderung für die Selbstdarstellung
- Die Analyse von Impression Management-Techniken und Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext des Themas anhand eines realen Beispiels aus der Medienwelt beleuchtet. Anschließend werden die grundlegenden Begriffe Selbst und Selbstkonzept sowie Selbstdarstellung und Impression Management definiert und im Kontext des symbolischen Interaktionismus erläutert. Die Analyse der Impression Management-Theorie umfasst die historischen und theoretischen Wurzeln, die sozialen Normen für die Selbstdarstellung, die Motive für Selbstdarstellungs-Verhalten und eine Taxonomie verschiedener Impression Management-Techniken. Im Kapitel über reziproke Effekte werden die Auswirkungen von Medienberichterstattung auf das Selbstdarstellungs-Verhalten betrachtet und verschiedene Coping-Strategien vorgestellt. Die Arbeit schließt mit einer Betrachtung der Vorhersagbarkeit von Selbstdarstellungs-Verhalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Selbstdarstellung, Impression Management, Reziproke Effekte, Medienberichterstattung, sozialer Interaktion, symbolischer Interaktionismus, Identität, Coping-Strategien, Vorhersagbarkeit von Verhalten.
- Citation du texte
- Diana von Webel (Auteur), Ulrike Siebert (Auteur), 2001, Selbstdarstellung / Impression Management -Themenüberblick unter besonderer Berücksichtigung Reziproker Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16411