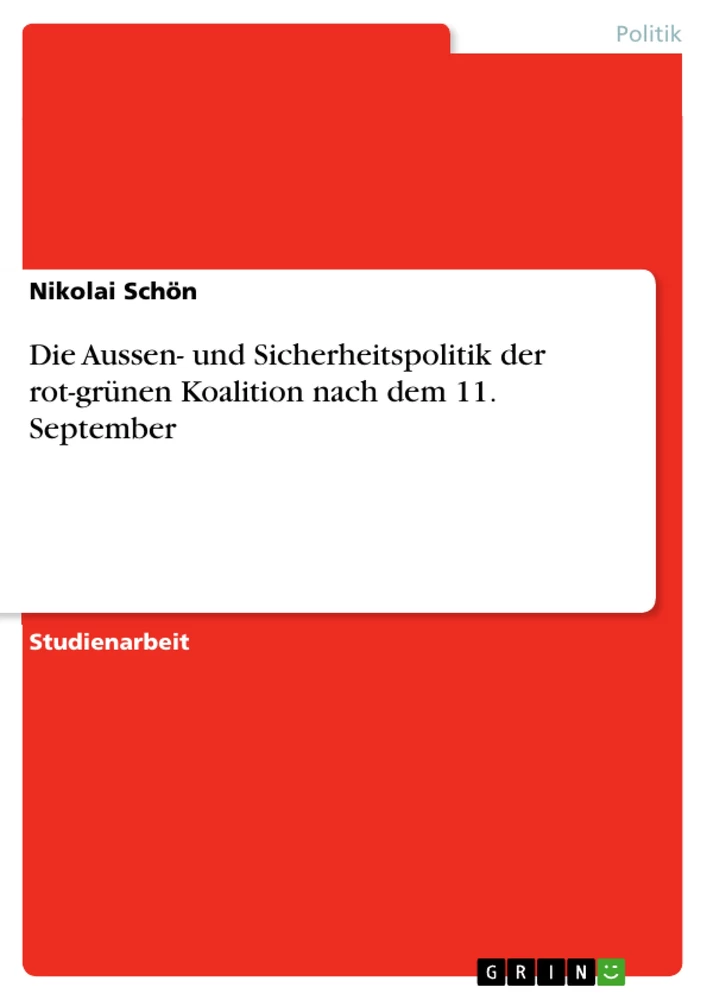Ziel dieser Hausarbeit ist es, die wichtigsten Elemente der Außen- und Sicher-heitspolitik der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 11. September und dem Beginn des Irak-Krieges darzustellen. Zu diesem Zweck erfolgte die Aus¬arbeitung weitestgehend chronologisch. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, gehe ich dabei in besonderem Maße auf die militärischen Ma߬nahmen der rot-grünen Bundesregierung in Afghanistan sowie auf das deutsch-amerikanische Zerwürfnis in Folge der Vorbereitungen zum Irak-Krieg ein. Zur Veranschaulichung der damaligen weltpolitischen Situation benutze ich neben Material aus wissenschaftlicher Literatur, auch Auszüge aus Regierungserklärungen, Beschlüssen und Resolutionen internationaler Institutionen, sowie aus Reden verschiedener Politiker.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutsche Reaktion auf den 11. September
- „Uneingeschränkte Solidarität“ im Kampf gegen den Terror
- Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan
- Die Beteiligung am Wiederaufbau
- Neue Verantwortung der Bundesrepublik in der Weltordnung
- Ein Umbruch in den deutsch-amerikanischen Beziehungen
- State of the Union Message vom 29.01.2002
- Die deutsche Antwort: zwischen Wahlkampf und Ablehnung
- Spaltung in „altes“ und „neues“ Europa
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland zwischen dem 11. September 2001 und dem Beginn des Irak-Krieges. Der Fokus liegt auf der chronologischen Darstellung der wichtigsten Elemente der deutschen Politik in dieser Zeit, insbesondere der militärischen Maßnahmen in Afghanistan und dem deutsch-amerikanischen Verhältnis.
- Die Reaktion Deutschlands auf die Anschläge vom 11. September und die daraus resultierende deutsche Solidaritätsbekundung gegenüber den Vereinigten Staaten.
- Die Rolle der Bundesrepublik im internationalen Kampf gegen den Terrorismus, einschließlich der Entscheidung für einen militärischen Einsatz in Afghanistan.
- Die Auswirkungen der 9/11-Terroranschläge auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die Entwicklungen, die zu einem Zerwürfnis in der Folge des Irak-Krieges führten.
- Die deutsche Positionierung in der internationalen Ordnung nach den Anschlägen und die Frage nach einer neuen Verantwortung der Bundesrepublik in der Weltpolitik.
- Die Debatte über die Rolle Deutschlands als Zivilmacht und die Herausforderungen der internationalen Zusammenarbeit im Kontext der neuen Bedrohungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit und erläutert die chronologische Herangehensweise an die Analyse der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Das zweite Kapitel befasst sich mit der unmittelbaren Reaktion Deutschlands auf die Terroranschläge vom 11. September. Es werden die Solidaritätsbekundungen, die Entscheidungen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und des NATO-Rates sowie die deutsche Bereitschaft zur militärischen Unterstützung der USA im Kampf gegen den Terrorismus beleuchtet.
Im Fokus des Kapitels 2.1 steht die Entscheidung für einen militärischen Einsatz in Afghanistan. Es werden die Gründe für diese Entscheidung, die Abstimmung im Bundestag und die konkreten Aufgaben der Bundeswehr in der Operation Enduring Freedom dargelegt. Das Kapitel 2.1.1 behandelt die deutschen Truppen im Einsatz in Afghanistan und deren Rolle in der Bekämpfung von Terrorismus. Das Kapitel 2.1.2 beschäftigt sich mit der deutschen Beteiligung am Wiederaufbau Afghanistans. Das Kapitel 2.2 widmet sich der Frage der neuen Verantwortung der Bundesrepublik in der Weltordnung nach den Anschlägen vom 11. September.
Kapitel 3 untersucht die Veränderungen in den deutsch-amerikanischen Beziehungen in Folge der 9/11-Terroranschläge. Es beleuchtet die Rede von US-Präsident George W. Bush vom 29. Januar 2002, die deutsche Reaktion darauf und die wachsende Spaltung in „altes“ und „neues“ Europa. Kapitel 3.1 befasst sich mit der State of the Union Message von George W. Bush vom 29. Januar 2002, die die Weichen für einen möglichen Militäreinsatz gegen den Irak stellte. Kapitel 3.2 beleuchtet die deutsche Antwort auf die US-amerikanischen Pläne und die Debatte um die deutsche Rolle in einem möglichen Irak-Krieg.
Kapitel 3.3 analysiert die zunehmende Spaltung zwischen „altem“ und „neuem“ Europa in der Frage des Irak-Krieges und die unterschiedlichen Positionen Deutschlands und Frankreichs.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik im Kontext der Terroranschläge vom 11. September 2001. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen gehören: deutsche Solidaritätsbekundung, militärischer Einsatz in Afghanistan, Operation Enduring Freedom, deutsch-amerikanische Beziehungen, Irak-Krieg, „altes“ und „neues“ Europa, Zivilmacht, transnationale Bedrohungen, internationale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete "uneingeschränkte Solidarität" in der deutschen Außenpolitik nach 9/11?
Es war das Versprechen von Bundeskanzler Gerhard Schröder an die USA, sie im Kampf gegen den internationalen Terrorismus politisch und militärisch zu unterstützen.
Welche Rolle spielten deutsche Truppen in Afghanistan?
Deutschland beteiligte sich militärisch an der Operation Enduring Freedom und engagierte sich massiv im zivilen Wiederaufbau des Landes.
Warum kam es zum Zerwürfnis zwischen Deutschland und den USA?
Hauptursache war die strikte Ablehnung eines militärischen Eingreifens im Irak durch die rot-grüne Bundesregierung, was im Gegensatz zur US-Politik unter George W. Bush stand.
Was ist der Unterschied zwischen dem „alten“ und „neuen“ Europa?
Der Begriff beschreibt die Spaltung europäischer Staaten während der Irak-Krise: Das „alte“ Europa (z. B. Deutschland, Frankreich) lehnte den Krieg ab, während das „neue“ Europa die USA unterstützte.
Wie veränderte sich Deutschlands Verantwortung in der Weltordnung?
Deutschland musste seine Rolle als „Zivilmacht“ neu definieren und sich der Herausforderung stellen, militärische Verantwortung in internationalen Bündnissen zu übernehmen.
- Citar trabajo
- Nikolai Schön (Autor), 2007, Die Aussen- und Sicherheitspolitik der rot-grünen Koalition nach dem 11. September, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164122