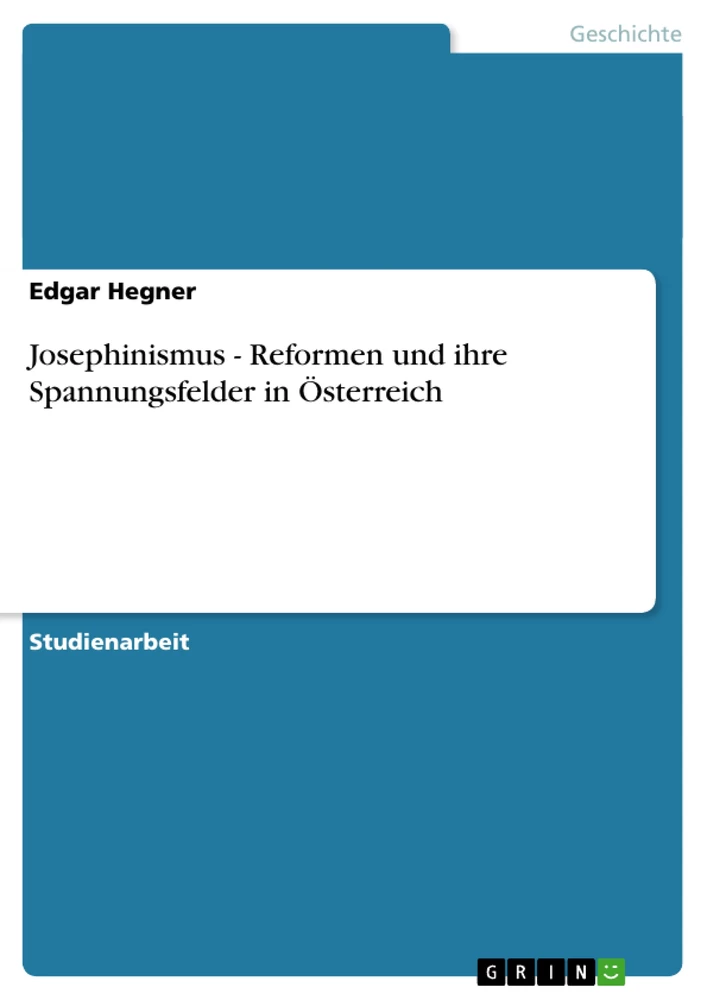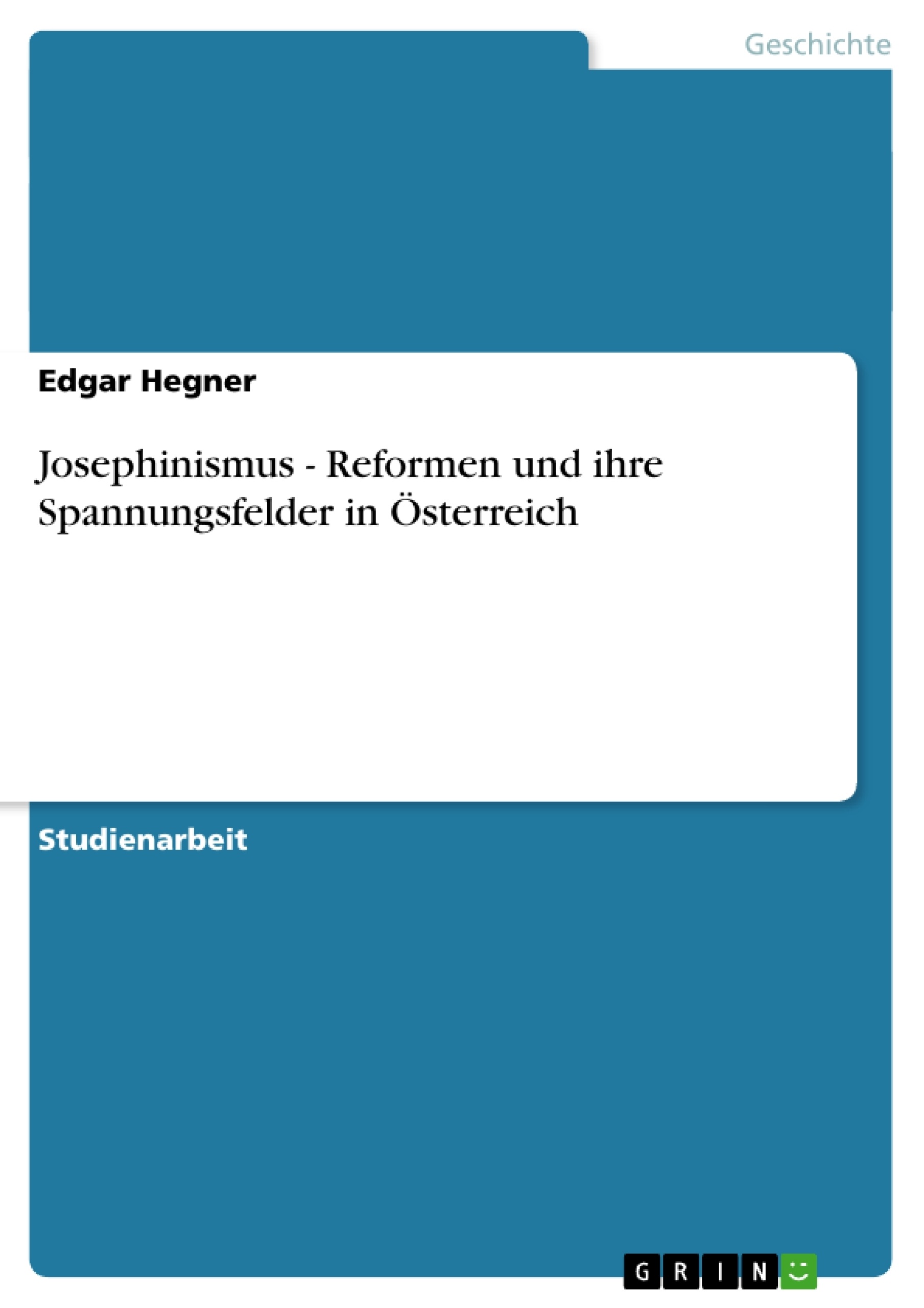[...] Die josephinischen Reformen versuchten die Gesellschaft effizient zu organisieren. Neben dem Nützlichkeitsdenken war ein starker Glaube an christliche Werte jedoch noch vorhanden. Der Josephinismus versinnbildlicht für mich einen Versuch, aufklärerisches Gedankengut mit einem ethischen Anspruch in die politische Realität umzusetzen. Gekennzeichnet sind die Reformen auch von der Vorstellung, Glaube und Vernunft liessen sich vereinen. Die kirchenpolitischen Reformen tragen noch keine liberalen Züge. Die Institutionalisierung entpuppt sich dabei teilweise als verständnislos und blind gegenüber gewissen Werten, die schwierig mit Nützlichkeitskriterien zu messen sind.
Meine Neugier wurde ebenfalls von der Tatsache anzogen, dass dem Habsburgerstaat im Gegensatz zu anderen absolutistischen Regierungen, die an mangelnder Reformfähigkeit scheiterten, ein Übermass an Reformen zum Verhängnis wurde. So versuche ich in dieser Arbeit dem spezifisch österreichischen Weg der Aufklärung nachzugehen, indem ich die dringendsten oder einschneidensten Neuerungen dieser reformfreudigen Zeit unter Maria Theresia und Joseph II. charakterisiere. Dabei versuche ich die wesentlichsten Reformen aller Lebensbereiche einzubeziehen, um die unterschiedlichen, jedoch zusammenhängenden theresianisch-josephinischen Reformen in ihrer Einheit einzufangen. So stellen die kirchenpolitischen Reformen nicht etwa nur das Resultat eines Reformkatholizismus dar, sondern stehen in der Konsequenz eines alle gesellschaftlichen Bereiche erfassenden Nützlichkeitsdenkens. Ich werde in meiner Arbeit auch der Frage nachgehen, welche Charakteristiken der Geschichte Österreichs auf die Zeit des Josephinismus wirkten und wo die Voraussetzungen und Entwicklungslinien der josephinistischen Reformen zu finden sind. Da das Verhältnis zwischen Kirche und Staat den Josephinismus besonders prägte, wird dieser Erörterung einen gebührenden Platz eingeräumt. Dabei versuche ich u.a. die wirtschaftspolitischen Vorstellungen hinter den kirchenpolitischen Reformen aufzudecken. Ich widme mich auch der Frage, ob die josephinischen Reformen mit ihrer Radikalität die Kirche zunehmend auflösten, oder ob es darum ging, die Missstände der Kirche zu beseitigen und den Katholizismus zu reformieren. Zunächst werde ich mich aber mit dem Begriff des Josephinismus, der sich in im vergangenen Jahrhundert erheblich gewandelt hat, näher auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Zum Begriff des Josephinismus
- 2. Voraussetzungen des Josephinismus
- 2.1 Staatskirchliche Tradition Österreichs
- 2.2 Verhältnis der österreichischen Länder zum Heiligen Römischen Reich
- 2.3 Modernisierung als existentielle Notwendigkeit
- 2.4 Geistige Strömungen und der Jansenistische Kreis Wiens
- 3. Die Reformen
- 3.1 Finanz-, Steuer-, Regierungs- und Verwaltungsreformen.
- 3.1.1 Ausgangslage vor den grossen Reformen
- 3.1.2 Haugwitzsche Reformen
- 3.1.3 Fundament für den Wohlfahrtsstaat des aufgeklärten Absolutismus
- 3.1.4 Ära Kaunitz
- 3.2 Kirchenpolitische Reformen
- 3.2.1 Die Reform der Kirche eine Notwendigkeit der Zeit
- 3.2.3 Wirtschaftspolitischer Hintergrund der Kirchenreform
- 3.2.4 Auflösung oder Erneuerung der Kirche durch den Staat?
- 3.2.5 Vernünftige Gottesverehrung und Episkopalismus
- 3.2.6 Reform des Klosterwesens
- 3.2.7 Pfarregulierungen
- 3.2.8 Generalseminare
- 3.2.9 Von der toleranten Mission zum Toleranzpatent von 1781
- 3.2.10 Bildungs-, Gesundheits- und Fürsorgepolitik
- 3.1 Finanz-, Steuer-, Regierungs- und Verwaltungsreformen.
- 4. Das Scheitern der Reformpolitik Josephs II.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Reformen, die unter Maria Theresia und Joseph II. im Habsburgerreich durchgeführt wurden und die als „Josephinismus“ bezeichnet werden. Ziel ist es, den spezifisch österreichischen Weg der Aufklärung zu beleuchten, indem die wichtigsten Reformen aller Lebensbereiche analysiert werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat, das den Josephinismus massgeblich prägte.
- Die Wurzeln des modernen Staates und die Entstehung eines institutionalisierten Gesamtstaates
- Der Versuch, aufklärerisches Gedankengut mit ethischen Ansprüchen in die politische Realität umzusetzen
- Die Verbindung von Glaube und Vernunft in den josephinischen Reformen
- Die Charakteristiken der österreichischen Geschichte und die Voraussetzungen für die josephinischen Reformen
- Die Frage, ob die Reformen die Kirche auflösen oder reformieren sollten
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort beleuchtet die Motivation des Autors, sich mit der Epoche des Josephinismus auseinanderzusetzen. Es hebt die Suche nach den Wurzeln des heutigen Zusammenlebens hervor und beleuchtet die Reformen als einen Übergang vom mittelalterlichen Personenverbandsstaat zum institutionalisierten Gesamtstaat.
- 1. Zum Begriff des Josephinismus: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung des Begriffs „Josephinismus“. Es wird die Veränderung des Begriffs im Laufe des 19. Jahrhunderts beleuchtet und der Einfluss der Reformpolitik Josephs II. auf den modernen Staat Österreichs betrachtet.
- 2. Voraussetzungen des Josephinismus: Das Kapitel analysiert die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. beeinflussten. Es werden die staatskirchliche Tradition Österreichs, das Verhältnis zum Heiligen Römischen Reich, die Notwendigkeit der Modernisierung und die geistigen Strömungen der Zeit behandelt.
- 3. Die Reformen: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Reformen, die während der Herrschaft von Maria Theresia und Joseph II. umgesetzt wurden. Es behandelt Finanz-, Steuer-, Regierungs- und Verwaltungsreformen sowie die Kirchenpolitik und die damit verbundenen Veränderungen im Bereich der Bildung, Gesundheit und Fürsorge.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Josephinismus, einer umfassenden Reformbewegung im Habsburgerreich im 18. Jahrhundert. Sie analysiert die Reformen unter Maria Theresia und Joseph II., die von einer Verbindung von Aufklärung und christlicher Moral geprägt waren. Wichtige Themen sind die staatliche Organisation und Modernisierung, die Kirchenpolitik, die Säkularisierung und das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft. Die Arbeit untersucht auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hintergründe der Reformen und stellt die Frage, ob sie die Kirche auflösen oder reformieren sollten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Begriff "Josephinismus"?
Der Josephinismus bezeichnet die umfassenden Reformen unter Maria Theresia und besonders Joseph II. im Habsburgerreich, die Aufklärung mit staatlichem Nützlichkeitsdenken verbanden.
Was war das Ziel der kirchenpolitischen Reformen?
Ziel war die Unterordnung der Kirche unter den Staat, die Beseitigung von Missständen und die Ausrichtung der Kirche auf einen gesellschaftlichen Nutzen (z. B. Bildung und Fürsorge).
Warum scheiterten viele Reformen Josephs II.?
Das radikale Tempo und die Missachtung traditioneller Werte führten zu Widerständen; dem Staat wurde ein "Übermaß an Reformen" zum Verhängnis.
Was ist das Toleranzpatent von 1781?
Es gewährte Protestanten und Orthodoxen im Habsburgerreich erstmals eine eingeschränkte Religionsfreiheit und markiert einen Meilenstein der josephinischen Aufklärung.
Welchen Einfluss hatte der Josephinismus auf den modernen Staat?
Die Reformen legten den Grundstein für einen institutionalisierten Gesamtstaat, eine effiziente Verwaltung und erste Ansätze eines Wohlfahrtsstaates.
- Quote paper
- Edgar Hegner (Author), 2002, Josephinismus - Reformen und ihre Spannungsfelder in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16417