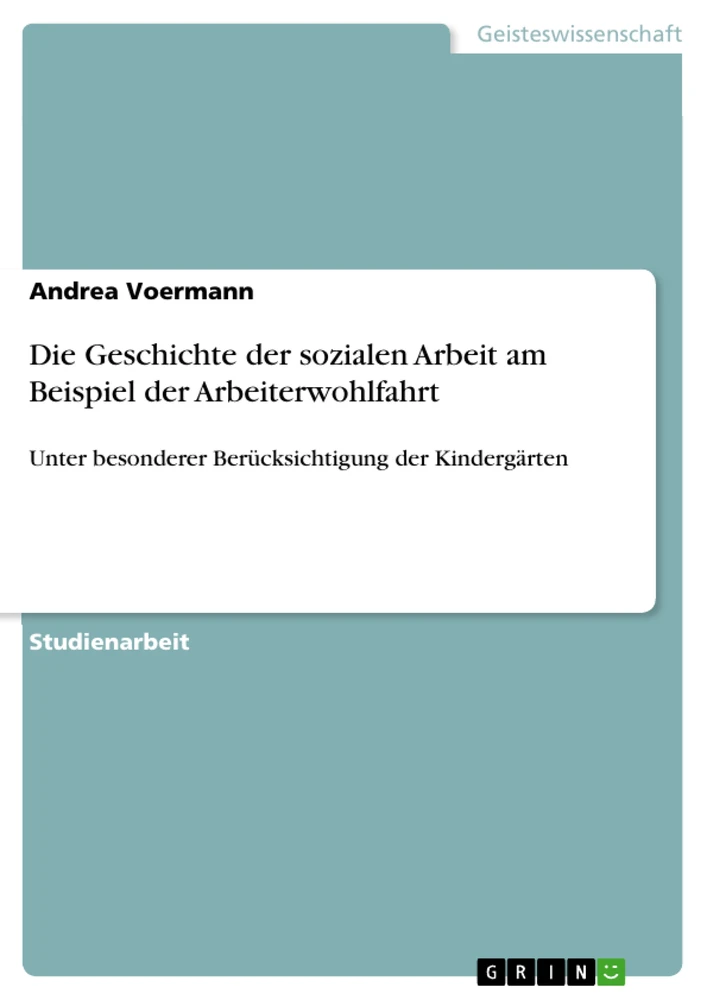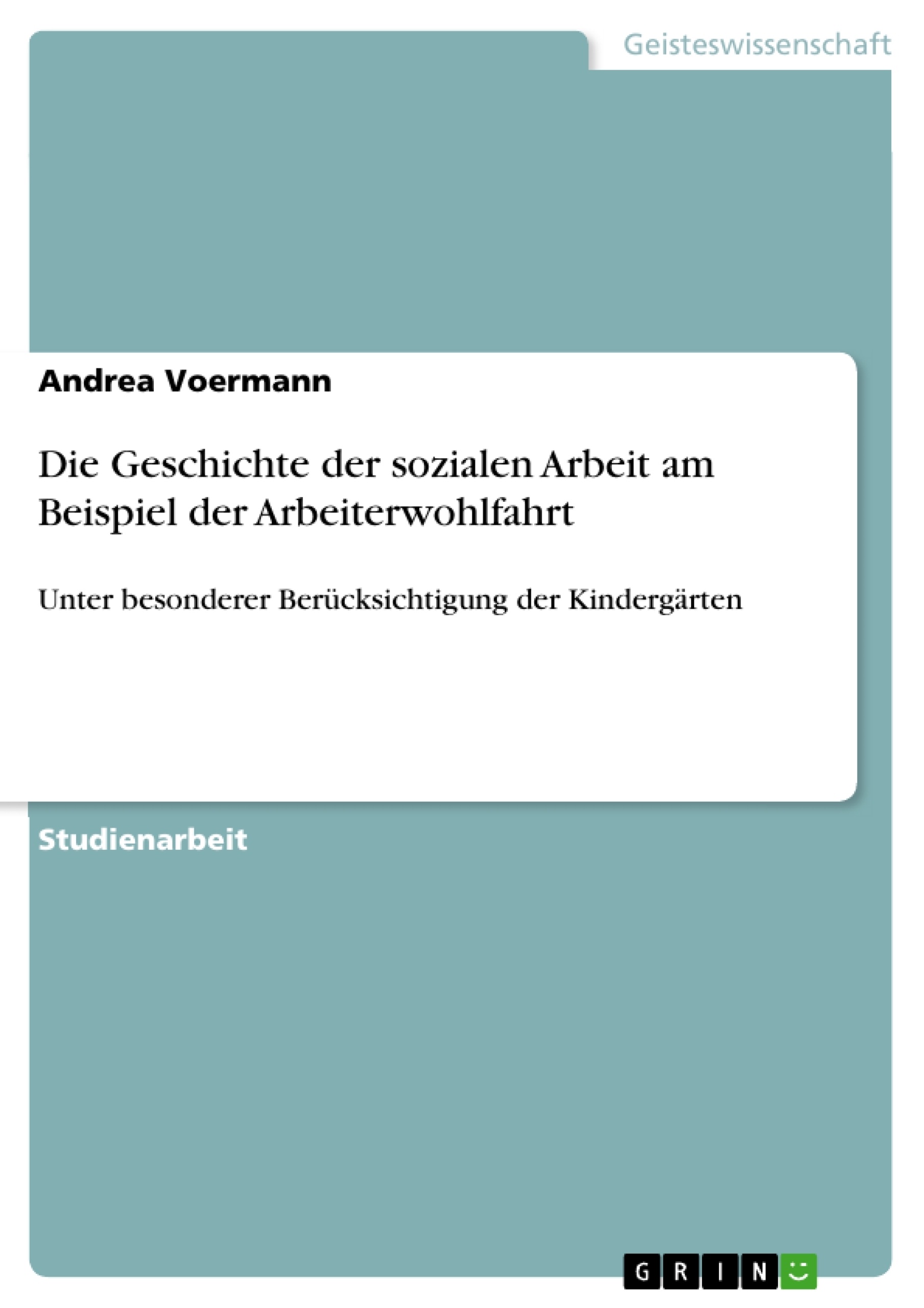Die AWO hat sich aufgrund ihrer geringen Anzahl von Kinderbetreuungseinrichtungen in der gesamten Trägerlandschaft stets bemüht, Einrichtungen mit Modellcharakter zu schaffen um eine fortschrittliche Pädagogik zu forcieren. Die AWO hat ebenfalls als einer der ersten Wohlfahrtsverbände begonnen ein Qualitätsmanagement einzuführen und damit die Qualität in den Einrichtungen zu sichern und Qualitätsstandards für die pädagogische Arbeit festzulegen.Dabei werde ich mich exemplarisch der Geschichte der AWO Kita Jan-Koopmann in Oldenburg widmen, da ich davon ausgehe, das anhand eines konkreten Beispiels diese Entwicklung besonders gut nachvollzogen werden kann. Dieses eine Beispiel ist sicherlich nicht repräsentativ, zeigt aber in einem regionalen Bezug deutlich auf, wie sich die pädagogische Arbeit an die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der Arbeiterwohlfahrt
- Geschichtlicher Hintergrund
- Die Arbeiterwohlfahrt von 1919 - 1933
- Die Gründung der AWO
- Die Auflösung
- Die Arbeiterwohlfahrt nach 1946
- Neubeginn und Wiederaufbau
- Die AWO heute
- Die AWO als modernes Dienstleistungsunternehmen
- Leitbild der AWO
- Der Kindergarten: von der Kleinkinderbewahranstalt zur Bildungseinrichtung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Der Kindergarten der AWO
- Entstehung und Gründung
- Der Kindergarten heute als moderne Bildungseinrichtung am Beispiel der Kita Jan – Koopmann (Oldenburg)
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Geschichte der Arbeiterwohlfahrt (AWO), insbesondere mit der Entwicklung und den Herausforderungen des Verbandes in Bezug auf Kinderbetreuungseinrichtungen. Der Fokus liegt auf der Gründungsidee der AWO, ihrer Entwicklung von einer Selbsthilfeorganisation zu einem führenden Wohlfahrtsverband und ihrer Rolle in der Förderung einer fortschrittlichen Pädagogik.
- Gründung und Entwicklung der AWO
- Die Bedeutung der Selbsthilfe und Solidarität für die AWO
- Die Rolle der AWO in der Geschichte der Kinderbetreuung
- Das Engagement der AWO für Qualitätsmanagement und Qualitätsstandards
- Die Anpassung der pädagogischen Arbeit an veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und beschreibt die Motivation und den Fokus der Arbeit. Sie beleuchtet die besondere Rolle der AWO in der Geschichte der Kinderbetreuung und die Bedeutung der Modellhaftigkeit ihrer Einrichtungen.
Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Arbeiterwohlfahrt, beginnend mit dem geschichtlichen Hintergrund im Kontext des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik. Der Fokus liegt auf der Gründung der AWO, den Herausforderungen, mit denen sich der Verband auseinandersetzen musste, und der Entwicklung von einer Selbsthilfeorganisation zu einem führenden Wohlfahrtsverband.
Kapitel 3 befasst sich mit der Geschichte des Kindergartens, beginnend mit den Anfängen als Kleinkinderbewahranstalt und der Entwicklung zur Bildungseinrichtung.
Kapitel 4 konzentriert sich auf den Kindergarten der AWO. Es beleuchtet die Entstehung und Gründung von Kindergärten durch die AWO und zeigt am Beispiel der Kita Jan – Koopmann in Oldenburg auf, wie sich der Kindergarten als moderne Bildungseinrichtung an die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst hat.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Arbeiterwohlfahrt, Geschichte der sozialen Arbeit, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Selbsthilfe, Solidarität, Qualitätsmanagement, pädagogische Arbeit, Modellcharakter, gesellschaftliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an den Kinderbetreuungseinrichtungen der AWO?
Die AWO schafft Einrichtungen mit Modellcharakter, um eine fortschrittliche Pädagogik zu fördern und setzt als einer der ersten Verbände auf ein umfassendes Qualitätsmanagement.
Wann wurde die Arbeiterwohlfahrt gegründet?
Die AWO wurde im Jahr 1919 gegründet und entwickelte sich in der Zeit der Weimarer Republik zu einer bedeutenden Selbsthilfeorganisation.
Welches konkrete Beispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit widmet sich exemplarisch der Geschichte der AWO Kita Jan-Koopmann in Oldenburg, um die Anpassung an gesellschaftliche Rahmenbedingungen aufzuzeigen.
Wie hat sich das Konzept des Kindergartens historisch gewandelt?
Der Kindergarten entwickelte sich von einer reinen „Kleinkinderbewahranstalt“ hin zu einer modernen Bildungseinrichtung mit pädagogischen Qualitätsstandards.
Was sind die zentralen Werte im Leitbild der AWO?
Zentrale Werte sind Solidarität, Selbsthilfe und die Förderung einer gerechten Gesellschaft durch moderne soziale Dienstleistungen.
Was geschah mit der AWO nach 1946?
Nach der Auflösung während der NS-Zeit kam es ab 1946 zum Neubeginn und Wiederaufbau der Organisation als modernes Dienstleistungsunternehmen.
- Citar trabajo
- Andrea Voermann (Autor), 2010, Die Geschichte der sozialen Arbeit am Beispiel der Arbeiterwohlfahrt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164323