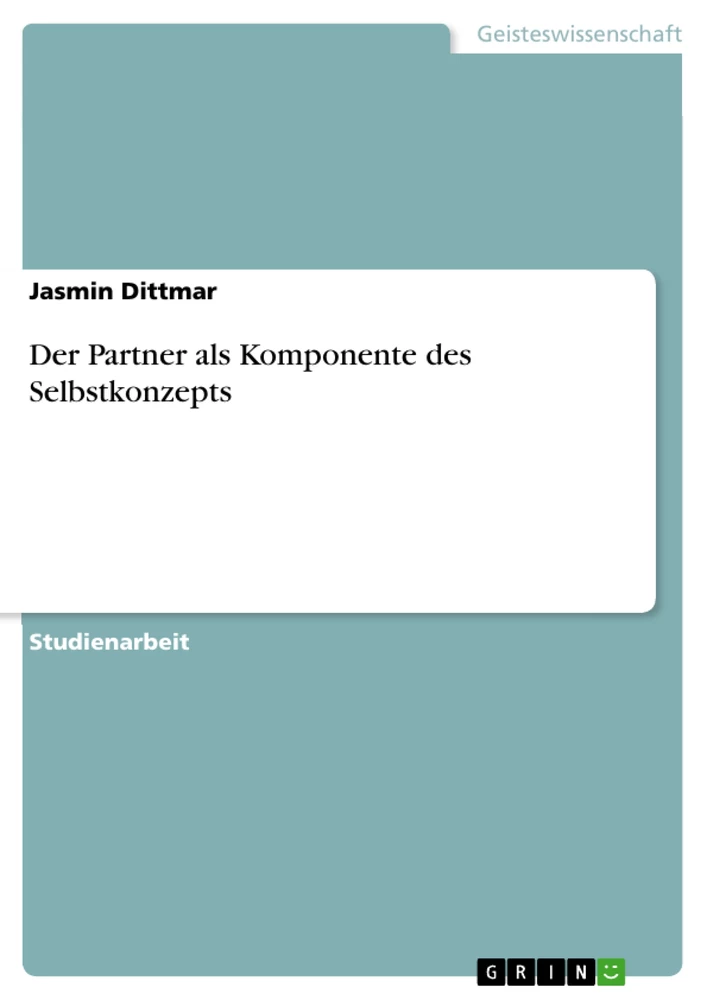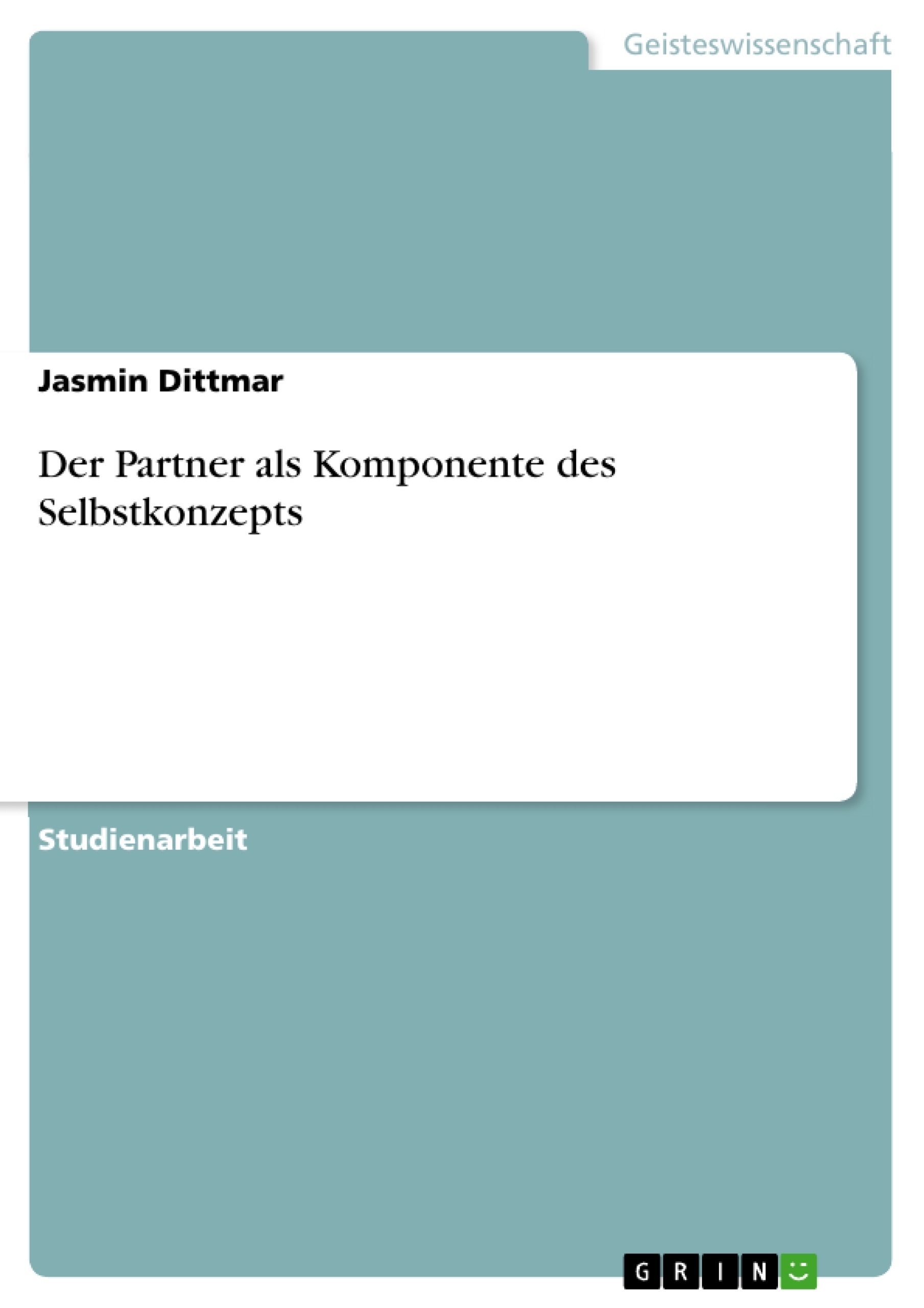Die gesellschaftlichen Entwicklungen und innerhalb dieser die Entwicklungen in der Paarbeziehung gehen im Verlauf der letzten Jahrzehnte deutlich in Richtung Individualisierung, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit des Individuums. Ziel dieser Arbeit ist es erstens darzustellen, welche Funktionen der Partner als eine Komponente des Selbstkonzepts für die Konstruktion des Selbst eines Individuums einnehmen kann. Zweitens soll ein Überblick gegeben werden, welche Risiken für das Selbst aus der Partnerschaft heraus entstehen können, wenn diese für die Konstruktion des Selbst eine wesentliche Bedeutung einnimmt. Als Funktionen des Partners in dieser Hinsicht werden die Selbstergänzung durch Selbstwerterhöhung und Stilisierung nach außen, die Bildung der persönlichen Identität sowie das Dienen als Projektionsfläche für Wünsche und Ideale beschrieben. Mögliche Risiken bei der Bewahrung des Selbst werden in der Abhängigkeit vom Partner, dem Selbstbetrug durch Idealisierung des Partners und der Diskrepanz zwischen Anpassung und Ausleben eigener Bedürfnisse identifiziert. Im Falle einer Trennung ist sehr wahrscheinlich mit einem Bruch des Selbstkonzepts zu rechnen, falls dem Partner innerhalb dessen ein großer Raum zugeteilt war. Dieser Bruch bietet die Chance auf Neuorientierung und Selbsterkenntnis mit der Konsequenz der Ausbildung eines veränderten Selbstkonzepts. Abschließend wird als Quintessenz der Abhandlung festgehalten, dass in der heutigen postmodernen Gesellschaft eine stabile Partnerschaft ohne ein solides, vom Partner weitestgehend unabhängiges Selbstkonzept schwer zu realisieren und aufrecht zu erhalten sein wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abstract
- 2 Einleitung
- 3 Die Konstruktion des Selbst
- 4 Funktionen des Partners für das Selbst
- 4.1 Selbstergänzung
- 4.1.1 Steigerung des Selbstwertgefühls
- 4.1.2 Außengerichtetes Stilmittel
- 4.3 Projektionsfläche für Wünsche und Ideale
- 4.1 Selbstergänzung
- 5 Faktoren der Bedrohung des Selbst in der Partnerschaft
- 5.1 Abhängigkeit vom Partner
- 5.2 Unbewusster Selbstbetrug durch Idealisierung
- 5.3 Diskrepanz zwischen Anpassung und eigenen Bedürfnissen
- 6 Chancen und Risiken im Falle einer Trennung vom Partner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Funktionen des Partners als Komponente des Selbstkonzepts und den damit verbundenen Risiken. Das Ziel ist es, die Rolle des Partners bei der Konstruktion des Selbst zu erläutern und aufzuzeigen, welche Gefahren aus der Partnerschaft entstehen können, wenn der Partner eine zentrale Bedeutung für das Selbstkonzept einnimmt.
- Die Selbstergänzung durch Selbstwerterhöhung und Stilisierung nach außen.
- Die Bildung der persönlichen Identität durch den Partner.
- Der Partner als Projektionsfläche für Wünsche und Ideale.
- Die Abhängigkeit vom Partner als potenzielles Risiko.
- Die Diskrepanz zwischen Anpassung und eigenen Bedürfnissen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstinszenierung im Kontext der heutigen "flüchtigen Moderne" ein und stellt den Partner als eine potenzielle Stilkomponente des Selbstkonzepts vor. Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Ansätze zur Konstruktion des Selbstkonzepts und beschreibt die Komplexität und Relativität dieses Prozesses. Kapitel 4 fokussiert auf die Funktionen des Partners für die Selbstgestaltung, wobei Selbstergänzung durch Selbstwertsteigerung und Stilisierung, die Bildung der persönlichen Identität und der Partner als Projektionsfläche für Wünsche und Ideale thematisiert werden. Kapitel 5 analysiert die Risiken, die aus der Partnerschaft für das Selbst erwachsen können, wie Abhängigkeit vom Partner, Selbstbetrug durch Idealisierung und die Diskrepanz zwischen Anpassung und eigenen Bedürfnissen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Selbstinszenierung, Selbstkonzept, Partner, Selbstwert, Abhängigkeit, Idealisierung, Anpassung, Trennung, Identität.
Häufig gestellte Fragen
Welche Funktion hat ein Partner für das Selbstkonzept?
Der Partner dient oft der Selbstergänzung, der Steigerung des Selbstwertgefühls und als Projektionsfläche für eigene Wünsche und Ideale.
Welche Risiken birgt eine enge Partnerschaft für die Identität?
Es besteht die Gefahr einer emotionalen Abhängigkeit, des Selbstbetrugs durch Idealisierung und einer Diskrepanz zwischen Anpassung und eigenen Bedürfnissen.
Was passiert mit dem Selbstkonzept bei einer Trennung?
Wenn der Partner einen großen Raum im Selbstkonzept einnahm, kommt es oft zu einem Bruch, der jedoch auch die Chance auf Neuorientierung und Selbsterkenntnis bietet.
Was wird unter „Stilisierung nach außen“ verstanden?
Der Partner wird hierbei als ein „Stilmittel“ genutzt, um das eigene Bild in der Öffentlichkeit aufzuwerten oder eine bestimmte Identität zu inszenieren.
Ist ein unabhängiges Selbstkonzept für moderne Paarbeziehungen wichtig?
Ja, die Arbeit folgert, dass eine stabile Partnerschaft in der heutigen Gesellschaft schwer ohne ein solides, vom Partner weitestgehend unabhängiges Selbstkonzept möglich ist.
- Citation du texte
- Jasmin Dittmar (Auteur), 2010, Der Partner als Komponente des Selbstkonzepts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164334