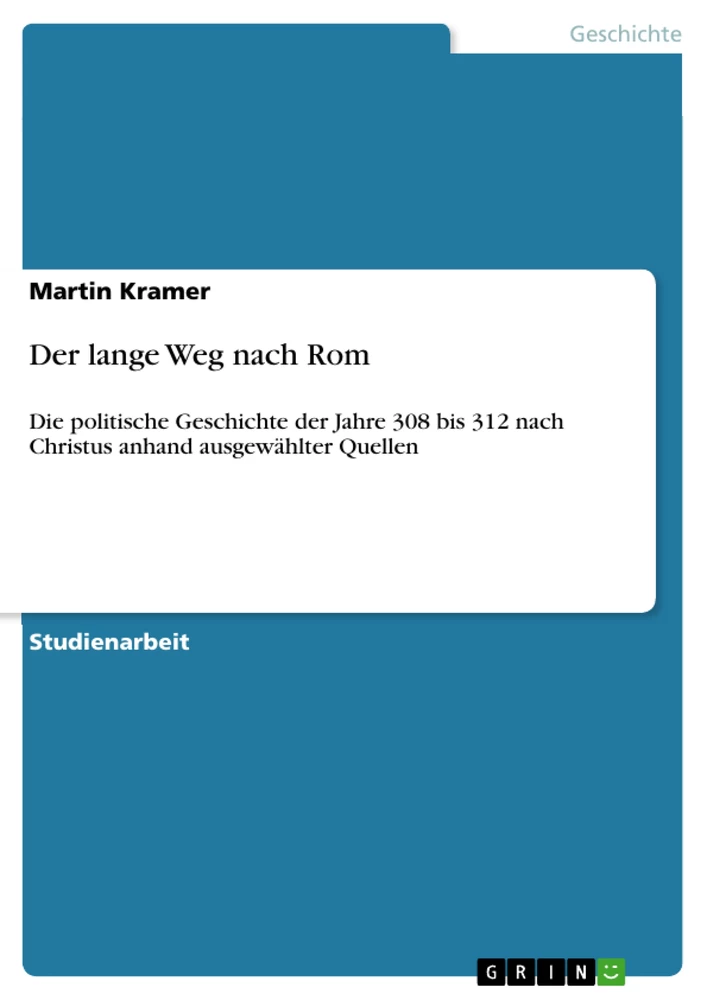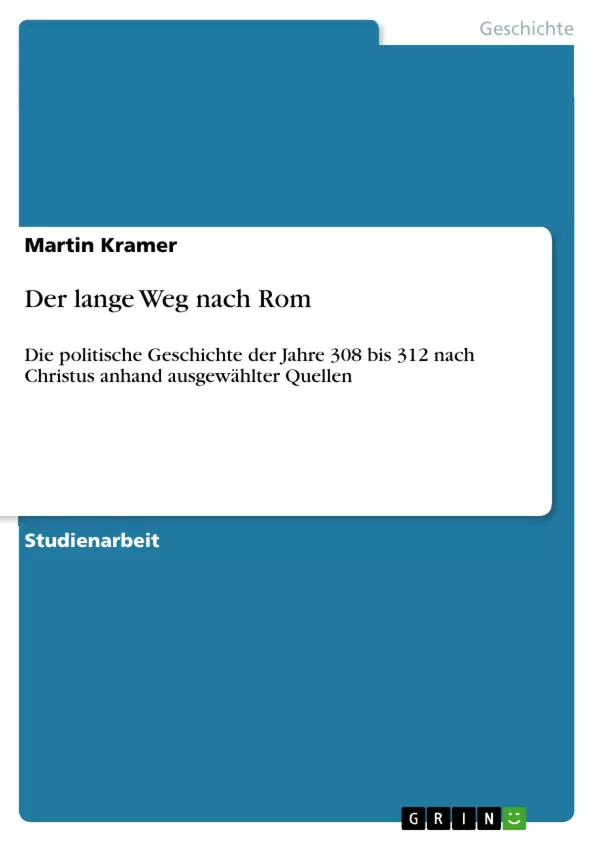Die Geschichte der Jahre 308 bis 312 nach Christus, von der Kaiserkonferenz in Carnuntum bis zur Schlacht an der Milvischen Brücke vor den Toren Roms, erscheint als ein einziges Wirrwarr ständig wechselnder Bündnisse und Konflikte zwischen rechtmäßigen oder nachträglich legitimierten Herrschern und Usurpatoren und der Konkurrenz zwischen dynastischem und leistungsbezogenem Herrschaftssystem. Zudem sind die Quellen zu dieser Zeit in vielen wesentlichen Punkten widersprüchlich und ihre Darstellung durch Zeit oder politische bzw. religiöse Haltung der Verfasser verzerrt.
In dieser Arbeit werde ich also zunächst auf die wichtigsten Quellen, ihre Stellung und zeitliche Einordnung eingehen und im Hauptteil den Versuch unternehmen, anhand dieser Zeugnisse und ausgewählter moderner Forschungsliteratur ein strukturiertes Bild dieser kurzen, aber bewegten Epoche zu zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Quellenproblem
- 3. Politische Entwicklung bis zur Schlacht an der Milvischen Brücke (284 – 312 n.Chr.)
- 3.1 Vorgeschichte bis 308 n.Chr.
- 3.2 Die Konferenz von Carnuntum
- 3.3 Maximians Ende – Eine neue Legitimation für Konstantin
- 3.4 Die Usurpation des Domitius Alexander in Africa
- 3.5 Das Galeriusedikt von 311 n.Chr.
- 3.6 Spannungen und Bündnisse im Osten
- 3.7 Konstantins Zug gegen Maxentius
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Geschichte des Römischen Reiches zwischen 308 und 312 n. Chr., eine Periode geprägt von wechselnden Bündnissen, Konflikten und der Konkurrenz zwischen verschiedenen Herrschaftssystemen. Das Ziel ist es, anhand der vorhandenen Quellen und der modernen Forschung ein strukturiertes Bild dieser Epoche zu zeichnen, trotz der Widersprüchlichkeiten und der durch die Verfasser beeinflussten Quellen.
- Das Quellenproblem der spätantiken Geschichtsschreibung
- Die politische Lage und die Machtkämpfe im Römischen Reich
- Die Rolle Konstantins in den politischen Ereignissen
- Die verschiedenen Herrschaftslegitimationen
- Der Einfluss der Religion auf die politische Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Periode zwischen 308 und 312 n. Chr. als eine Zeit ständiger Veränderungen in den Bündnissen und Konflikten zwischen römischen Herrschern und Usurpatoren, mit der Konkurrenz zwischen dynastischem und leistungsbezogenem Herrschaftssystem. Sie hebt das Problem der widersprüchlichen Quellen und deren Beeinflussung durch Zeit, Politik und Religion hervor. Die Arbeit kündigt an, die wichtigsten Quellen zu betrachten und mit Hilfe der modernen Forschung ein strukturiertes Bild dieser Epoche zu schaffen. Besondere Erwähnung finden dabei die Werke von Herrmann-Otto, Feld und Girardet als wichtige Sekundärliteratur.
2. Das Quellenproblem: Dieses Kapitel analysiert die Ambivalenz der spätantiken Quellen bezüglich der Darstellung Konstantins. Es werden christliche Autoren wie Eusebius und Laktanz mit ihren tendenziell positiven Darstellungen Konstantins gegenübergestellt den heidnischen Quellen, die ein negatives Bild zeichnen oder das Christentum ignorieren. Eusebius' Vita Constantini und Historia Ecclesiastica werden als wichtige, wenn auch tendenziöse, Quellen hervorgehoben. Laktanz' "De mortibus persecutorum" wird als weitere positive Quelle beschrieben. Der Anonymus Valesianus wird als eine Quelle mit umstrittener religiöser Ausrichtung und Datierung präsentiert, während Aurelius Victor, Eutrop und Zosimus mit ihren unterschiedlichen Perspektiven und Intentionen analysiert werden. Das Kapitel unterstreicht die Herausforderungen und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Quellen.
3. Politische Entwicklung bis zur Schlacht an der Milvischen Brücke (284 – 312 n.Chr.): Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die politische Entwicklung im Römischen Reich von Diokletians Tetrarchie bis zum Beginn von Konstantins Kampf gegen Maxentius. Es beschreibt Diokletians Reformen, insbesondere die Aufteilung der Herrschaft unter vier Regenten und den Übergang vom dynastischen zum leistungsorientierten Prinzip. Die einzelnen Abschnitte detaillieren die politischen Ereignisse, die Entwicklungen und die verschiedenen Machtansprüche der beteiligten Akteure, um den Kontext für Konstantins Aufstieg zur Macht darzulegen. Durch den Fokus auf die politische Dynamik dieser Jahre werden die Vorbedingungen für die folgenden Ereignisse verständlich.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Römisches Reich, Spätantike, Tetrarchie, Herrschaftssysteme, Quellenkritik, Politische Geschichte, Maxentius, Licinius, Galerius, Christentum, Heidentum, Carnuntum, Milvische Brücke.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Politische Entwicklung im Römischen Reich zwischen 308 und 312 n. Chr."
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die politische Geschichte des Römischen Reiches zwischen 308 und 312 n. Chr., eine Periode geprägt von wechselnden Bündnissen, Konflikten und der Konkurrenz zwischen verschiedenen Herrschaftssystemen. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen Ereignisse und Machtkämpfe dieser Zeit, insbesondere der Rolle Konstantins.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, anhand der vorhandenen Quellen und der modernen Forschung ein strukturiertes Bild dieser Epoche zu zeichnen, trotz der Widersprüchlichkeiten und der durch die Verfasser beeinflussten Quellen. Die Arbeit beleuchtet das Quellenproblem, die politische Lage, die Rolle Konstantins, verschiedene Herrschaftslegitimationen und den Einfluss der Religion auf die politische Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel:
- Kapitel 1 (Einleitung): Beschreibt die Zeit als Periode ständiger Veränderungen und Konflikte zwischen römischen Herrschern und Usurpatoren, die Konkurrenz zwischen dynastischem und leistungsbezogenem Herrschaftssystem sowie das Problem widersprüchlicher Quellen.
- Kapitel 2 (Das Quellenproblem): Analysiert die Ambivalenz der spätantiken Quellen zur Darstellung Konstantins, vergleicht christliche und heidnische Quellen und betont die Notwendigkeit einer kritischen Quellenanalyse. Es werden wichtige Quellen wie Eusebius' Vita Constantini, Laktanz' "De mortibus persecutorum" und der Anonymus Valesianus erwähnt.
- Kapitel 3 (Politische Entwicklung bis zur Schlacht an der Milvischen Brücke): Bietet einen Überblick über die politische Entwicklung vom Ende der Tetrarchie bis zum Beginn von Konstantins Kampf gegen Maxentius, beschreibt Diokletians Reformen und detailliert die politischen Ereignisse und Machtansprüche der beteiligten Akteure.
- Kapitel 4 (Fazit): (Der Inhalt des Fazits ist in der Vorschau nicht explizit beschrieben.)
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf spätantike Quellen wie die Werke von Eusebius (Vita Constantini und Historia Ecclesiastica), Laktanz ("De mortibus persecutorum"), den Anonymus Valesianus, Aurelius Victor, Eutrop und Zosimus. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Perspektiven und Intentionen dieser Quellen und betont die Notwendigkeit einer kritischen Quellenanalyse.
Welche Sekundärliteratur wird zitiert?
Die Arbeit erwähnt Herrmann-Otto, Feld und Girardet als wichtige Sekundärliteratur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Konstantin der Große, Römisches Reich, Spätantike, Tetrarchie, Herrschaftssysteme, Quellenkritik, Politische Geschichte, Maxentius, Licinius, Galerius, Christentum, Heidentum, Carnuntum, Milvische Brücke.
- Arbeit zitieren
- Martin Kramer (Autor:in), 2009, Der lange Weg nach Rom, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164456