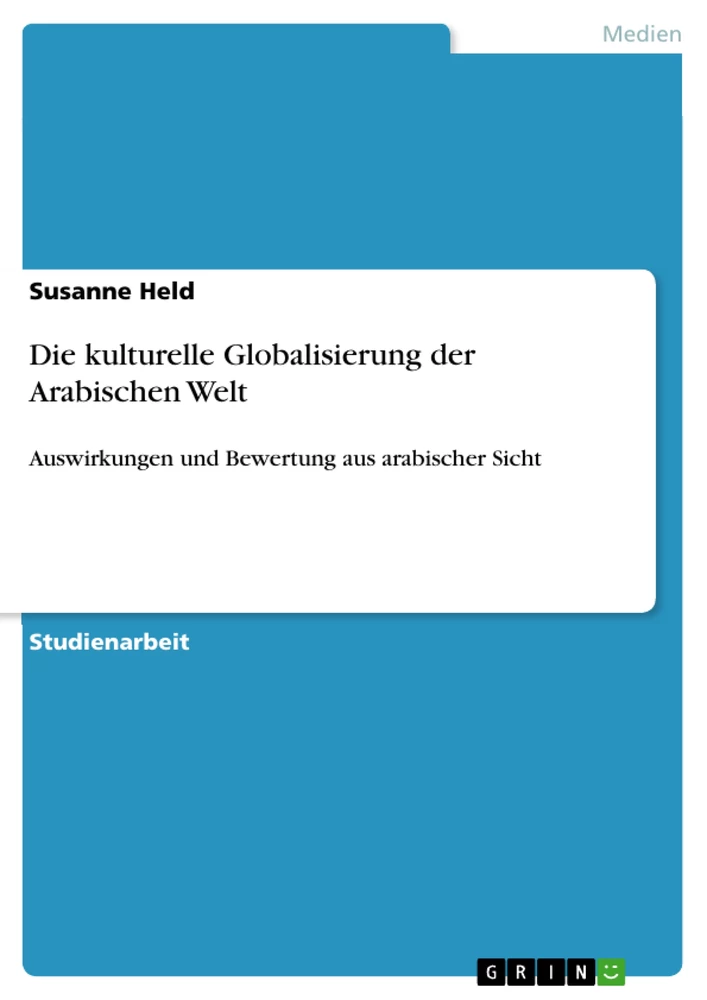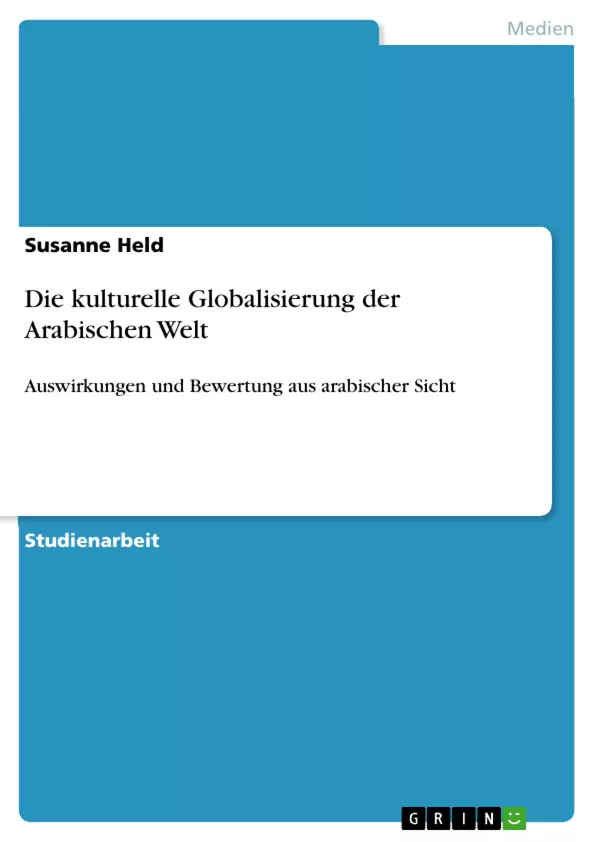“Although globalization covers a wider range of topics, […] the majority of Arab intellectuals are primarily addressing the cultural challenges of globalization and the ways in which local identities are affected.” (Hamzawy 2006, 52). Dieses Zitat zeigt, dass nicht nur ökonomische Faktoren der Globalisierung in der Arabischen Welt eine Rolle spielen, sondern besonders ihre kulturelle Dimension stark thematisiert wird.
Prozesse interkulturellen Austauschs sind seit Jahrtausenden Teil der Menschheitsgeschichte. Die Verbreitung neuer Technologien und Transportmittel hat diese Entwicklung intensiviert und zu einer Komprimierung von Zeit und Raum geführt (Heidrich 1999, 27). Häufig ist die Rede davon, dass damit eine kulturelle Homogenisierung bzw. die Entwicklung einer „neuen Weltkultur“ verbunden sei (Beynon/ Dunkerley 2000, 13, 22). Die Beschleunigung der weltweiten Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen führt jedoch auch dazu, dass kulturelle, ethnische und religiöse Identitätsmerkmale an Bedeutung gewinnen (Fürtig 2001, 41).
Die Arabische Welt ist eine Region, die besonders stark von der Globalisierung betroffen ist: “Nowhere are those costs and benefits [of globalization] as evident as in the Arab world” (Hudson 2006, 148). Der Globalisierungsprozess wurde hier von „außen“, d.h. von den USA und Europa initiiert und die arabischen Länder hatten selbst wenig Kontrolle über seinen Einfluss auf sämtliche Lebensbereiche. Die Perspektive der Globalisierung in der Arabischen Welt ist somit eine ganz andere als im „Westen“. Welche kulturellen Auswirkungen hat die Globalisierung in den arabischen Ländern? Wie werden diese von arabischen Intellektuellen bewertet? Diese Fragen sollen im Folgenden untersucht werden.
Um eine Innenperspektive der arabischen Debatte über die kulturelle Globalisierung zu liefern, wurden möglichst viele übersetzte Werke arabischer Autoren für diese Arbeit herangezogen. Obwohl innerhalb der arabischen Länder Unterschiede bezüglich der Auswirkung und des Umgangs mit der kulturellen Globalisierung bestehen, lassen sich eine gemeinsame Entwicklung und ähnliche Positionen feststellen. Im Folgenden soll somit versucht werden, ein Gesamtbild der Region darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Globalisierung und ihre kulturelle Dimension
- 2.1 Begriffsbestimmungen Globalisierung und Kultur
- 2.2 Kulturelle Dimension der Globalisierung
- 2.3 Auswirkungen kultureller Globalisierung.
- 3. Ausgangssituation in der Arabischen Welt.....
- 3.1 Politische und wirtschaftliche Marginalisierung..\li>
- 3.2 Fukuyamas und Huntingtons Einfluss auf die Globalisierungsdebatte......
- 4. Die kulturelle Globalisierung der Arabischen Welt…....
- 4.1 Regionale Unterschiede..\li>
- 4.2 Verbreitung neuer Technologien......
- 4.3 Wandel der Geschlechterrollen.....
- 5. Die arabische Debatte über die kulturelle Globalisierung.....
- 5.1 Vielfalt an Reaktionen
- 5.2 Kritik an Imperialismus und Amerikanisierung.
- 5.3 Gefährdung der arabischen Identität und Werte..\li>
- 5.4 Entwurf einer muslimischen „Gegenglobalisierung“.
- 5.5 Selektive Adaption...........
- 6. Zusammenfassung und Perspektiven……..\li>
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die kulturelle Dimension der Globalisierung in der Arabischen Welt aus arabischer Perspektive. Das Ziel ist es, die kulturellen Auswirkungen der Globalisierung auf die arabische Welt zu erforschen und die Reaktionen und Bewertungen arabischer Intellektueller auf diese Entwicklungen zu untersuchen.
- Auswirkungen der kulturellen Globalisierung auf die arabische Welt
- Bewertung der Globalisierung aus arabischer Sicht
- Kritik an Imperialismus und Amerikanisierung
- Gefährdung der arabischen Identität und Werte
- Entwicklung einer muslimischen "Gegenglobalisierung"
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und zeigt die Relevanz der kulturellen Dimension der Globalisierung für die Arabische Welt auf. Sie führt in die Thematik ein und erläutert den Fokus der Arbeit auf die arabische Perspektive.
- Kapitel 2: Globalisierung und ihre kulturelle Dimension: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Globalisierung und Kultur und beleuchtet die kulturelle Dimension der Globalisierung. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Globalisierung dargestellt und deren Auswirkungen auf Kulturen im Allgemeinen untersucht.
- Kapitel 3: Ausgangssituation in der Arabischen Welt: Dieses Kapitel beschreibt die spezifischen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Arabischen Welt, die die Wahrnehmung der Globalisierung beeinflussen. Es wird auf die Marginalisierung der Region und den Einfluss von Autoren wie Fukuyama und Huntington auf die Globalisierungsdebatte in der arabischen Welt eingegangen.
- Kapitel 4: Die kulturelle Globalisierung der Arabischen Welt: Dieses Kapitel untersucht die konkreten kulturellen Auswirkungen der Globalisierung in der Arabischen Welt. Es werden exemplarisch der Einfluss neuer Technologien und die Auswirkungen auf die Geschlechterrollen dargestellt.
- Kapitel 5: Die arabische Debatte über die kulturelle Globalisierung: Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Reaktionen arabischer Intellektueller auf die kulturelle Globalisierung vor. Es werden sowohl kritische Positionen, die eine Gefährdung der arabischen Identität und Werte befürchten, als auch Versuche, eine "Gegenglobalisierung" zu entwickeln, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen der kulturellen Globalisierung, der arabischen Welt, der arabischen Identität, der Amerikanisierung, dem Imperialismus und der muslimischen "Gegenglobalisierung". Sie untersucht, wie die kulturelle Dimension der Globalisierung die arabische Welt beeinflusst und wie diese Entwicklungen von arabischen Intellektuellen bewertet werden.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Globalisierung in der Arabischen Welt wahrgenommen?
Im Gegensatz zum Westen wird Globalisierung oft als von außen aufgezwungener Prozess empfunden, der primär kulturelle Herausforderungen für die lokale Identität mit sich bringt.
Was bedeutet "Amerikanisierung" im arabischen Kontext?
Es bezeichnet die Befürchtung einer kulturellen Homogenisierung, bei der westliche (US-amerikanische) Werte und Lebensstile die traditionellen arabisch-islamischen Werte verdrängen.
Welchen Einfluss haben neue Technologien auf die arabische Kultur?
Technologien wie das Internet und Satellitenfernsehen führen zu einem schnelleren Austausch, fordern aber auch traditionelle Rollenbilder und staatliche Informationskontrolle heraus.
Gibt es eine arabische "Gegenglobalisierung"?
Einige Intellektuelle entwerfen Konzepte einer muslimischen Gegenglobalisierung, die auf eigenen religiösen und kulturellen Werten basiert, statt westliche Modelle blind zu kopieren.
Was ist "selektive Adaption" in der Globalisierungsdebatte?
Damit ist die Strategie gemeint, nützliche Aspekte der Globalisierung (wie Technik/Wissenschaft) zu übernehmen, während kulturell fremde Werte bewusst abgelehnt werden.
- Quote paper
- Susanne Held (Author), 2010, Die kulturelle Globalisierung der Arabischen Welt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164536