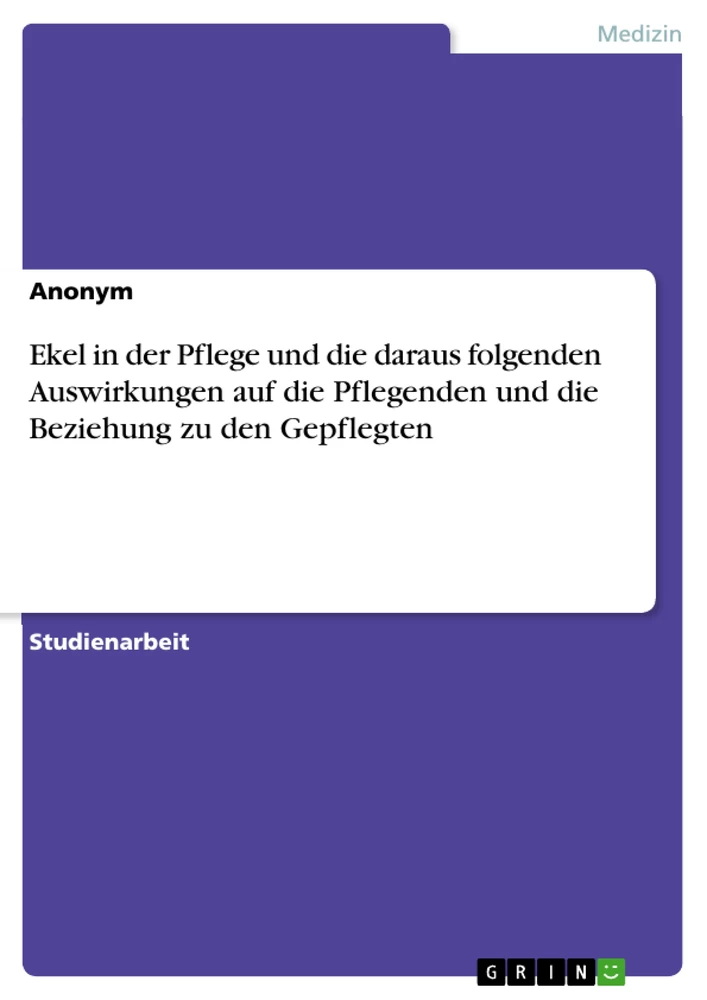Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Beruf, in dem Sie täglich mit Situationen konfrontiert werden, die bei anderen Menschen unweigerlich Ekel auslösen würden. Doch wie gehen Pflegekräfte mit diesem allgegenwärtigen Gefühl um, das tief in unserer Biologie verwurzelt ist, um uns vor Krankheit und Verunreinigung zu schützen? Diese tiefgründige Analyse beleuchtet die oft unausgesprochenen Herausforderungen, denen sich Pflegepersonal im Angesicht von Ekel stellen muss. Von der psychologischen Definition des Ekels als einer der grundlegenden menschlichen Emotionen bis hin zu den konkreten Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten, werden die vielschichtigen Aspekte dieses Tabuthemas im Pflegealltag untersucht. Erfahren Sie, wie der ständige Umgang mit ekelerregenden Situationen die emotionale und psychische Gesundheit der Pflegenden beeinträchtigen kann, und welche Abwehrmechanismen und Kompensationsstrategien entwickelt werden, um mit dieser Belastung umzugehen. Die Auseinandersetzung mit Ekel im Kontext der Pflege wirft wichtige Fragen nach dem Selbstverständnis des Pflegeberufs, der Notwendigkeit offener Kommunikation und der Entwicklung von Strategien zur Bewältigung auf. Es geht um die Anerkennung der menschlichen Grenzen und die Suche nach einem gesunden Umgang mit einer Emotion, die uns alle verbindet. Dieses Werk ist ein Muss für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, sowie für jeden, der sich für die psychologischen und sozialen Dynamiken im Umgang mit Ekel interessiert. Es bietet Denkanstöße für eine respektvollere und achtsamere Gestaltung des Pflegealltags und trägt dazu bei, das Tabu rund um das Thema Ekel zu brechen, um so die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern. Entdecken Sie die Strategien zur Emotionsregulation, die in der Pflege eingesetzt werden, und gewinnen Sie wertvolle Einblicke in die ethischen Dilemmata, die mit der Überwindung von Ekelgefühlen einhergehen. Diese Arbeit regt zur Reflexion über die eigenen Grenzen und die Bedeutung von Empathie und Professionalität in der Pflege an.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Ekel
2.1 Begriffsbestimmung „Ekel“
2.2 Auswirkungen durch das Ekelerlebnis auf das Pflegepersonal
2.3 Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Patient und Pflegenden
3 Umgang mit Ekel im Pflegealltag
3.1 Fragebogenauswertung
3.2 Kompensationsmöglichkeiten
4 Fazit
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Mögliche Reaktion durch dauerhafte Konfrontation mit Ekel
1 Einleitung
Während meiner Tätigkeit als Schülerin in der Gesundheits- und Krankenpflege, stellte ich immer wieder fest, dass das Pflegepersonal täglich mit ekelerregenden Situationen konfrontiert wird. Die betroffene Pflegekraft muss sich öfter als gewollt mit diesen belastenden Situationen auseinandersetzen.
Im Pflegealltag muss sich das Personal durch das sehen, riechen, anfassen oder hören möglichem Ekel stellen. Häufig erlebte ich, wie Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in bestimmten Situationen mimische und gestische Muster der Abneigung zeigten. Sie runzelten die Stirn, hielten sich die Hand vor dem Mund oder versuchten den Kopf zurück zu neigen, um zügig und routiniert ihre Arbeit zu verrichten. Auf Nachfrage, ob sie Ekel empfanden, gab es meist die Aussage, dass man kein Ekel mehr fühle, da man täglich mit diesen Situationen konfrontiert wird. Eine komplette Ignoranz des eigenen Ekelempfindens ist jedoch nicht möglich, auch wenn der ein oder andere Pflegende davon überzeugt ist. Der Körper und Geist hat lediglich im Laufe der Berufsjahre eigene Abwehrmechanismen entwickelt, um diesen temporären Zustand zu überbrücken.
Aufgrund der vielen verschiedenen Bereiche, die ich während meiner Ausbildungszeit durchlaufen durfte, konnte ich viele ekelerregende Situationen wahrnehmen. Im weiteren Verlauf möchte ich Ihnen zwei Auswirkungen des Ekelempfindens darstellen und einige Kompensationsmöglichkeiten auflisten.
2 Ekel
2.1 Begriffsbestimmung „Ekel“
Ekel lässt sich umschreiben als ein Gefühl der Abneigung und wird durch psychischen Widerstand und Abscheu hervorrufen. Aus Psychologischer Sicht ist Ekel eine eigenständige Empfindung. Es ist ein begleitender Widerwillen, verbunden mit körperlicher Übelkeit und einem schlechtem Geschmack im Mund. Im weiteren Sinne wird Ekel aber durch Personen und Werteverletzung hervorgerufen. Ekel wird zu den Affekten gezählt was bedeutet dass es eine kurzfristige starke Emotion ist.[1]
2.2 Auswirkungen durch das Ekelerlebnis auf das Pflegepersonal
Der natürliche Ekel eines jeden Menschen ist genetisch angelegt und bereits in der Kindheit ausgeprägt, um den Körper vor unbekanntem zu schützen. Die Abgewöhnung wäre nicht ratsam, da somit die eigentliche Schutzfunktion nicht mehr gegeben ist. Der falsche Umgang mit Ekelgefühlen kann dazu führen, dass auf Dauer das primäre Ziel der Schutzfunktion nicht erfüllt wird, da der Umgang für den Betroffenen mit einer hohen Stresssituation verbunden ist, die eine psychische Belastung darstellen kann. Ebenso kann das tiefe Bedürfnis, diese Ekelgefühle zu unterdrücken oder abzuwehren zur Verzweiflung und Hilfslosigkeit führen. Jeder Mensch reagiert anders auf Ekel und sollte für sich Möglichkeiten finden den richtigen Umgang mit ekel zu vollziehen. Es können ungewollte Schamgefühle, Abneigung oder Wut gegenüber dem Ekelerregenden oder Verursachendem entstehen.[2]
Da in den meisten Pflegeberufen das Thema Ekel bis heute noch ein Tabuthema ist, versuchen immer mehr Pflegende, sich an das ekelhafte und ekelerregende zu gewöhnen. Ein Gespräch mit außenstehenden Personen, die nicht der gleichen Berufsgruppe angehören, ist scheinbar unmöglich, da der Gedanke des nichtverstehens überwiegt. Viele Pflegende die bereits über Jahre in diesem Beruf arbeiten, sind regelrecht in ihren Tätigkeiten abgehärtet, was in der Beziehung zu einer Überschreitung der Distanzierung zum Patienten führt. Sie sehen diese Situationen als alltäglich an und bereiten sich keine Gedanken über die Überschreitung der Schamgrenze des zu betreuenden Patienten.
[...]
[1] Vgl. Izard (1981), Die Emotionen des Menschen: Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie, S.376.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt das Thema Ekel im Pflegealltag. Er definiert den Begriff "Ekel", untersucht die Auswirkungen von Ekelerlebnissen auf das Pflegepersonal und die Beziehung zwischen Patient und Pflegenden, und erörtert den Umgang mit Ekel sowie mögliche Kompensationsmechanismen.
Wie wird "Ekel" definiert?
Ekel wird als ein Gefühl der Abneigung beschrieben, das durch psychischen Widerstand und Abscheu hervorgerufen wird. Es ist eine eigenständige Empfindung, die oft mit körperlicher Übelkeit und einem schlechten Geschmack im Mund einhergeht. Im weiteren Sinne kann Ekel durch Personen und Werteverletzungen ausgelöst werden. Es wird zu den Affekten gezählt, also kurzfristigen, starken Emotionen.
Welche Auswirkungen hat Ekel auf das Pflegepersonal?
Der Text hebt hervor, dass Ekel eine natürliche Schutzfunktion hat. Ein falscher Umgang mit Ekelgefühlen kann jedoch zu Stress, psychischer Belastung, Verzweiflung und Hilflosigkeit führen. Es können auch Schamgefühle, Abneigung oder Wut entstehen. Oft wird das Thema Ekel im Pflegeberuf tabuisiert, was dazu führt, dass sich Pflegende an ekelhafte Situationen gewöhnen, was wiederum zu einer Überschreitung der Distanzierung zum Patienten führen kann.
Was sind mögliche Kompensationsmöglichkeiten für Ekel im Pflegealltag?
Der Text deutet auf die Existenz von Kompensationsmöglichkeiten hin, die jedoch im vorliegenden Auszug nicht näher erläutert werden. Er erwähnt, dass jeder Mensch anders auf Ekel reagiert und eigene Wege finden sollte, damit umzugehen.
Warum wird Ekel als ein Problem im Pflegealltag dargestellt?
Weil das Pflegepersonal häufig und intensiv mit potenziell ekelerregenden Situationen konfrontiert ist. Die Unterdrückung von Ekelgefühlen oder ein falscher Umgang damit kann langfristig negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Pflegenden und die Qualität der Patientenversorgung haben.
Welche Bereiche deckt das Inhaltsverzeichnis ab?
Das Inhaltsverzeichnis gliedert den Text in die folgenden Hauptbereiche: Einleitung, Ekel (mit Unterpunkten zur Definition und Auswirkungen auf Pflegepersonal und Patientenbeziehung), Umgang mit Ekel im Pflegealltag (mit Fragebogenauswertung und Kompensationsmöglichkeiten) und Fazit.
Gibt es Abbildungen im Text?
Ja, es gibt ein Abbildungsverzeichnis, das eine Abbildung mit dem Titel "Mögliche Reaktion durch dauerhafte Konfrontation mit Ekel" enthält.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2010, Ekel in der Pflege und die daraus folgenden Auswirkungen auf die Pflegenden und die Beziehung zu den Gepflegten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164540