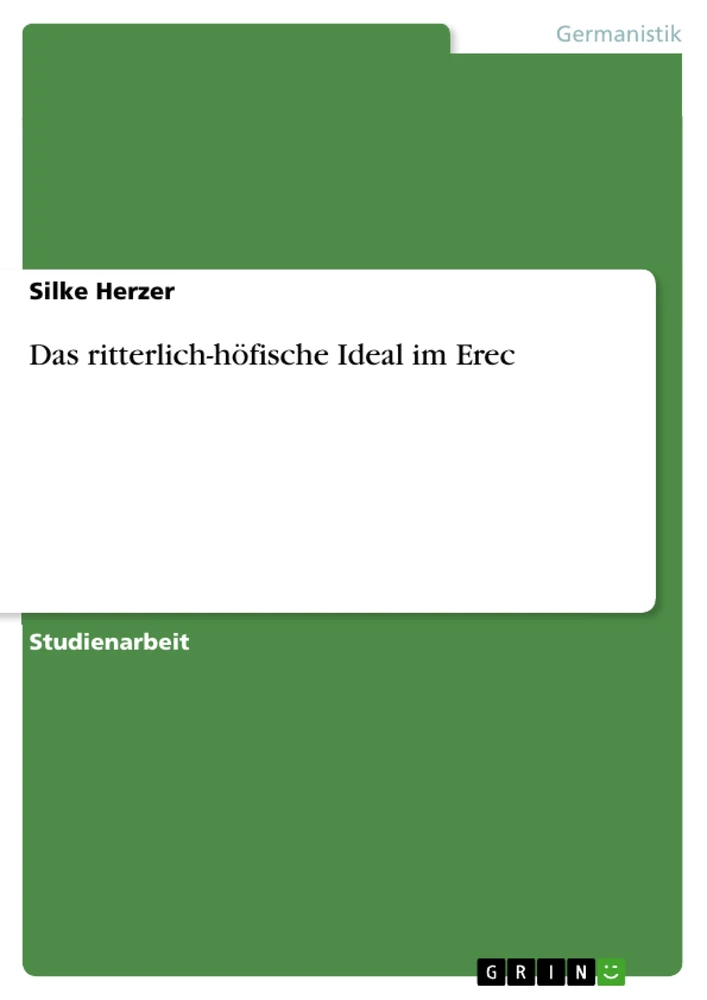Diese Arbeit befasst sich mit dem Rittertum. Es wird der Frage nachgegangen, wer die Ritter waren,
Dies wird, wie in der Forschung üblich, erstens anhand der begrifflichen Entwicklung des Wortfelds „Ritter“ dargestellt und anschließend kulturhistorisch anhand der spätantiken bis mittelalterlichen Fortentwicklung vom Krieger zum Ritter. Anschließend wird dargelegt, wie man als junger Adliger zum Ritter wurde, das heißt welche Ausbildungsschritte man durchlaufen musste, um ein Ritter zu werden. Ein ganzes Kapitel wird den Tugenden der Ritter gewidmet. Insbesondere interessiert hierbei die Frage, was man unter dem höfisch-ritterlichen Ethos versteht. Das Hauptaugenmerk liegt schließlich auf dem höfisch-ritterlichen Ideal in der Literatur des Mittelalters und zwar im Erec.
Anhand von Textausschnitten aus Erec wird das literarische Ritterideal aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Wer waren die Ritter?
- 1. 2 Herleitung des Begriffes
- 1. 2 Entwicklung des Rittertums
- 2. Wie wurde man zum Ritter?
- 3. Was versteht man unter dem höfisch-ritterlichen Ethos?
- 4. Wie zeigt sich der ritterlich-höfische Ethos im Erec?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Rittertum und beleuchtet verschiedene Aspekte, die mit diesem Thema verbunden sind. Der Fokus liegt auf der begrifflichen und historischen Entwicklung des Rittertums sowie der Ausbildung und den Tugenden der Ritter. Darüber hinaus wird analysiert, wie das höfisch-ritterliche Ideal in der Literatur des Mittelalters, insbesondere im Erec, dargestellt wird.
- Entwicklung des Rittertums von der Antike bis zum Mittelalter
- Die Ausbildung zum Ritter und die damit verbundenen Schritte
- Das höfisch-ritterliche Ethos und seine Bedeutung
- Die Darstellung des Ritterideals in der Literatur, insbesondere im Erec
- Die Rolle der Kirche im Wandel des Rittertums
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit vor. Sie beschreibt das Ziel, die Entwicklung des Rittertums zu untersuchen, und beleuchtet die verschiedenen Aspekte, die in der Arbeit behandelt werden. Der Fokus liegt auf der begrifflichen und historischen Entwicklung des Rittertums, der Ausbildung zum Ritter, dem höfisch-ritterlichen Ethos und der Darstellung des Ritterideals in der Literatur.
1. Wer waren die Ritter?
Dieses Kapitel untersucht den Begriff „Ritter“ und seine Entwicklung über die Zeit. Es wird die historische Entwicklung vom Krieger zum Ritter anhand verschiedener Quellen und Forschungen dargestellt. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Begriffs „miles“ und seine Entwicklung im Laufe der Zeit, sowie die Rolle des Adels und der Kirche in diesem Wandel.
1. 2 Herleitung des Begriffes
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die philologische Herleitung des Begriffs „Ritter“ und analysiert die verschiedenen Bedeutungen des Wortes „miles“ und seine Entwicklung vom einfachen Krieger zum Ritter. Es wird die Rolle von Begriffen wie „vassus“, „vasallus“ und „ministerialis“ in der Abgrenzung des Ritterbegriffs erläutert.
1. 2 Entwicklung des Rittertums
Dieser Abschnitt setzt die historische Analyse des Rittertums fort und beleuchtet den Übergang vom Krieger zum Ritter. Es wird die Bedeutung des Lehnswesens und die Rolle der Normannen in diesem Wandel hervorgehoben. Die Kirche wird als maßgeblicher Faktor für die Veränderung des Selbstverständnisses der Ritter im 10. und 11. Jahrhundert betrachtet.
2. Wie wurde man zum Ritter?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Ausbildung zum Ritter und die Schritte, die ein junger Adliger durchlaufen musste, um zum Ritter geweiht zu werden. Es werden die verschiedenen Ausbildungsphasen und Rituale beschrieben, die mit diesem Prozess verbunden waren.
3. Was versteht man unter dem höfisch-ritterlichen Ethos?
In diesem Kapitel wird das höfisch-ritterliche Ethos genauer untersucht. Es werden die Tugenden und Werte, die mit dem Ideal des Ritters verbunden sind, erörtert. Die Rolle der Kirche und des christlichen Leitbildes im Kontext des Rittertums wird beleuchtet.
4. Wie zeigt sich der ritterlich-höfische Ethos im Erec?
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung des Ritterideals in der Literatur, insbesondere im Erec. Anhand von Textausschnitten aus dem Erec werden die literarischen Aspekte des Rittertums und seine Verbindung zum höfisch-ritterlichen Ethos untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Rittertum und konzentriert sich auf die begriffliche und historische Entwicklung des Rittertums, die Ausbildung zum Ritter und das höfisch-ritterliche Ethos. Wichtige Themen sind der Wandel vom Krieger zum Ritter, das Lehnswesen, die Rolle der Kirche, die Tugenden der Ritter und die Darstellung des Ritterideals in der Literatur, insbesondere im Erec. Die Arbeit verwendet Schlüsselbegriffe wie „miles“, „vassus“, „vasallus“, „ministerialis“, „nobles“, „principes“, „miles Christi“, „Lehnwesen“, „Gottesfriedensbewegung“ und „höfisch-ritterliches Ethos“.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich das Rittertum historisch?
Die Entwicklung verlief vom einfachen Krieger der Spätantike zum hochmittelalterlichen Ritter, maßgeblich beeinflusst durch das Lehnswesen und die Kirche.
Welche Ausbildungsschritte durchlief ein Ritter?
Ein junger Adliger begann meist als Page, wurde dann zum Knappen und erhielt schließlich nach jahrelanger Ausbildung die Ritterweihe.
Was ist unter dem höfisch-ritterlichen Ethos zu verstehen?
Es handelt sich um ein Tugendsystem, das Werte wie Beständigkeit, Maßhaltung, Treue und den Schutz der Schwachen (besonders im Sinne des christlichen Ideals) umfasst.
Wie wird das Ritterideal im literarischen Werk „Erec“ gezeigt?
Anhand von Textausschnitten wird dargelegt, wie der Protagonist Erec die ritterlichen Tugenden verkörpert und welche Konflikte zwischen privatem Glück und ritterlicher Pflicht bestehen.
Welche Rolle spielte der Begriff „miles“?
Der lateinische Begriff „miles“ wandelte sich in seiner Bedeutung vom einfachen Soldaten zum edlen Ritter und schließlich zum „miles Christi“ (Ritter Christi).
Welchen Einfluss hatte die Kirche auf die Ritter?
Die Kirche versuchte durch Bewegungen wie den Gottesfrieden, die Gewalt der Krieger zu kanalisieren und ihnen ein christliches Leitbild zu geben.
- Quote paper
- M. A. Silke Herzer (Author), 2010, Das ritterlich-höfische Ideal im Erec, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164567