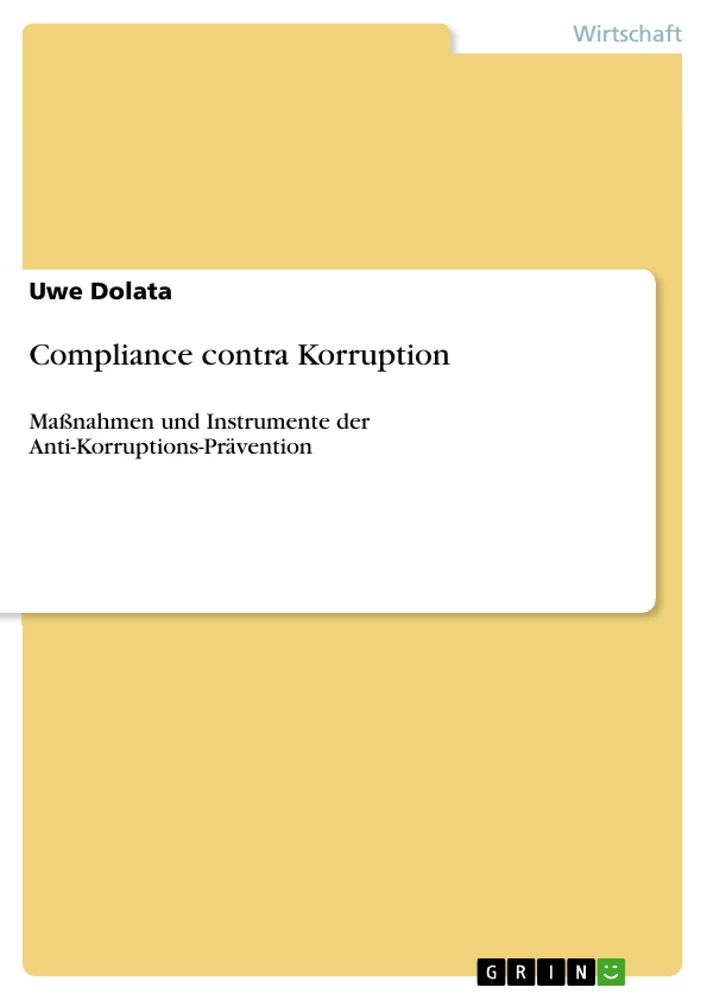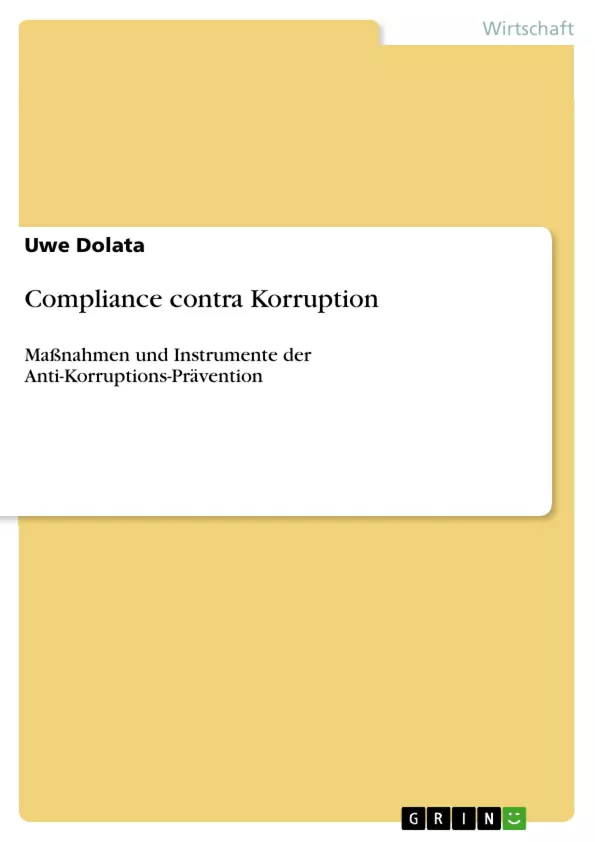Bereits im Vorwort zu dem 2004 von mir herausgegebenen Sammelband „Korruption im Wirtschaftssystem Deutschland“ hat uns Prof. Dr. Hans See, langjähriger Vorsitzender von Business Crime Control (BCC) ins Stammbuch geschrieben: „Es ist ein Fehler, die öffentliche Diskussion so zu führen, als ob nur die Parteien, die Politiker und die Beamten das Problem seien, wie das immer wieder geschieht. Es sollte in der umfassenden ‚Aufklärungsarbeit’ wenigstens klar gemacht werden, dass das Kernproblem der Korruptionspraxis jene Wirtschaftselite ist, die in den demokratiefreien Chefetagen wie Feudalherren regiert und glaubt, sich von den Gesetzen und Vorschriften, von der ‚Überregulierung’, wie sie das nennt, freikaufen zu können.“ Damit hat Hans See erreicht, dass ich meinen Kampf gegen die Korruption vollkommen neu ausrichtete. Somit wird hier nicht auf die Schilderung von Korruptionsfällen und deren oft unerwünschte Anklage eingegangen werden. Auch werde ich nicht auf die überforderten Kriminalpolizeien und Staatanwaltschaften zu sprechen kommen. Auf den Verkauf der absichtlich falsch interpretierten kriminalpolizeilichen Statistiken auf dem Markt der Eitelkeiten innenpolitischer Selbstdarsteller will ich nicht eingehen, und die Diskussion, ob jeder Mensch seinen Preis habe, werde ich nicht entfachen. Vielmehr möchte ich die uns gestellte Hausaufgabe des von mir hochgeschätzten Hans See angehen und fragen, ob wir den Schwerpunkt statt auf die Strafverfolgung auf die ethische Grundausrichtung unserer Manager von Morgen als effektivste Form der Prävention zu legen haben.
Korruption ist derzeit in Deutschland so aktuell wie nie. „Willkommen in der Bakschischrepublik“, „Korruption – Bei neun von zehn Unternehmen werden Sie fündig“ und „Selbstbedienung in DAX-Konzernen – Korruption ist Chefsache“ – solche oder ähnliche Schlagzeilen waren zuletzt häufig in der Presse zu lesen. Vorfälle wie bei BMW, Daimler, Opel, Infineon, IKEA oder Rewe zeigen, dass Korruption in Deutschland – vor allem in der Privatwirtschaft – keinen Ausnahmefall mehr darstellt, sondern längst alltäglich geworden ist. (Dolata 2007)
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Korruption - ein schillerndes Phänomen
- II. Stabilitätsbedingung unternehmerischer Ethik
- III. Compliance als Element der ordnungsgemäßen Verwaltung in Kommunen unter dem vorrangigen Aspekt der Korruptionsprävention
- IV. Inwiefern,,verzichtet der Staat auf die Verfolgung von Kriminalität
- V. Kriminalität - per definitionem
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen der Korruption in Deutschland, insbesondere in der Wirtschaft und in Behörden. Das Ziel ist es, die Ursachen und Auswirkungen von Korruption aufzuzeigen und mögliche Präventionsmaßnahmen zu diskutieren.
- Korruption als ein weitverbreitetes Problem in Deutschland, sowohl in der Wirtschaft als auch in Behörden
- Die Bedeutung von Compliance-Systemen zur Korruptionsprävention
- Die Rolle von ethischem Verhalten in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung
- Die Herausforderungen bei der Bekämpfung von Korruption
- Die Notwendigkeit von umfassender Aufklärungsarbeit und Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Der Autor erläutert seine Motivation für die Beschäftigung mit dem Thema Korruption und stellt seine Positionierung dar.
- I. Korruption - ein schillerndes Phänomen: Dieses Kapitel beleuchtet die Verbreitung und die Auswirkungen von Korruption in Deutschland, insbesondere in der Wirtschaft. Es werden Statistiken und Beispiele aus der Praxis zitiert, um die Problematik zu verdeutlichen.
- II. Stabilitätsbedingung unternehmerischer Ethik: In diesem Kapitel wird die Bedeutung von ethischem Verhalten in der Wirtschaft und die Rolle von Compliance-Systemen zur Korruptionsprävention erörtert.
- III. Compliance als Element der ordnungsgemäßen Verwaltung in Kommunen unter dem vorrangigen Aspekt der Korruptionsprävention: Dieses Kapitel fokussiert auf die Bedeutung von Compliance-Systemen in der öffentlichen Verwaltung und die Bedeutung der Korruptionsprävention in diesem Bereich.
- IV. Inwiefern,,verzichtet der Staat auf die Verfolgung von Kriminalität: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Strafverfolgung von Korruptionsdelikten und die Frage, ob der Staat ausreichend gegen Korruption vorgeht.
Schlüsselwörter
Korruption, Compliance, Wirtschaftskriminalität, ethisches Verhalten, Prävention, Strafverfolgung, Behörden, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung, Dunkelfeldforschung, Compliance-Systeme, Finanzkrise, Geldgier, Bestechlichkeit, Vorteilsannahme.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Korruption im Wirtschaftssystem?
Korruption umfasst den Missbrauch von Macht oder Positionen für private Vorteile, oft durch Bestechung oder Vorteilsnahme in Unternehmen und Behörden.
Was bedeutet "Compliance" in Unternehmen?
Compliance bezeichnet die Einhaltung von Gesetzen, Regeln und ethischen Richtlinien innerhalb einer Organisation zur Vermeidung von Straftaten wie Korruption.
Warum reicht Strafverfolgung allein nicht aus?
Prävention durch ethische Grundausrichtung und funktionierende Kontrollsysteme gilt als effektiver, da die Dunkelziffer bei Korruption sehr hoch ist.
Gibt es Korruption auch in Kommunen und Behörden?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass Compliance-Systeme auch in der öffentlichen Verwaltung wichtig sind, um Manipulationen bei Vergaben oder Genehmigungen zu verhindern.
Welche Rolle spielt die Manager-Ethik?
Die ethische Haltung der Führungsebene ("Tone from the top") ist entscheidend dafür, ob Korruption im Unternehmen geduldet oder konsequent bekämpft wird.
- Citar trabajo
- M. A. Uwe Dolata (Autor), 2011, Compliance contra Korruption, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164700