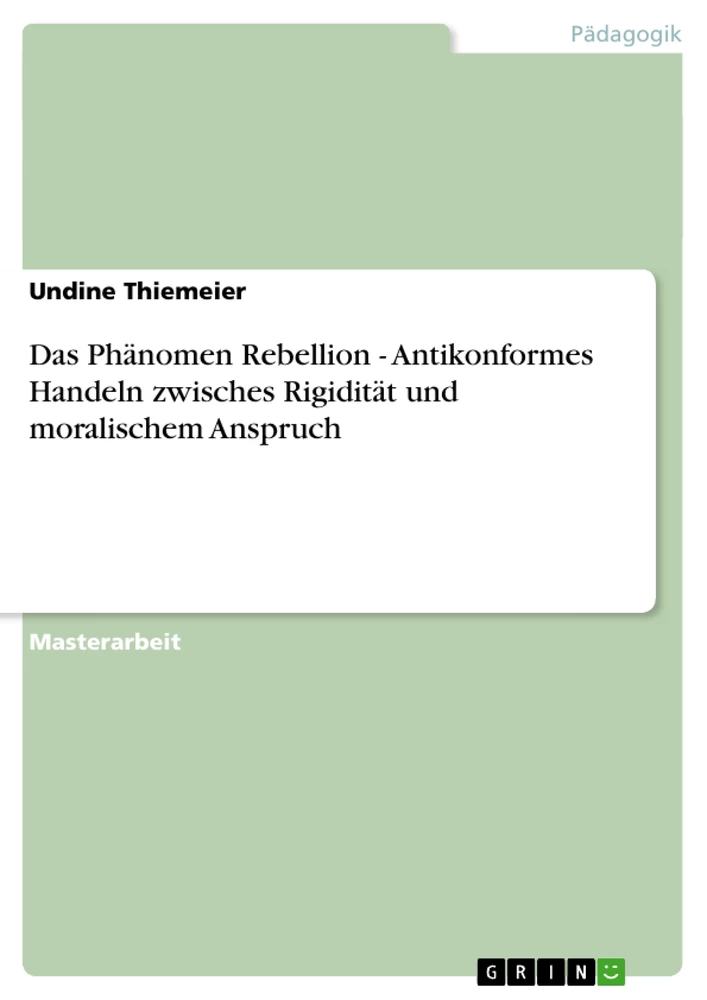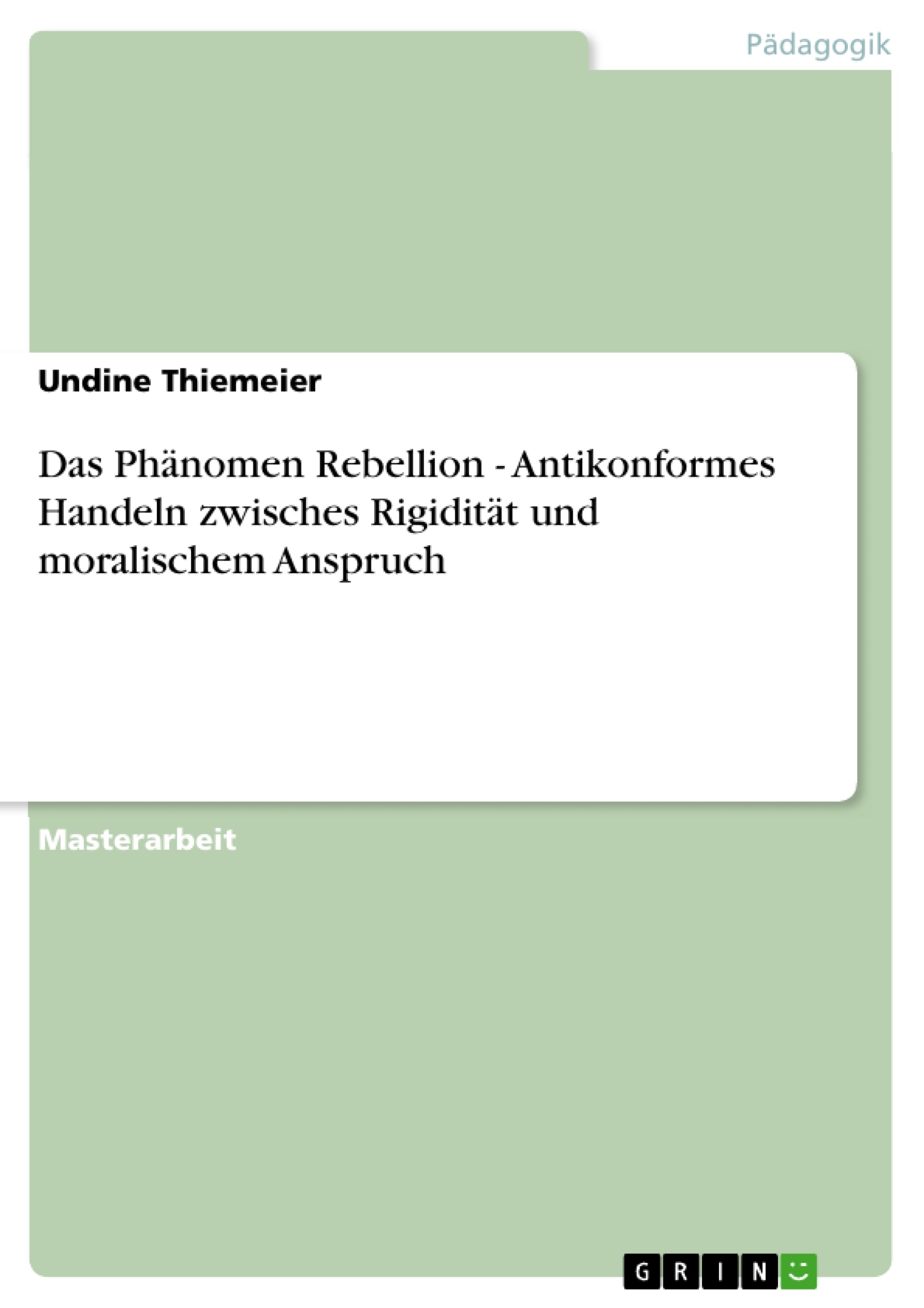„Rebellion“ - eine kurze, prägnante Bezeichnung für ein facettenreiches Phänomen, das seit
Menschengedenken existiert und sich in unterschiedlichsten geschichtlichen Zusammenhängen,
aber ebenso in der heutigen Zeit zeigt. Sie kann zu Denkanstößen, Bewegungen, (bahnbrechenden)
Veränderungen, Fortschritt, Aufmerksamkeit, aber auch zu Belächelung und im
schlimmsten Fall zu Angst und Tod führen.
Sei es auf politischer, moralischer, sozialer, auf familiärer oder kultureller Ebene: Es gibt
immer Individuen, die sich unabhängig von einer durch pubertäre Einflüsse ausgelösten
„Sturm und Drang-Zeit“, im Erwachsenenalter „abgrenzen“. Dies kann eine Abgrenzung von
ihrer unmittelbaren Umwelt sein, wie der Familie oder dem Freundes- und Bekanntenkreis
oder das Auflehnen gegen das vorliegende Denken und Handeln des gesellschaftlichen Gros.
Es ist immer wieder zu beobachten, dass Personen im Alleingang oder zumindest in einer
Minderheit gegen eine große Mehrheit auftreten und dabei rigide ihre Ziele verfolgen. Den
Antrieb hierfür stellt ihre Überzeugung von der Richtigkeit der Sache dar.
In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie es kommt, dass
bestimmte Menschen Persönlichkeitsfacetten besitzen, die sie vehement an ihren Überzeugungen
festhalten und ihnen den Antrieb, die Stärke, Gabe oder Fähigkeit verleihen, sich von
dieser inneren Überzeugung lenken zu lassen, ganz gleich, ob es sich hierbei um anerkannte
oder zumindest geduldete Werte und Normen, ethische Fragen, Verhaltensweisen oder allgemeine
Ansichten handelt, gegen die sie rebellieren. Welche Erklärungsansätze können herangezogen
werden, um nachvollziehbar zu machen, warum diese Individuen sich für ihre
speziellen Ziele, auch unter Inkaufnahme von für sie negative Folgen, einsetzen, während die
Mehrheit im jeweiligen (gesellschaftlichen) Status quo zufrieden oder unzufrieden lebt und
in ihm verharrt bzw. sich mit ihm arrangiert?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- Teil I: Theoretischer Hintergrund
- 2 Das Phänomen „Rebellion“
- 2.1 Inhaltliche Annäherungen an den Begriff „Rebellion“
- 2.2 Rebellion und Aggression: Eine differenzierende Betrachtung
- 2.3 Einflussfaktoren auf das Rebellieren: Handlungsorientierte Instanzen
- 2.3.1 Selbstwert und Selbstwirksamkeit
- 2.3.2 Assimilation und Akkomodation
- 2.3.3 Externalisierendes/internalisierendes Verhalten und Geschlecht
- 3 Frank J. Sulloway: Die Geburtsrangtheorie
- 3.1 Selektive Studien und Analysen zur Geburtenfolge
- 3.2 Die Geburtsrangtheorie Sulloways: Evolutionstheoretischer Hintergrund
- 3.3 Grundzüge der Geburtsrangtheorie
- 3.4 Zusammenhang zwischen Geburtsrang und Rebellion
- 4 Aspekte der Verschiedenartigkeit von Geschwistern - Geburtsrang und Persönlichkeitsentwicklung -
- 4.1 Einzelkind und Erstgeborene(r)
- 4.2 Zweitgeborene(r) / Spätergeborene(r)
- 4.3 Weitere persönlichkeitsformende Prädiktoren
- 4.3.1 Altersabstand
- 4.3.2 Geschlecht
- 4.3.3 Geschwisteranzahl
- 5 Die Bindungstheorie nach John Bowlby
- 5.1 Theoretischer Hintergrund
- 5.2 Grundzüge der Theorie: Regulation des Bindungsverhaltens
- 5.3 Die Baltimore-Studie: Identifizierung von Bindungsmustern
- 5.4 Zusammenhang zwischen Bindungsqualität und Rebellion
- 2 Das Phänomen „Rebellion“
- Teil II: Empirische Analyse
- 6 Methode
- 6.1 Der Fragebogen: Aufbau und Entwicklung
- 6.2 Hintergrund und Zusammensetzung der Stichprobe
- 7 Fragestellung und Untersuchung
- 7.1 Geburtsrang und rebellisches Verhalten
- 7.1.1 Die Hypothese
- 7.1.2 Wichtigste Ergebnisse und Schlussfolgerung
- 7.2 Bindungsqualität und rebellisches Verhalten
- 7.2.1 Die Hypothese
- 7.2.2 Wichtigste Ergebnisse und Schlussfolgerung
- 7.3 Bindungsqualität und Geburtsrang im Zusammenhang mit Rebellion
- 7.4 Erklärungsmodell: Rebellisches Verhalten und Co-Variablen
- 7.4.1 Die Hypothesen
- 7.4.1.1 Co-Variablen und rebellisches Verhalten
- 7.4.1.2 Zusammenhang zwischen den Hauptfaktoren und den Co-Variablen
- 7.4.1.3 Stellung der Co-Variablen
- 7.4.2 Wichtigste Ergebnisse und Schlussfolgerung
- 7.4.1 Die Hypothesen
- 7.1 Geburtsrang und rebellisches Verhalten
- 8 Diskussion
- 6 Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Phänomen der Rebellion, indem sie verschiedene theoretische Ansätze und empirische Daten analysiert. Ziel ist es, die komplexen Faktoren zu identifizieren, die rebellisches Verhalten beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Rebellion“
- Einfluss von Geburtsrang und Persönlichkeitsentwicklung auf rebellisches Verhalten
- Der Zusammenhang zwischen Bindungstheorie und Rebellion
- Empirische Untersuchung der Hypothese zum Einfluss von Geburtsrang und Bindungsqualität auf rebellisches Verhalten
- Entwicklung eines Erklärungsmodells für rebellisches Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rebellion ein und beschreibt den Forschungsstand. Sie skizziert die Zielsetzung der Arbeit und die gewählte Methodik. Die Autorin begründet die Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage vor, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden soll. Die Einleitung liefert einen Überblick über die Struktur der Arbeit und leitet zum theoretischen Teil über.
2 Das Phänomen „Rebellion“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff „Rebellion“ und grenzt ihn von ähnlichen Konzepten, wie beispielsweise Aggression, ab. Verschiedene inhaltliche Annäherungen an den Begriff werden präsentiert und diskutiert, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen. Es werden wichtige Einflussfaktoren auf rebellisches Handeln, wie Selbstwert, Selbstwirksamkeit und Assimilation/Akkomodation, eingeführt und deren Relevanz im Kontext von Rebellion herausgestellt. Unterschiede im externalisierenden und internalisierenden Verhalten in Abhängigkeit vom Geschlecht werden ebenfalls beleuchtet.
3 Frank J. Sulloway: Die Geburtsrangtheorie: Dieses Kapitel stellt die Geburtsrangtheorie von Frank J. Sulloway vor. Es werden die evolutionstheoretischen Grundlagen der Theorie erklärt und die zentralen Annahmen erläutert. Der Zusammenhang zwischen Geburtsrang und rebellischem Verhalten wird im Detail dargestellt, inklusive der selektiven Studien und Analysen zur Geburtenfolge, die Sulloways Theorie untermauern sollen. Die Kapitel erläutert die Grundzüge der Theorie und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen bezüglich des Einflusses der Geschwisterposition auf die Persönlichkeitsentwicklung.
4 Aspekte der Verschiedenartigkeit von Geschwistern - Geburtsrang und Persönlichkeitsentwicklung -: Dieses Kapitel vertieft die Betrachtung der Persönlichkeitsentwicklung im Kontext des Geburtsranges. Es werden die Unterschiede zwischen Einzelkindern, Erstgeborenen, Zweitgeborenen und später Geborenen detailliert analysiert. Zusätzliche Einflussfaktoren wie Altersabstand zwischen den Geschwistern, Geschlecht und Geschwisteranzahl werden berücksichtigt und ihre Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung und damit auf potenziell rebellisches Verhalten diskutiert.
5 Die Bindungstheorie nach John Bowlby: Dieses Kapitel widmet sich der Bindungstheorie von John Bowlby. Der theoretische Hintergrund der Bindungstheorie wird erläutert und die Grundzüge der Theorie, insbesondere die Regulation des Bindungsverhaltens, werden dargestellt. Die Baltimore-Studie zur Identifizierung verschiedener Bindungsmuster wird detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen der Qualität der frühen Bindungserfahrungen und der Wahrscheinlichkeit rebellischen Verhaltens im späteren Leben.
6 Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert den Aufbau und die Entwicklung des verwendeten Fragebogens und gibt detaillierte Auskunft über die Stichprobe, ihre Zusammensetzung und die Auswahlkriterien. Die statistischen Methoden, die zur Auswertung der Daten verwendet werden, werden ebenfalls vorgestellt.
7 Fragestellung und Untersuchung: In diesem Kapitel werden die Forschungsfragen und Hypothesen der Studie vorgestellt und die Ergebnisse der empirischen Analyse präsentiert. Die Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Geburtsrang und rebellischem Verhalten, sowie den Zusammenhang zwischen Bindungsqualität und rebellischem Verhalten. Der Einfluss von Co-Variablen auf das rebellische Verhalten wird ebenfalls untersucht, und ein Erklärungsmodell entwickelt, welches die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Faktoren aufzeigt.
Schlüsselwörter
Rebellion, Antikonformes Handeln, Geburtsrang, Bindungstheorie, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Aggression, Empirische Forschung, Fragebogen, Varianzanalyse, Co-Variablen, Erklärungsmodell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Rebellion – Einfluss von Geburtsrang und Bindungsqualität
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss von Geburtsrang und Bindungsqualität auf rebellisches Verhalten. Sie analysiert theoretische Ansätze (Geburtsrangtheorie nach Sulloway, Bindungstheorie nach Bowlby) und untersucht diese empirisch mittels eines Fragebogens.
Welche theoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf zwei Haupttheorien: Die Geburtsrangtheorie von Frank J. Sulloway, welche den Zusammenhang zwischen Geburtsposition und Persönlichkeitsmerkmalen, inklusive der Neigung zu rebellischem Verhalten, beleuchtet, und die Bindungstheorie von John Bowlby, die den Einfluss früher Bindungserfahrungen auf die spätere Persönlichkeitsentwicklung und das Verhalten untersucht.
Wie wird der Begriff „Rebellion“ definiert?
Das Kapitel „Das Phänomen ‚Rebellion’“ befasst sich ausführlich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs „Rebellion“ von ähnlichen Konzepten wie Aggression. Es werden verschiedene inhaltliche Annäherungen präsentiert und diskutiert.
Welche Rolle spielen Einflussfaktoren wie Selbstwert und Selbstwirksamkeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Assimilation und Akkomodation auf rebellisches Verhalten. Diese Faktoren werden im Kontext der theoretischen Ansätze und der empirischen Ergebnisse analysiert.
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut?
Die empirische Untersuchung basiert auf einem eigens entwickelten Fragebogen. Das Kapitel „Methode“ beschreibt detailliert den Aufbau und die Entwicklung des Fragebogens sowie die Zusammensetzung und Auswahl der Stichprobe. Die Ergebnisse werden mithilfe statistischer Methoden ausgewertet.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit testet Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Geburtsrang und rebellischem Verhalten, Bindungsqualität und rebellischem Verhalten, sowie dem Zusammenspiel von Geburtsrang, Bindungsqualität und weiteren Einflussfaktoren (Co-Variablen) auf rebellisches Verhalten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel „Fragestellung und Untersuchung“ präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse. Es werden die Zusammenhänge zwischen Geburtsrang, Bindungsqualität und rebellischem Verhalten dargestellt und ein Erklärungsmodell für rebellisches Verhalten entwickelt.
Welche Co-Variablen werden berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Co-Variablen auf rebellisches Verhalten und deren Zusammenhang mit den Hauptfaktoren Geburtsrang und Bindungsqualität. Diese Co-Variablen werden im Erklärungsmodell berücksichtigt.
Wie wird das Erklärungsmodell für rebellisches Verhalten aufgebaut?
Die Arbeit entwickelt ein Erklärungsmodell, welches die Zusammenhänge zwischen Geburtsrang, Bindungsqualität, den Co-Variablen und rebellischem Verhalten darstellt und versucht, das rebellische Verhalten umfassender zu erklären.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rebellion, Antikonformes Handeln, Geburtsrang, Bindungstheorie, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Aggression, Empirische Forschung, Fragebogen, Varianzanalyse, Co-Variablen, Erklärungsmodell.
- Quote paper
- Undine Thiemeier (Author), 2011, Das Phänomen Rebellion - Antikonformes Handeln zwisches Rigidität und moralischem Anspruch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164819