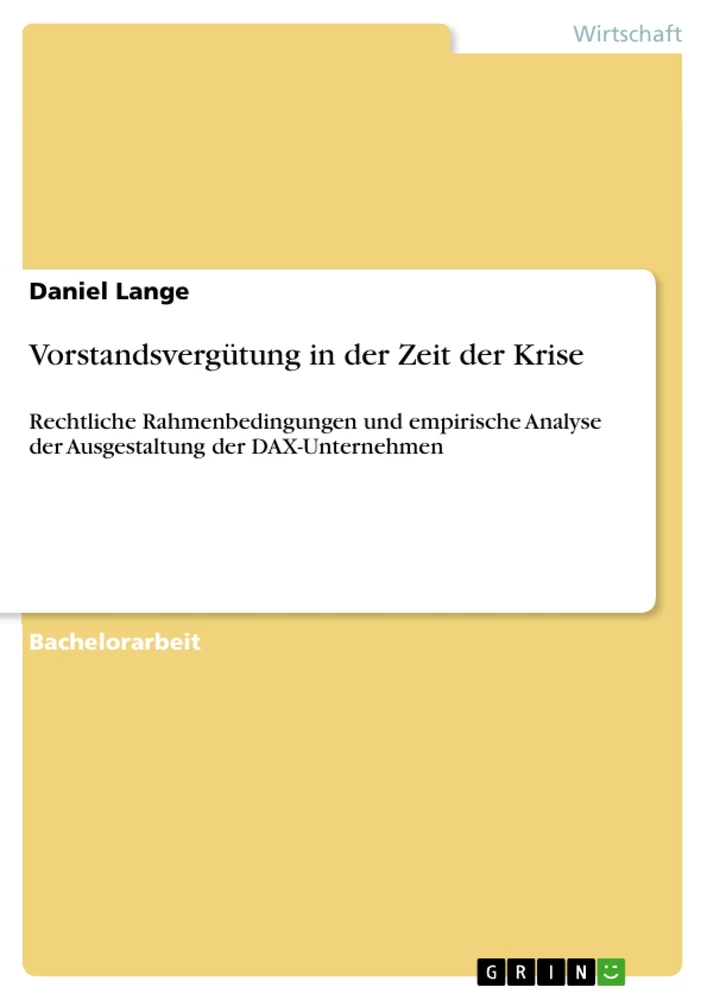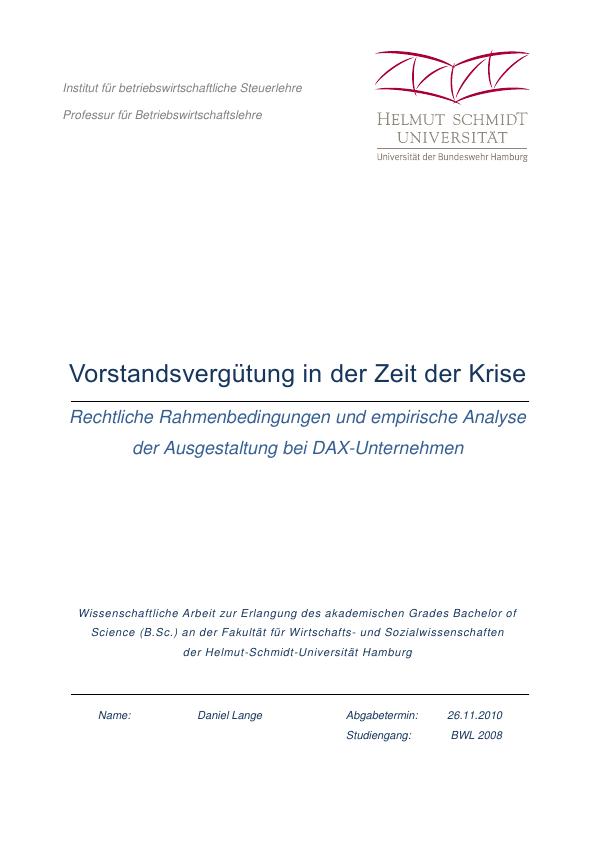„Die Veröffentlichung meines Gehalts würde die Republik nicht verkraften.“
Dieser Satz aus dem Jahr 2007 von Wendelin Wiedeking, damaliger Vorstandsvorsitzender von Porsche, zeigt, wie intensiv und emotional die öffentliche Debatte über Managergehälter und deren Veröffentlichung geführt wurde. In Deutschland ist die Höhe des Gehaltes im Allgemeinen eine höchstpersönliche und schutzwürdige Angelegenheit, in der gerade Führungskräfte mit hohen Gehältern kein Interesse an einer Offenlegung ihrer Bezüge haben. Doch insbesondere vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise, die die Diskussion weiter anheizte, empfinden viele Menschen die Höhe der Vergütung angesichts staatlicher Stützungsmaßnahmen, von Stellenabbau und Insolvenzen teilweise als überhöht.
Auf diese Problematik hat der Gesetzgeber, fast zeitgleich mit entsprechenden Empfehlungen der Europäischen Kommission , reagiert und das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütungen verabschiedet, das am 05.08.2009 in Kraft getreten ist.
Dabei ist dieses Gesetz nur das jüngste von mehreren Regelwerken, die in den letzten Jahren erlassen wurden, um einen aktien- und handelsrechtlichen Rahmen für eine angemessene Vergütung von Vorständen zu gewährleisten. Dabei galt es, die Balance zwischen den unternehmensinternen Entscheidungen zur Vergütung, die auf dem Prinzip der Vertragsautonomie beruhen, und rechtlichen Vorgaben zum Schutz vor negativen Verhaltensanreizen zu finden.
Die aktuellen Entwicklungen und die emotional geführte öffentliche Diskussion ist Grund genug, die derzeitige Rechtslage und ihre praktische Umsetzung näher zu untersuchen.
Zunächst werden dazu grundsätzliche Aspekte der Vorstandstätigkeit und zur Vergütungskompetenz beleuchtet. Danach wird auf die umfangreichen rechtlichen Vorgaben zur Höhe und Struktur eingegangen, die sich besonders durch das VorstAG verändert haben. Ferner werden die verschiedenen Offenlegungspflichten näher betrachtet. Abschließend wird die praktische Ausgestaltung der Vorstandsvergütungen anhand der DAX-Unternehmen für die vergangenen Jahre empirisch untersucht.
Ziel dieser Arbeit ist es dabei, die in der Praxis angewendete Ausgestaltung der Vergütungen des Vorstands zu analysieren und die rechtlichen Anforderungen nach den jüngsten Änderungen kritisch zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Vorstandsvergütung
- 3. Die Kompetenz der Vergütungsregelung
- 3.1 Beschluss des Aufsichtsrats
- 3.2 Herabsetzung der Vergütung
- 3.3 Beschluss der Hauptversammlung über das Vergütungssystem
- 4. Ausgestaltung des Vergütungssystems
- 4.1 Angemessenheit der Vergütung
- 4.1.1 Aufgaben des Vorstandsmitglieds
- 4.1.2 Leistungen des Vorstandsmitglieds
- 4.1.3 Lage der Gesellschaft
- 4.1.4 Üblichkeit der Vergütung
- 4.2 Struktur der Vergütung
- 4.2.1 Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung
- 4.2.2 Mehrjährige Bemessungsgrundlage für variable Vergütungen
- 4.1 Angemessenheit der Vergütung
- 5. Der weitere rechtliche Rahmen
- 5.1 Deutscher Corporate Governance Kodex
- 5.2 Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz
- 6. Publizitätspflichten
- 6.1 Publizitätspflichten nach HGB
- 6.2 Konkretisierungen des DRS 17
- 6.3 Publizitätspflichten nach IFRS
- 7. Praktische Ausgestaltung
- 7.1 Grundgesamtheit
- 7.2 Aspekte der Publizität
- 7.3 Höhe der Vergütung
- 7.4 Struktur der Vergütung
- 7.5 Parameter der variablen Vergütung
- 7.6 Vergütungen im Zeitreihenvergleich
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Vorstandsvergütung im Kontext der Finanzkrise. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen und die empirische Ausgestaltung der Vergütungssysteme bei DAX-Unternehmen.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Vorstandsvergütung
- Kompetenz der Vergütungsregelung
- Ausgestaltung des Vergütungssystems
- Publizitätspflichten im Bereich der Vorstandsvergütung
- Empirische Analyse der Vorstandsvergütung bei DAX-Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Vorstandsvergütung ein und skizziert die Problemstellungen, die im Kontext der Finanzkrise entstanden sind. Kapitel 2 legt die Grundlagen der Vorstandsvergütung dar und beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Bestimmung der Vergütung. Kapitel 3 untersucht die Kompetenz der Vergütungsregelung. Dabei werden die Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats, die Herabsetzung der Vergütung und die Rolle der Hauptversammlung in der Festlegung des Vergütungssystems beleuchtet. Kapitel 4 analysiert die Ausgestaltung des Vergütungssystems. Hierbei werden sowohl die Angemessenheit der Vergütung als auch die Struktur der Vergütung unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung und der mehrjährigen Bemessungsgrundlage für variable Vergütungen betrachtet. Kapitel 5 befasst sich mit dem weiteren rechtlichen Rahmen der Vorstandsvergütung, insbesondere mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex und dem Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz. Kapitel 6 untersucht die Publizitätspflichten im Bereich der Vorstandsvergütung, sowohl nach dem Handelsgesetzbuch als auch nach den International Financial Reporting Standards. Kapitel 7 analysiert die praktische Ausgestaltung der Vorstandsvergütung anhand einer Stichprobe von DAX-Unternehmen. Die Analyse umfasst die Höhe der Vergütung, die Struktur der Vergütung, die Parameter der variablen Vergütung sowie Vergütungen im Zeitreihenvergleich. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Vorstandsvergütung, Finanzkrise, DAX-Unternehmen, rechtliche Rahmenbedingungen, Corporate Governance, Publizitätspflichten, empirische Analyse, Nachhaltigkeit, variable Vergütung, Aufsichtsrat, Hauptversammlung, Angemessenheit, Struktur, Deutscher Corporate Governance Kodex, Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz, Handelsgesetzbuch, International Financial Reporting Standards.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Rechtslage zur Vorstandsvergütung seit 2009 verändert?
Mit dem Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) vom 05.08.2009 wurden strengere Vorgaben für die Struktur und Höhe der Bezüge sowie zur Nachhaltigkeit der Unternehmensführung eingeführt.
Was bedeutet "Angemessenheit" bei der Vorstandsvergütung?
Die Angemessenheit richtet sich nach den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds, der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie der Üblichkeit der Vergütung im Vergleichsumfeld.
Welche Rolle spielt die Hauptversammlung bei der Vergütung?
Die Hauptversammlung hat durch neuere Regelungen die Möglichkeit erhalten, über das Vergütungssystem des Vorstands zu beschließen, was die Mitspracherechte der Aktionäre stärkt.
Welche Publizitätspflichten bestehen für Managergehälter?
Unternehmen müssen die Bezüge ihrer Vorstände gemäß HGB, DRS 17 und IFRS offenlegen, um Transparenz für Investoren und die Öffentlichkeit zu schaffen.
Wie sieht die Vergütungsstruktur bei DAX-Unternehmen in der Praxis aus?
Die Arbeit untersucht empirisch die Höhe, die variablen Parameter und die zeitliche Entwicklung der Vergütungen bei DAX-Unternehmen unter Berücksichtigung der Finanzkrise.
- Arbeit zitieren
- Daniel Lange (Autor:in), 2010, Vorstandsvergütung in der Zeit der Krise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164868