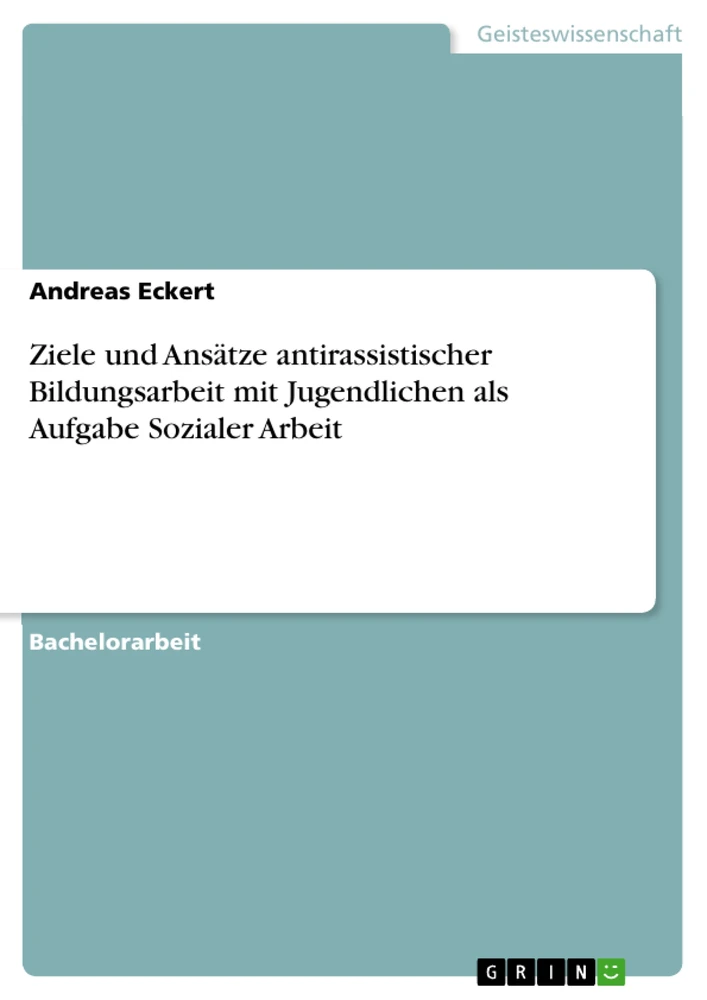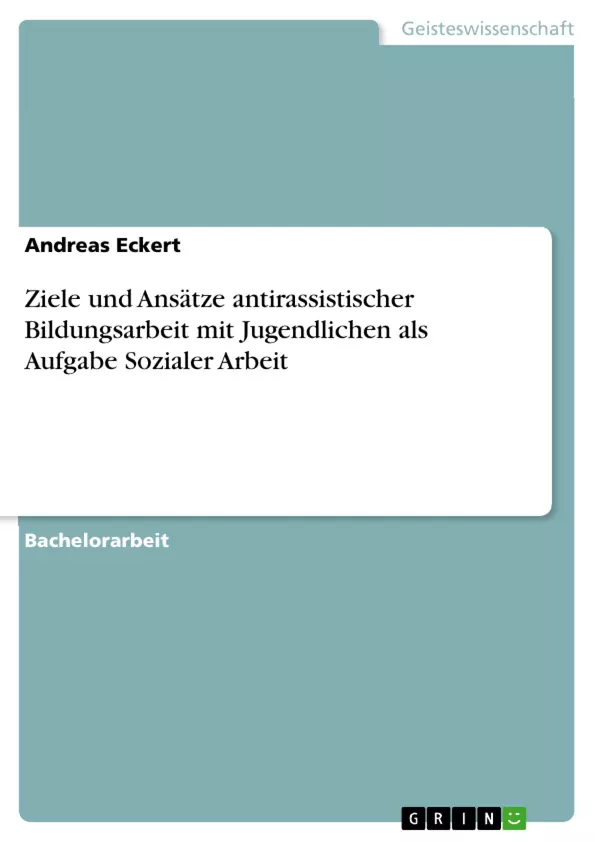In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden, wo die verschiedenen Konzepte der antirassistischen Bildungsarbeit ansetzen und wie wirksam diese sind. Außerdem will ich der Frage nachgehen, wozu es notwendig ist, dass gerade SozialarbeiterInnen politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen betreiben sollten.
Im zweiten Kapitel werde ich grundlegende Begriffe und Konzepte klären. Darauf folgt eine genaue Beschreibung der Schlüsselkompetenzen Sozialer Arbeit und ihrer Aufgabenbereiche. Es schließt eine Darstellung des Begriffs der Politischen Bildungsarbeit. Außerdem werde ich die Aufgabe und didaktische Konzeptionen der politischen Bildungsarbeit darlegen. Als ein Feld der Politischen Bildungsarbeit, wird auch die antirassistische Bildungsarbeit genauer erläutert, außerdem sollen in diesem Kontext auch die Begriffe Rassismus und Rechtextremismus genauer beleuchtet werden.
In Kapitel drei folgt die Begründung der antirassistischen Bildungsarbeit als Aufgabe sozialer Arbeit. Zunächst werde ich die rechtliche Situation darstellen und dann auf die gesellschaftlichen Hintergründe eingehen. Hierzu werden aktuelle Studien zum Rechtsextremismus dargestellt.
In Kapitel vier werde ich einen Überblick über bestehende Programme gegen Rechtsradikalismus geben und danach exemplarisch die Gedenkstättenpädagogik näher beschreiben und vorstellen.
Danach folgt in Kapitel fünf nach einem kurzen historischen Überblick über die Geschichte Ravensbrücks und seine Besonderheiten, die Beschreibung von zwei in Ravensbrück stattgefundenen Projekte.
In Kapitel sechs werden die Ergebnisse einer Evaluation beider Projekte dargestellt und mit den Zielstellungen bestehender Programme gegen Rechtsextremismus verglichen.
Am Schluss folgt in Kapitel sieben ein Resümee der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Jugendliche
- Soziale Arbeit
- Antirassistische Bildungsarbeit als Aufgabe Sozialer Arbeit
- Rechtliches
- Theoretische und gesellschaftliche Gründe zur Notwendigkeit der Auseinandersetzung von Jugendlichen mit den Themen Shoah und Rassismus
- Empirische Befunde zum Rechtsextremismus
- Programme und Methoden politischer Bildungsarbeit
- Überblick über bestehende Programme gegen Rechtsextremismus
- Gedenkstättenpädagogik
- Ravensbrück
- Exkursion
- Gedenkstättenarbeit
- Museumsbesuch
- Stadtführung
- Arbeit mit schriftlichen Quellen
- Fotoführung
- Evaluation
- Exkursion Ravensbrück
- Workcamp Ravensbrück
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von antirassistischer Bildungsarbeit im Kontext der Sozialen Arbeit, insbesondere mit der Frage, wie Jugendliche mit den Themen Shoah und Rassismus auseinandergesetzt werden können.
- Die Bedeutung von antirassistischer Bildungsarbeit im Kontext von Rechtsextremismus
- Der rechtliche Rahmen und die gesellschaftlichen Hintergründe für antirassistische Bildungsarbeit
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der politischen Bildungsarbeit, insbesondere im Bereich der antirassistischen Bildungsarbeit
- Programme und Methoden der Gedenkstättenpädagogik als Instrument der politischen Bildungsarbeit
- Evaluation von Bildungsprojekten im Kontext der Gedenkstättenpädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der antirassistischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen ein und erläutert die Relevanz des Themas mit einem Zitat von Elie Wiesel. Die Arbeit beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau.
Das zweite Kapitel behandelt grundlegende Begriffe wie Jugendliche, Soziale Arbeit und Politische Bildungsarbeit. Die Definitionen und Aufgabenbereiche werden erläutert.
Kapitel drei widmet sich der Begründung der antirassistischen Bildungsarbeit als Aufgabe der Sozialen Arbeit. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die gesellschaftlichen Gründe, insbesondere der Rechtsextremismus, behandelt.
Kapitel vier bietet einen Überblick über bestehende Programme gegen Rechtsextremismus und erläutert die Gedenkstättenpädagogik als beispielhafte Methode.
Kapitel fünf stellt die Geschichte des ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück vor und beschreibt zwei Projekte, die dort durchgeführt wurden.
Kapitel sechs präsentiert die Ergebnisse der Evaluation der beiden Projekte und vergleicht diese mit den Zielen bestehender Programme gegen Rechtsextremismus.
Schlüsselwörter
Antirassistische Bildungsarbeit, Politische Bildungsarbeit, Rechtsextremismus, Shoah, Jugendliche, Soziale Arbeit, Gedenkstättenpädagogik, Ravensbrück, Evaluation.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist antirassistische Bildungsarbeit Aufgabe der Sozialen Arbeit?
Sozialarbeiter haben den Auftrag, politische Bildung zu leisten, um demokratische Werte zu stärken und Jugendlichen den Umgang mit Themen wie Rassismus und Shoah zu ermöglichen.
Was versteht man unter Gedenkstättenpädagogik?
Es ist ein Teilfeld der politischen Bildung, das an historischen Orten (wie Ravensbrück) durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte Empathie und kritisches Bewusstsein fördert.
Welche Projekte wurden in Ravensbrück durchgeführt?
Die Arbeit evaluiert eine Exkursion und ein Workcamp, bei denen Jugendliche durch Quellenarbeit, Fotoführungen und Museumsbesuche lernten.
Wie wirksam sind Programme gegen Rechtsextremismus?
Die Evaluation der Projekte zeigt, inwieweit die Zielstellungen – wie Vorurteilsabbau und historische Sensibilisierung – bei den Jugendlichen erreicht wurden.
Welche Rolle spielt die Shoah in der Bildungsarbeit?
Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust dient als theoretischer und gesellschaftlicher Grundpfeiler, um die Folgen von extremem Rassismus begreifbar zu machen.
- Quote paper
- Andreas Eckert (Author), 2010, Ziele und Ansätze antirassistischer Bildungsarbeit mit Jugendlichen als Aufgabe Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164879