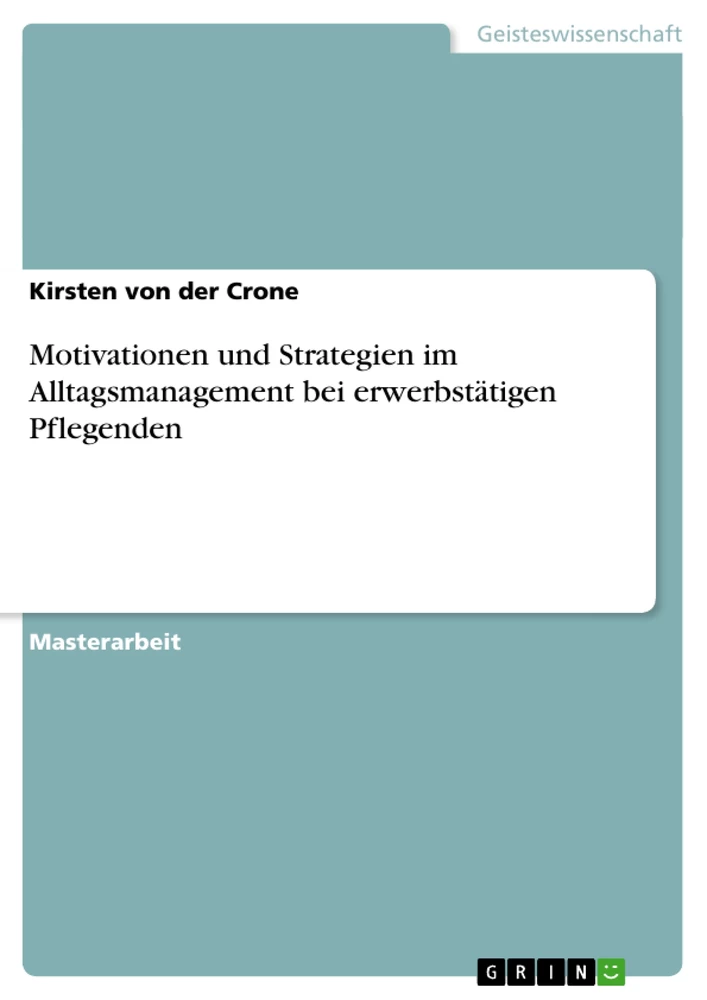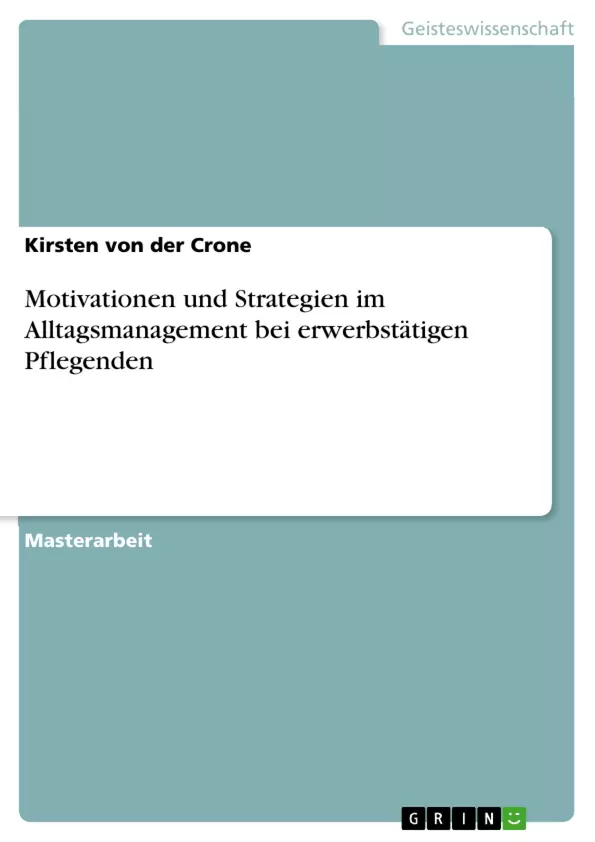Der Fokus dieser Thesis lag auf der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienpflege, da die
meisten Pflegeleistungen durch das Soziale Netzwerk von Familienmitgliedern erbracht wird
und sich eine zunehmende Erwerbstätigkeit der Hauptpflegepersonen abzeichnet. Sechs Interview-
partner einer ländlichen Region (Märkischer Kreis, Sauerland, NRW) und sechs Interview-
partner einer Großstadt (Essen, NRW) waren rekrutiert und anhand von qualitativen Interviews
einer leitfadengestützten empirischen Untersuchung unterzogen worden. Dabei konzentrierten
sich die zentralen Fragestellungen vor dem Hintergrund eines Stadt-Land-Vergleichs auf die
Motive und Strategien im Alltagsmanagement erwerbstätiger Pflegender. Motive wurden auf
Grundlage der umfangreichen theoretischen Basis zum prosozialen Verhalten untersucht. Es wurden drei Rahmenmotive (häusliches Versorgungsideal, Beziehung des Pflegenden zum Pfle-
gebedürftigen, prosoziale vs. materielle Austauschbeziehung) und fünf Kernmotive (Schuld-
gefühle, Verpflichtung vs. persönlicher Anspruch, Anerkennung durch den Pflegebedürftigen,
Anerkennung durch Nachbarn oder soziales Umfeld und Religiosität bzw. Spiritualität) identi-
fiziert. Es wird postuliert, dass die meisten der Motive polar strukturiert sind (als Beispiel sei das
Antipodenpaar „Eigenideal vs. Fremdideal“ für das häusliche Versorgungsideal gennannt). Auf
dieser polaren Motiv-Matrix unterschieden sich erwerbstätige Pflegende aus Stadt und Land am
eindeutigsten in den Motiven „prosoziale vs. materielle Austauschbeziehung“ und „Verpflichtung
vs. persönlicher Anspruch“; damit wurde die eingangs formulierte Hypothese verifiziert, nach
der unterschiedlich restriktive soziale Milieus in Stadt und Land sich als unterschiedlichen Moti-
vationen der Pflegenden für ihr Engagement in häuslichen Pflegearrangements abbilden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Übersicht
- 1.1 Ausgangsaspekt I: Zunahme der Pflegebedürftigkeit
- 1.2 Ausgangsaspekt II: Zunahme der Erwerbstätigkeit
- 1.3 Einleitende Begriffserläuterungen für den Gesamtkontext dieser Arbeit
- 2. Zentrale Fragestellungen
- 2.1 Methodik (Forschungsprozess)
- 2.1.1 Zugang zum Feld und Dokumentation_
- 2.1.1.1 Persönliche Kontaktaufnahme mit Vertretern der Gesundheitsberufe
- 2.1.1.2 Persönliche Kontaktaufnahme mit zielgruppenorientierten Beratungsstellen
- 2.1.1.3 Ein Aufruf über die regionale Presse
- 2.1.2 Einschlusskriterien der Stichprobe
- 2.1.3 Datenerhebung_
- 2.1.4 Datenanalyse
- 2.2 Kurzportraits der Interview-Partner
- 2.2.1 Interview-Partner der ländlichen Region (Märkischer Kreis)
- 2.2.2 Interview-Partner der städtischen Region (Stadt Essen)
- 2.3 Übersicht der Stichprobe
- 2.4 Kritik am Studiendesign
- 3. Motive
- 3.1 Ein theoretischer Überbau
- 3.1.1 Was sind Motiv und Motivation?
- 3.1.2 Vorbetrachtung
- 3.1.3 Prosoziales Verhalten
- 3.1.3.1 Prosoziales Verhalten ist biologisch angelegt
- 3.1.3.2 Prosoziales Verhalten ist kulturelle Norm
- 3.1.3.3 Philosophische Schulen - oder: Was ist moralisches Verhalten?
- 3.1.3.4 Spiritualität: Prosoziales Verhalten als moralischer Imperativ
- 3.1.3.5 Prosoziales Verhalten in den Sozialwissenschaften
- 3.1.3.5.1 Auslöser der wissenschaftlichen Untersuchung prosozialer Aktivität
- 3.2 Motivationen im Alltagsmanagement erwerbstätiger Pflegender
- 3.2.1 Das Hineinwachsen in die Situation der Pflegeübernahme
- 3.2.2 Rahmenmotiv 1: Realisierung des häuslichen Versorgungsideals
- 3.2.2.1 Das prosoziale Konzept
- 3.2.3 Rahmenmotiv 2: Die Beziehung zwischen Pflegendem und Pflegebedürftigem_
- 3.2.4 Rahmenmotiv 3A: Die prosoziale Austauschbeziehung
- 3.2.4.1 Das Gerechtigkeitskonzept
- 3.2.5 Rahmenmotiv 3B: Die materielle Austauschbeziehung_
- 3.2.5.1 Finanzieller Austausch
- 3.2.5.2 Das sekundäre materielle Motiv
- 3.2.5.2.1 Pragmatische ländliche Sicherungsorientierung_
- 3.2.6 Kernmotiv 1: Schuldgefühle als Antrieb
- 3.2.7 Kernmotiv 2A: Das Pflicht-Motiv
- 3.2.8 Kernmotiv 2B: Persönlicher Anspruch
- 3.2.9 Kernmotiv 3: Anerkennung durch den Pflegebedürftigen
- 3.2.9.1 Die Macht der positiven Verstärkung
- 3.2.10 Kernmotiv 4: Anerkennung durch Nachbarn und soziales Umfeld
- 3.2.10.1 Der Drang zur sozialen Anpassung
- 3.2.11 Kernmotiv 5: Das religiös-spirituelle Motiv
- 3.2.11.1 Ein prosozialer Typus
- 3.3 Zur Polarität der Motive
- 3.3.1 Übersicht
- 3.3.2 Polarität der Motive im Stadt-Land-Vergleich
- 3.4 Prosoziales Verhalten: Ein kurzer Gechlechtervergleich_
- 3.5 Kritische Reflektion: Zur Generalisierbarkeit der Ergebnisse_
- 3.6 Ein Wort zum Schluss
- 4. Strategien
- 4.1 Ein theoretischer Überbau
- 4.1.1 Was ist eine Strategie?_
- 4.1.2 Vorbetrachtung
- 4.1.3 Strategien im Alltagsmanagement
- 4.2 Strategietypen im Alltagsmanagement erwerbstätiger Pflegender
- 4.3 Strategie I: Nutzung professioneller Pflege- und Beratungsangebote
- 4.3.1 Ambulante Pflege als Unterstützung im Alltag.
- 4.3.2 Informationszugänge erwerbstätige Pflegender_
- 4.3.1.1 Zwischenfazit: Strategie I
- 4.4 Strategie II: Einbeziehung des familiären Netzes
- 4.4.1.1 Zwischenfazit: Strategie II
- 4.5 Strategie III: Einbeziehung von Freunden, Bekannten und Nachbarn_
- 4.5.1.1 Zwischenfazit: Strategie III
- 4.6 Strategie IV: Zugang zu pflegefreundlichen beruflichen Konditionen
- 4.6.1.1 Zwischenfazit Strategie IV_
- 4.7 Strategien: Schlussfolgerungen
- 5. Beeinflussen Motive die Wahl der Handlungsstrategie?
- 6. Schlussfolgerungen dieser Arbeit
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Herausforderung, Erwerbstätigkeit und Familienpflege für ambulant versorgte Pflegebedürftige in Einklang zu bringen. Die Studie untersucht die Motivationen und Strategien von erwerbstätigen Pflegenden im Alltagsmanagement.
- Die Studie analysiert die Motive, die erwerbstätige Pflegende dazu bewegen, die Pflege von Familienmitgliedern zu übernehmen.
- Die Arbeit untersucht verschiedene Strategien, die erwerbstätige Pflegende im Alltag anwenden, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu gewährleisten.
- Die Studie beleuchtet den Einfluss von soziodemografischen Faktoren auf die Motivationsstruktur und die Wahl von Strategien.
- Die Arbeit analysiert die Rolle von professionellen und informellen Unterstützungssystemen im Alltagsmanagement erwerbstätiger Pflegender.
- Die Studie diskutiert die Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienpflege.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Thematik der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familienpflege in den Kontext der demografischen Entwicklung und der Zunahme der Pflegebedürftigkeit dar. Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Studie, die auf qualitativen Interviews mit erwerbstätigen Pflegenden basiert. Kapitel 3 analysiert die Motive der Interview-Partner, die sich mit der Pflege von Familienmitgliedern auseinandersetzen. Kapitel 4 untersucht die Strategien, die die Interview-Partner im Alltag anwenden, um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege zu gewährleisten. Kapitel 5 diskutiert den Einfluss von Motiven auf die Wahl der Strategien. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der Studie zusammen und zieht Schlussfolgerungen für die Praxis und die weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Familienpflege, Erwerbstätigkeit, Motivation, Strategien, Alltagsmanagement, ambulante Pflege, prosoziales Verhalten, demografischer Wandel, Pflegebedürftigkeit, Unterstützungssysteme, qualitative Forschung, Interviews.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptmotive für die Übernahme häuslicher Pflege durch Erwerbstätige?
Die Studie identifizierte drei Rahmenmotive: das häusliche Versorgungsideal, die Beziehung zum Pflegebedürftigen sowie Austauschbeziehungen (prosozial vs. materiell). Kernmotive sind oft Schuldgefühle, Pflichtgefühl oder religiöse Überzeugungen.
Gibt es Unterschiede in der Pflegemotivation zwischen Stadt und Land?
Ja, die Untersuchung zeigt Unterschiede vor allem bei den Motiven „materielle Austauschbeziehung“ und „Verpflichtung vs. persönlicher Anspruch“, was auf die unterschiedlichen sozialen Milieus zurückzuführen ist.
Welche Strategien nutzen erwerbstätige Pflegende im Alltagsmanagement?
Wichtige Strategien sind die Nutzung professioneller Dienste, die Einbeziehung des familiären Netzes, die Unterstützung durch Freunde/Nachbarn sowie der Zugang zu pflegefreundlichen Arbeitsbedingungen.
Welche Rolle spielt prosoziales Verhalten in der Pflege?
Prosoziales Verhalten wird als biologisch angelegt, kulturelle Norm oder moralischer Imperativ betrachtet und bildet das theoretische Fundament für das Engagement der Pflegenden.
Wie beeinflussen die Motive die Wahl der Handlungsstrategie?
Die Arbeit diskutiert, inwieweit die zugrundeliegende Motivation (z.B. Pflichtgefühl vs. materielles Interesse) bestimmt, ob eher formelle Hilfe oder informelle Netzwerke zur Bewältigung des Alltags genutzt werden.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege?
Die Zunahme der Pflegebedürftigkeit bei gleichzeitig steigender Erwerbsquote führt zu enormem Zeit- und Organisationsdruck, der oft durch komplexe Alltagsstrategien aufgefangen werden muss.
- Citation du texte
- Kirsten von der Crone (Auteur), 2009, Motivationen und Strategien im Alltagsmanagement bei erwerbstätigen Pflegenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164917