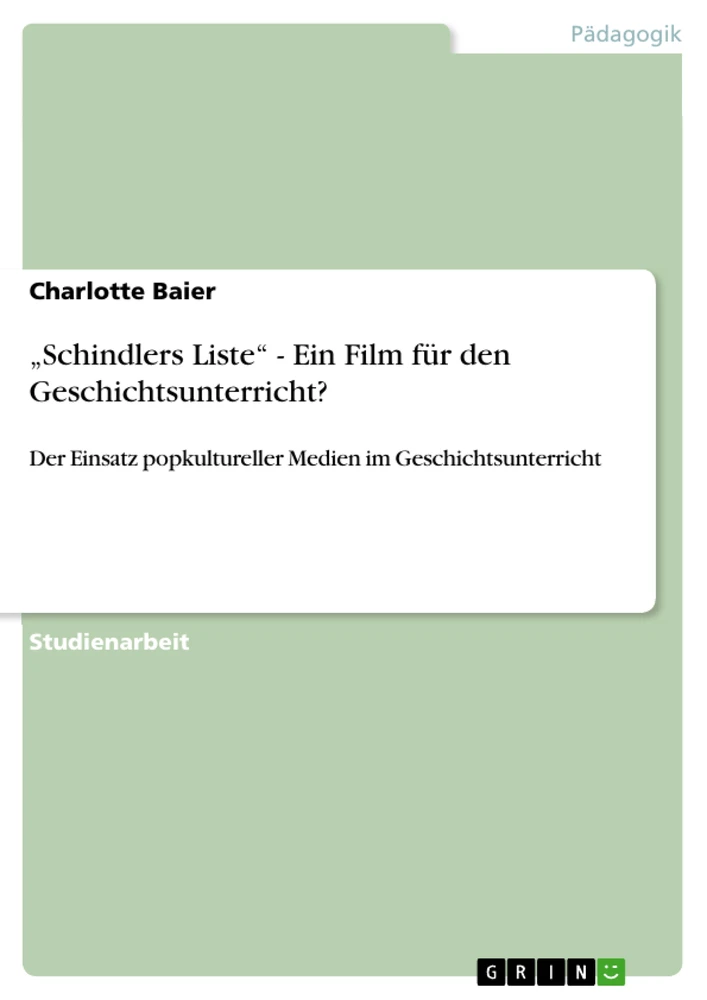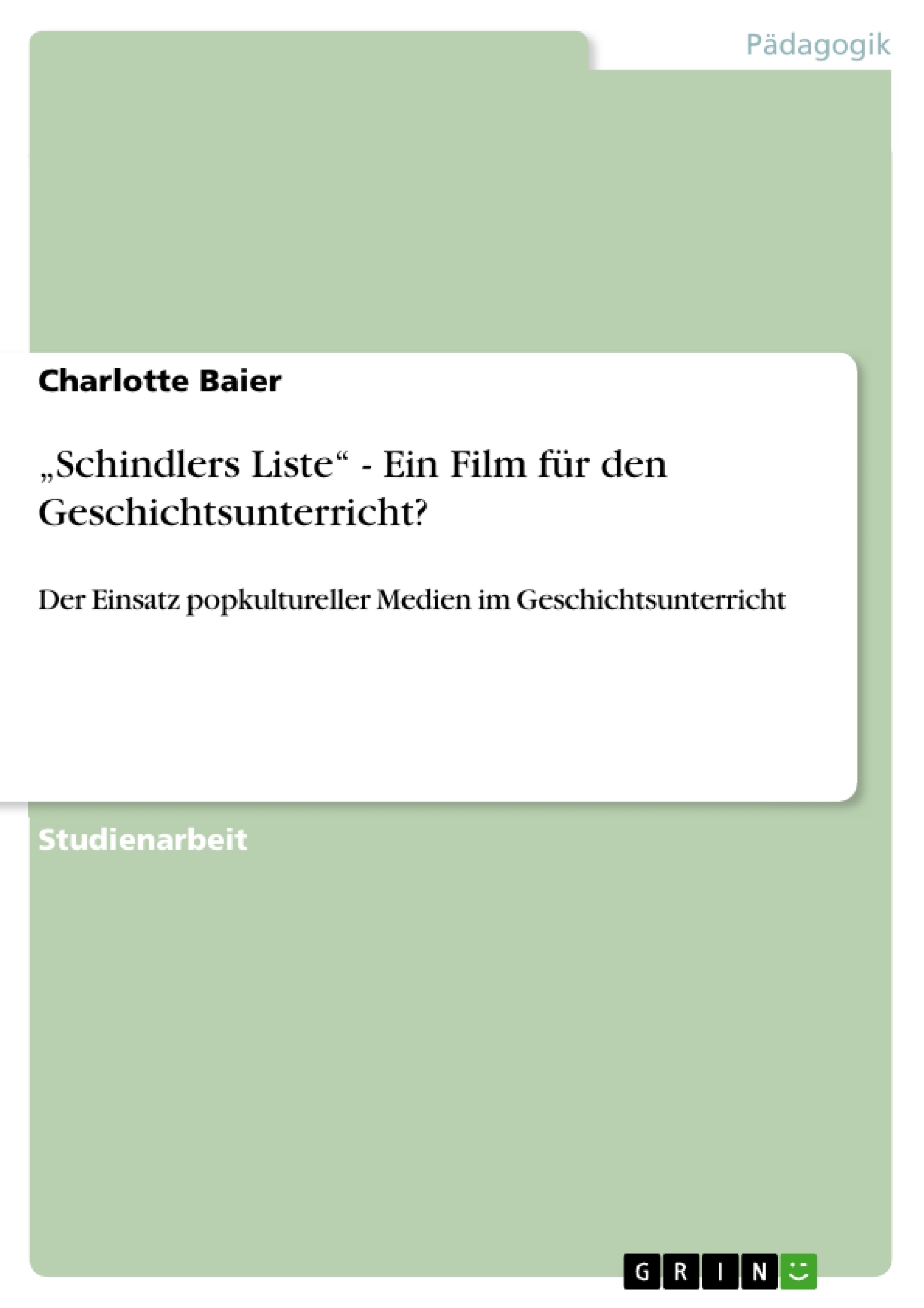Dieses Semester hospitierte ich im Rahmen meines Fachpraktikums in dem Geschichtsunterricht einer zehnten Klasse. Das behandelte Thema war das Dritte Reich. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich zu der Klasse stieß, war diese bereits beim Thema der Judenverfolgung und -vernichtung angelangt. In diesem Zusammenhang zeigte die Lehrerin den Film „Schindlers Liste“. Wie zu erwarten, waren die Schüler durch den Film sehr erschüttert. Was mich jedoch an dieser Stelle störte, war das der Film weder vorher noch nachher ausführlich behandelt wurde. Die Nachbereitung bestand allein darin, dass die Schüler und Schülerinnen ihre Eindrücke zum Film schildern sollten. Ich fragte mich, ob der Einsatz des Films so überhaupt irgendein Nutzen für die Schüler hatte, außer der Tatsache, dass sie nun Emotionen mit dem Thema verbanden. Daher möchte ich mich in der vorliegenden Hausarbeit mit der Frage beschäftigen, ob der Film „Schindlers Liste“ überhaupt ein Film für den Geschichtsunterricht ist. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit dem Film, ist meine Behauptung, dass „Schindlers Liste“ popkulturell ist. Ausgehend von der Popkultur Theorie von Gabriele Klein werde ich diese These im ersten Kapitel prüfen. Daran schließt die Frage an, ob ein popkulturelles Medium sich überhaupt eignet, um ein Ereignis, wie den Holocaust, angemessen darzustellen. Ich werde in diesem Rahmen auf die Diskussion zu dieser Frage eingehen, die mit dem Erscheinen des Films losgetreten wurde und mich mit den Argumenten auseinandersetzen. Ich orientiere mich hier vor allem an der von Christoph Weiss veröffentlichen Sammlung verschiedener Kritiken zu „Schindlers Liste“. Weiterhin werde ich im dritten Kapitel erörtern, ob unter diesen Umständen der Einsatz des Films im Geschichtsunterricht noch zu empfehlen ist. Insbesondere ist hinterfragungswürdig, ob damit nicht eine Anbiederung an die Eigenwelten der Schüler und damit ein Eindringen des Pop in den Unterricht darstellt. Hier wird diskutiert, ob damit, wie Thomas Ziehe es behauptet, verhindert wird, dass Schüler sich mit ihnen fremden Medien/ Themen auseinanderzusetzen lernen. In diesem Zusammenhang erörtere ich Vor- und Nachteile des Filmeinsatzes im GU, am Beispiel von „Schindlers Liste“. Zum Abschluss werde ich auf die Möglichkeiten des Filmeinsatzes im Unterricht eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Popkulturelle Elemente im Spielfilm „Schindlers Liste“
- Die Konsumentenorientierung
- Der Aufbau der Handlung
- Der Realismusanspruch des Films
- Konsumismus
- Zusammenfassung
- Der Holocaust als Teil der Popkultur?
- Die Kritik zum Film
- Die Umsetzung des Holocaust in fiktiven Filmen
- Schindlers Liste - Ein Film für den Geschichtsunterricht?
- Vorteile des Einsatzes von „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht
- Nachteile des Einsatzes von „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht
- Schindlers Liste - Ein Film für den Geschichtsunterricht
- Möglichkeiten zum Umgang mit „Schindlers Liste“
- Unterrichtspraktische Hinweise zum Einsatz von „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Films „Schindlers Liste“ für den Geschichtsunterricht. Ausgehend von der These, dass der Film ein popkulturelles Produkt ist, wird dessen Darstellung des Holocaust kritisch beleuchtet. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Einsatz eines popkulturellen Mediums zur Vermittlung eines so sensiblen Themas wie dem Holocaust pädagogisch sinnvoll ist und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt.
- Die Einordnung von „Schindlers Liste“ als popkulturelles Medium
- Die Darstellung des Holocaust in „Schindlers Liste“ und die damit verbundene Kritik
- Die didaktischen Chancen und Herausforderungen des Filmeinsatzes im Geschichtsunterricht
- Die Auseinandersetzung mit der emotionalen Wirkung des Films auf Schüler
- Möglichkeiten des konstruktiven Umgangs mit dem Film im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Beobachtung einer Geschichtsstunde, in der „Schindlers Liste“ ohne ausreichende Vor- und Nachbereitung gezeigt wurde. Die Autorin hinterfragt den Nutzen des bloßen emotionalen Erlebens des Films und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung des Films für den Geschichtsunterricht. Die Arbeit gliedert sich in die Untersuchung der Popkulturellen Einordnung des Films, die kritische Auseinandersetzung mit der filmischen Darstellung des Holocaust und die didaktische Bewertung des Filmeinsatzes im Unterricht.
Popkulturelle Elemente im Spielfilm „Schindlers Liste“: Dieses Kapitel analysiert „Schindlers Liste“ im Kontext der Popkulturtheorie. Es untersucht die verschiedenen Aspekte des Films, wie z.B. die Konsumentenorientierung, den Aufbau der Handlung, den Realismusanspruch und den Einfluss des Konsumismus. Diese Analyse dient als Grundlage für die spätere Bewertung der Eignung des Films für den Geschichtsunterricht.
Der Holocaust als Teil der Popkultur?: Dieses Kapitel befasst sich mit der kontroversen Diskussion um die Darstellung des Holocaust in fiktiven Filmen und insbesondere in „Schindlers Liste“. Es werden kritische Stimmen und Argumentationen zu diesem Thema zusammengefasst und analysiert, um die Komplexität der filmischen Auseinandersetzung mit dem Thema zu beleuchten.
Schindlers Liste - Ein Film für den Geschichtsunterricht?: Dieses Kapitel bewertet die Vor- und Nachteile des Einsatzes von „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht. Es diskutiert kritisch die möglichen Risiken und Chancen und bietet unterrichtspraktische Hinweise für einen sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Film im Unterricht, um einen konstruktiven Lernprozess zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
Schindlers Liste, Geschichtsunterricht, Popkultur, Holocaust, Filmdidaktik, emotionales Lernen, kritische Medienanalyse, didaktische Herausforderungen, pädagogischer Nutzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Schindlers Liste" im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung des Films „Schindlers Liste“ für den Geschichtsunterricht. Sie analysiert den Film kritisch unter Berücksichtigung seiner popkulturellen Einordnung und der damit verbundenen Darstellung des Holocaust. Die zentrale Frage ist, ob der Einsatz eines popkulturellen Mediums zur Vermittlung des Holocaust pädagogisch sinnvoll ist und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringt.
Welche Aspekte von "Schindlers Liste" werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte: die Einordnung des Films als popkulturelles Medium, die Darstellung des Holocaust im Film und die damit verbundene Kritik, die didaktischen Chancen und Herausforderungen des Filmeinsatzes im Geschichtsunterricht, die emotionale Wirkung des Films auf Schüler und Möglichkeiten des konstruktiven Umgangs mit dem Film im Unterricht.
Wie wird "Schindlers Liste" im Kontext der Popkultur betrachtet?
Das Kapitel "Popkulturelle Elemente im Spielfilm „Schindlers Liste“" analysiert den Film unter popkulturellen Gesichtspunkten. Es untersucht die Konsumentenorientierung, den Aufbau der Handlung, den Realismusanspruch und den Einfluss des Konsumismus, um die Einordnung des Films in die Popkultur zu beleuchten und dessen Eignung für den Geschichtsunterricht zu bewerten.
Welche Kritikpunkte an der Darstellung des Holocaust in "Schindlers Liste" werden angesprochen?
Das Kapitel "Der Holocaust als Teil der Popkultur?" befasst sich mit der kontroversen Diskussion um die Darstellung des Holocaust in fiktiven Filmen, inklusive "Schindlers Liste". Kritische Stimmen und Argumentationen werden zusammengefasst und analysiert, um die Komplexität der filmischen Auseinandersetzung mit dem Thema zu verdeutlichen.
Welche Vor- und Nachteile bietet der Einsatz von "Schindlers Liste" im Geschichtsunterricht?
Das Kapitel "Schindlers Liste - Ein Film für den Geschichtsunterricht?" bewertet die Vor- und Nachteile des Filmeinsatzes im Geschichtsunterricht. Es diskutiert die möglichen Risiken und Chancen und bietet unterrichtspraktische Hinweise für einen sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Film, um einen konstruktiven Lernprozess zu gewährleisten. Die Arbeit berücksichtigt dabei die potenziellen emotionalen Auswirkungen des Films auf die Schüler.
Welche konkreten didaktischen Hinweise werden gegeben?
Die Arbeit bietet unterrichtspraktische Hinweise zum Einsatz von „Schindlers Liste“ im Geschichtsunterricht, um einen verantwortungsvollen und konstruktiven Umgang mit dem Film im Unterricht zu ermöglichen und die emotionalen Auswirkungen auf die Schüler zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schindlers Liste, Geschichtsunterricht, Popkultur, Holocaust, Filmdidaktik, emotionales Lernen, kritische Medienanalyse, didaktische Herausforderungen, pädagogischer Nutzen.
Welche Struktur hat die Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Ausgangspunkt und die Forschungsfrage darstellt. Es folgen Kapitel zur popkulturellen Einordnung des Films, zur Kritik an seiner Darstellung des Holocaust und zur didaktischen Bewertung seines Einsatzes im Unterricht. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Charlotte Baier (Author), 2010, „Schindlers Liste“ - Ein Film für den Geschichtsunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164955