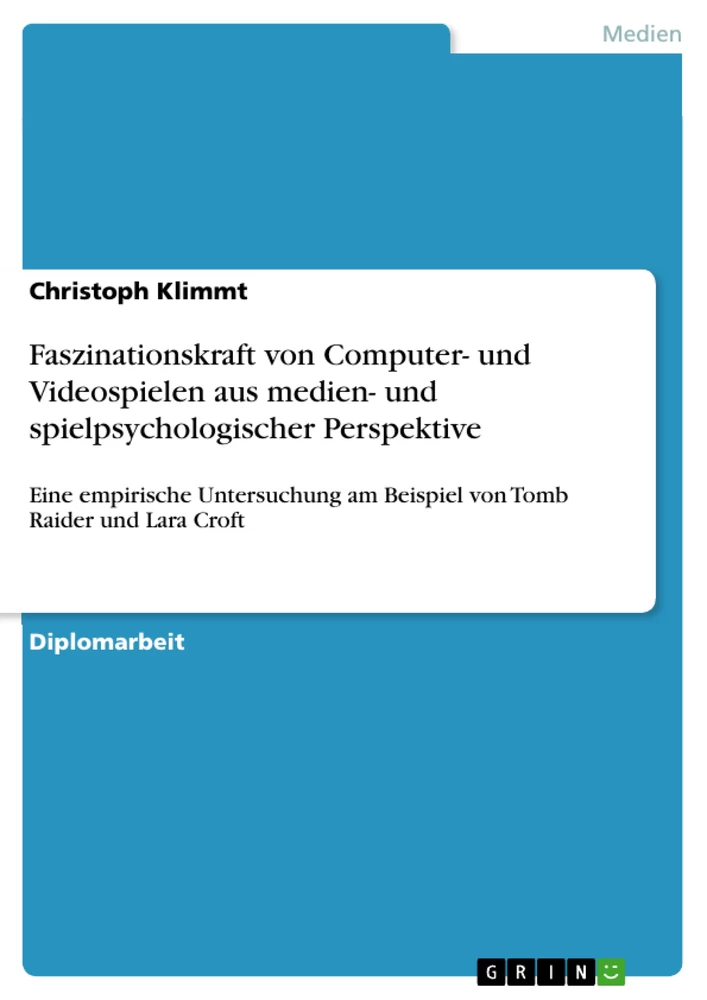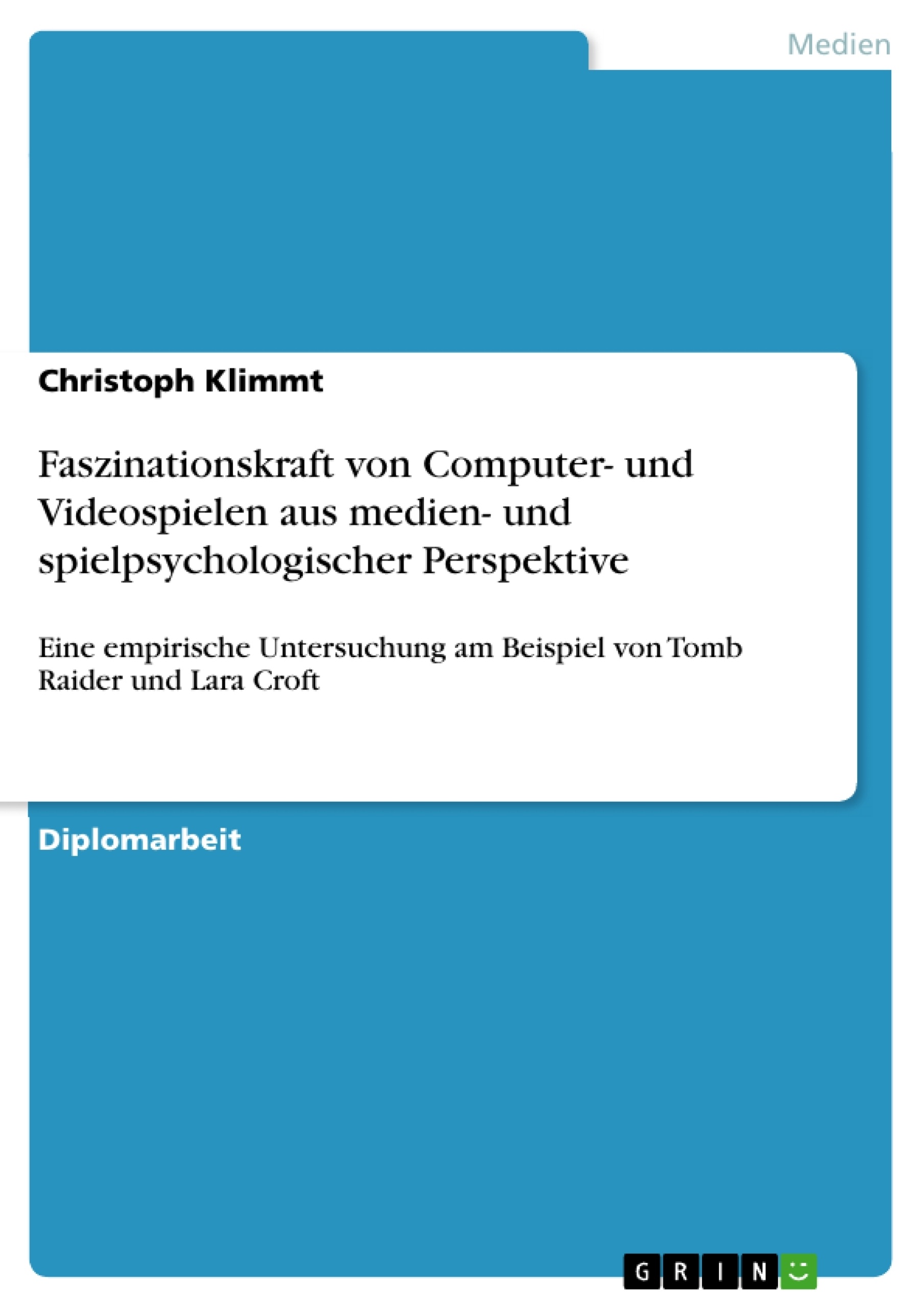1. Problem
„In 1962, the first computer game was invented by some hackers at MIT. It was called Spacewar. ... Why was Spacewar the „natural“ thing to build with this new technology? Why not a pie chart or an automated kaleidoscope or a desktop? Its designers identified action as the key ingredient and conceived Spacewar as a game that could provide a good balance between thinking and doing for its players. They regarded the computer as a machine naturally suited for representing things that you could see, control and play with. Its interesting potential lay not in its ability to perform calculations but its capacity to represenct action in which humans could participate“ (Laurel, 1991, S. 1).
Wer sich durch Medien unterhalten will, nimmt typischerweise die Rolle eines Beobachters ein. Die Handlung eines Romans läuft im Kopf der Leser ab, die Geschichte eines Films ‚passiert‘ auf der Leinwand, die Ereignisse der Fernsehshow finden auf dem Bildschirm statt. Traditionelle mediale Unterhaltung ist Unterhaltung durch Medien. Computer- und Videospiele sind ebenfalls mediale Unterhaltungsangebote, doch sie sind ganz anders: Sie sind die bislang einzigen wirklich erfolgreichen Vertreter interaktiver Unterhaltung. Auf viele Menschen üben sie eine geradezu unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Diesen Menschen bereitet es offenbar großes Vergnügen, sich nicht nur durch, sondern mit Medien zu unterhalten. Zum Beobachten tritt das Handeln, aus ‚Zeugen‘ werden ‚Täter‘.
Warum faszinieren Computer- und Videospiele ihre Nutzer? Worin besteht die außergewöhnliche Fähigkeit dieser Spiele, so viele Jugendliche und Erwachsene lange Zeit und immer wieder zu fesseln?
Die vorliegende Arbeit liefert einen Versuch, diese Fragestellung zu beantworten. Sie basiert auf der Grundannahme, dass Computer- und Videospiele (im Folgenden auch zusammenfassend als ‚Computerspiele‘ bezeichnet) Merkmale von klassischer medialer Unterhaltung – nämlich das ‚Zusehen‘ - und von Spielzeugen – nämlich die spielerischen Handlungsmöglichkeiten - miteinander verbinden. Deswegen wird der theoretische Zugang sowohl medien- als auch spielpsychologische Überlegungen umfassen. Auf der Basis von Rezeptions- und Spieltheorie wird eine Erklärung für die Faszinationskraft von Computer- und Videospielen entwickelt, die dann in einer empirischen Studie geprüft wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Problem
- Nutzung und Verbreitung von Computer- und Videospielen
- Was sind Computer- und Videospiele?
- Stand der Forschung
- Computerspiele als mediale Unterhaltung
- Computerspiele als Spiele
- Fazit zum Stand der Forschung
- Theoretischer Zugang
- Medienpsychologischer Zugang
- Die Theorien Zillmanns
- Der Zugang von Horton und Wohl: Parasoziale Interaktion
- Zur Anwendbarkeit des Konzepts der Parasozialen Interaktion auf Computer- und Videospiele
- Spielpsychologischer Zugang
- Das Flow-Konzept von Csikszentmihalyi
- Der Aktivierungszirkel nach Heckhausen
- Aufforderungscharakter in der Feldtheorie Lewins
- Zur Anwendbarkeit des Konzepts des Aufforderungscharakters auf Computer- und Videospiele
- Integration der theoretischen Zugänge
- Der spezifische Aufforderungscharakter von Computer- und Videospielen
- Zur Kompatibilität der beiden theoretischen Zugänge
- Ableitung der Hypothesen
- Methode
- "Tomb Raider" und Lara Croft
- Hypothesenprüfung
- Unabhängige Variablen
- Abhängige Variablen
- Pretest zur Skalenentwicklung
- Entwicklung einer Skala zum Aufforderungscharakter auf der Basis empirischer Daten
- Durchführung
- Ergebnisse
- Beschreibung der Stichprobe
- Zur Eignung der Stichprobe für die Hypothesenprüfung
- Prüfung der Hypothesen
- Diskussion
- Literatur
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungen und Zeichen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die besondere Faszinationskraft von Computer- und Videospielen aus medien- und spielpsychologischer Perspektive. Sie basiert auf der Annahme, dass diese Spiele Elemente klassischer medialer Unterhaltung (Zusehen) und Spielzeuge (spielerische Handlungsmöglichkeiten) kombinieren. Ziel ist es, eine Erklärung für die Faszinationskraft dieser Spiele zu entwickeln und anhand einer empirischen Studie zu überprüfen.
- Die Verbreitung und Nutzung von Computer- und Videospielen, insbesondere bei Jugendlichen.
- Die Kombination von medialen und spielerischen Aspekten in Computer- und Videospielen.
- Die Anwendung medienpsychologischer und spielpsychologischer Konzepte auf die Faszinationskraft von Computer- und Videospielen.
- Die Entwicklung und Prüfung von Hypothesen zur Erklärung der Faszinationskraft von Computer- und Videospielen.
- Die Rolle des "Aufforderungscharakters" und der "Parasozialen Interaktion" in der Rezeption von Computer- und Videospielen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Problem der Faszinationskraft von Computer- und Videospielen dar und beschreibt die Nutzung und Verbreitung dieser Spiele, insbesondere unter Jugendlichen. Das zweite Kapitel referiert den Stand der Forschung zu Computerspielen als mediale Unterhaltung und als Spiele. Das dritte Kapitel erläutert den theoretischen Zugang zum Problem und stellt medienpsychologische Konzepte wie die Theorien Zillmanns und das Konzept der Parasozialen Interaktion sowie spielpsychologische Konzepte wie das Flow-Konzept von Csikszentmihalyi und den Aktivierungszirkel nach Heckhausen vor. Das vierte Kapitel integriert die beiden theoretischen Zugänge und leitet drei Hypothesen zur Erklärung der Faszinationskraft von Computer- und Videospielen ab. Das fünfte Kapitel beschreibt die Methode, mit der diese Hypothesen empirisch geprüft werden, einschließlich der Auswahl des Videospiels "Tomb Raider" und der Entwicklung einer Skala zum Aufforderungscharakter. Das sechste Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, einschließlich der Beschreibung der Stichprobe und der Prüfung der Hypothesen. Die Arbeit endet mit einer Diskussion der Ergebnisse im siebten Kapitel, die die Fragestellung und die theoretischen Vorarbeiten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Computer- und Videospiele, mediale Unterhaltung, spielpsychologischer Zugang, medienpsychologischer Zugang, Faszinationskraft, Parasoziale Interaktion, Aufforderungscharakter, Flow-Konzept, Aktivierungszirkel, empirische Studie, "Tomb Raider", Lara Croft.
- Quote paper
- Christoph Klimmt (Author), 2000, Faszinationskraft von Computer- und Videospielen aus medien- und spielpsychologischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165