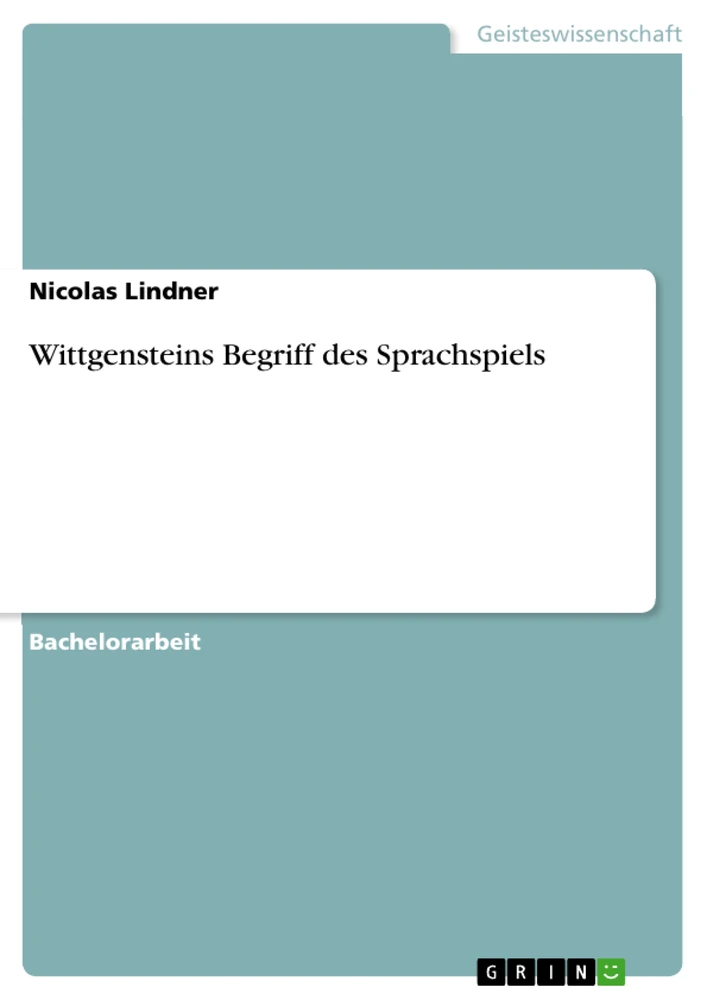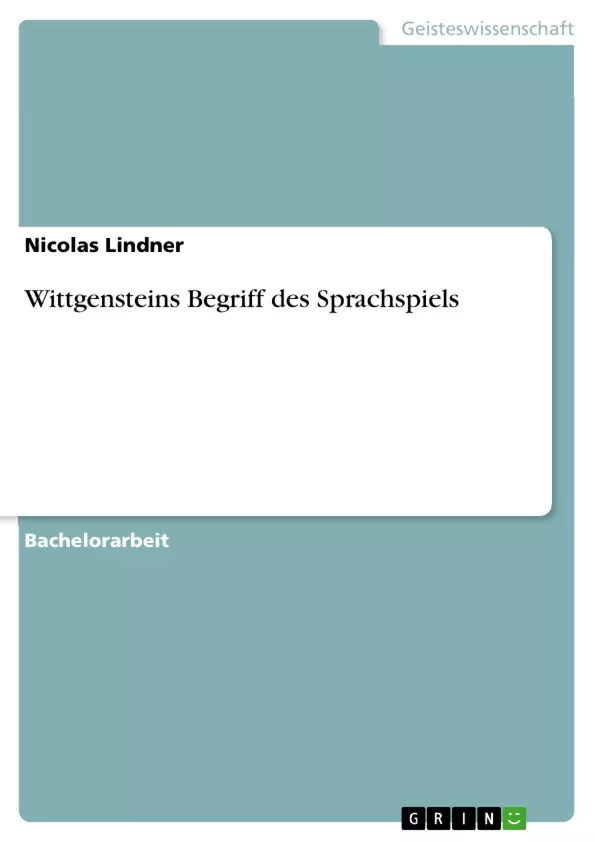Im Mittelpunkt der "Philosophischen Untersuchungen" (PU) stehen Wittgensteins Gedanken zur Philosophie der Sprache. Der Schlüsselbegriff seiner späten Philosophie ist der Begriff des Sprachspiels. Ein umfassendes Verständnis dieses Begriffs erscheint somit unabdingbar, um die Wittgensteinschen Überlegungen zur Sprache in den PU hinreichend nachvollziehen zu können. Demzufolge möchte ich in vorliegender Arbeit den Versuch einer textnahen und adäquaten Annäherung an den Begriff des Sprachspiels unternehmen. Ziel der Arbeit soll sein, mit Hilfe jener Begriffsklärung die zentralen Gedanken Wittgensteins zur Sprachphilosophie herauszuarbeiten und zu erläutern Auf diesem Wege soll verdeutlicht werden, welche Neuerungen, Vorteile und Anregungen der Wittgensteinsche Ansatz bietet und inwiefern er hiermit Substanzielles zur Philosophie der Sprache beiträgt.
Im vorliegender Arbeit werde ich allgemeine Charakteristika aller Sprachspiele in den PU darstellen. In einem weiteren Schritt sollen dann die verschiedenen Verwendungsweisen des Begriffes vorgestellt und anhand wesentlicher Merkmale umrissen werden. Um das Verständnis des Sprachspielbegriffes abzurunden, möchte ich zuletzt einige weitere zentrale Begriffe aus den PU erläutern, welche mit Wittgensteins Gedanken zum Sprachspiel verknüpft und für deren umfassendes Verständnis unabdingbar sind. Hierbei soll es um die Wittgensteinschen Grundbegriffe „Familienähnlichkeit“ und „Lebensform“ sowie um seine Überlegungen zum Regelfolgen gehen. Im Fazit möchte ich zuletzt die Frage behandeln, inwiefern die erarbeiteten Gedanken Wittgensteins geeignet sind, die Struktur und die Funktionsweise der Sprache zu erfassen. Dies soll an dieser Stelle auch in einer Gegenüberstellung der Grundgedanken des Traktats und der PU geschehen. Hierbei soll das Hauptaugenmerk auf der Frage liegen, welche Vorzüge und Nachteile die Überlegungen in den PU bieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Sprachspiels
- Das Sprachspiel im „Blauen Buch“
- Das Sprachspiel im „Braunen Buch“
- Das Sprachspiel in den PU ...
- Entstehung des ersten Teils der PU.
- Allgemeine Merkmale des Sprachspielbegriffs.
- Sprachspiel, Gebrauch und Bedeutung
- Das Sprachspiel als primitive Sprachform.
- Sprachspiel und Kindersprache..
- Sprachspiele als sprachliche Aktivitäten.
- Das Sprachspiel als Ganzes der Sprache..
- Sprachspiel und Familienähnlichkeit...
- Sprachspiel und Regelfolgen
- Sprachspiel und Lebensform..
- Fazit....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Begriff des Sprachspiels in Ludwig Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“. Ziel ist es, den Begriff des Sprachspiels anhand des Textes zu analysieren und seine zentralen Merkmale herauszuarbeiten. Dabei sollen die Neuerungen, Vorteile und Anregungen, die der Wittgensteinsche Ansatz bietet, und sein Beitrag zur Philosophie der Sprache verdeutlicht werden.
- Analyse des Begriffs des Sprachspiels in Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“
- Hervorhebung der zentralen Merkmale des Sprachspiels
- Bewertung des Beitrags des Wittgensteinschen Ansatzes zur Philosophie der Sprache
- Erörterung der "Familienähnlichkeiten" als Ansatz zur Beschreibung der Sprachspielbedeutung
- Untersuchung der Verbindung zwischen Sprachspiel und Lebensform
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Relevanz von Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“ und dem Sprachspiel-Begriff beleuchtet wird. Im darauffolgenden Kapitel werden die verschiedenen Bedeutungen des Sprachspiels, wie sie in Wittgensteins „Blauen Buch“ und „Braunen Buch“ sowie den „Philosophischen Untersuchungen“ erscheinen, untersucht.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Konzept der „Familienähnlichkeiten“, welches Wittgenstein als Alternative zu traditionellen Definitionen vorschlägt. Anschließend werden die Zusammenhänge zwischen Sprachspielen und Regelfolgen sowie Lebensform erörtert.
Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die zentralen Erkenntnisse zusammenfasst und die Bedeutung des Sprachspiel-Begriffs für die Philosophie der Sprache hervorhebt.
Schlüsselwörter
Sprachspiel, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Familienähnlichkeit, Lebensform, Sprachphilosophie, gewöhnliche Sprache, Sprechakttheorie
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wittgenstein unter einem „Sprachspiel“?
Ein Sprachspiel ist die Einheit aus Sprache und den Handlungen, mit denen sie verwoben ist. Es betont, dass die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch liegt.
Was bedeutet der Begriff „Familienähnlichkeit“?
Es beschreibt die Idee, dass Begriffe nicht durch ein gemeinsames Merkmal, sondern durch ein Netz überlappender Ähnlichkeiten (wie bei einer Familie) verbunden sind.
Wie hängen Sprachspiel und „Lebensform“ zusammen?
Sprachspiele sind Teil einer Lebensform. Sprache zu verstehen bedeutet, die sozialen Praktiken und Regeln einer Gemeinschaft zu teilen.
Welche Rolle spielt das „Regelfolgen“ bei Wittgenstein?
Sprachspiele basieren auf Regeln. Wittgenstein untersucht, wie wir Regeln verstehen und anwenden, ohne dass diese immer explizit definiert sein müssen.
Wie unterscheidet sich die Spätphilosophie vom „Tractatus“?
Im Gegensatz zum Tractatus, der eine ideale Logik suchte, konzentrieren sich die „Philosophischen Untersuchungen“ auf die Funktionsweise der gewöhnlichen Sprache im Alltag.
- Quote paper
- B.A. Nicolas Lindner (Author), 2010, Wittgensteins Begriff des Sprachspiels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165015